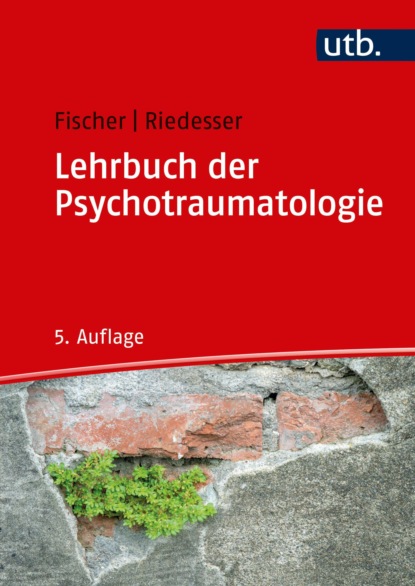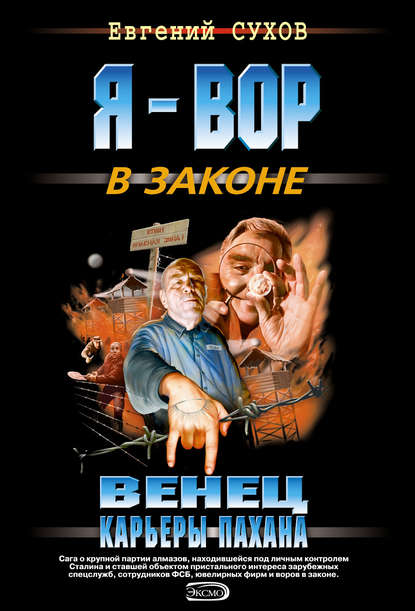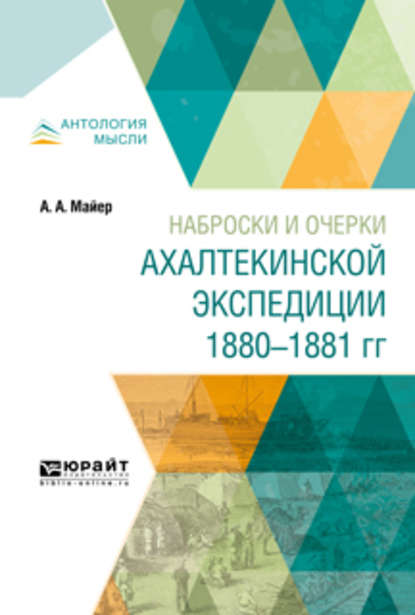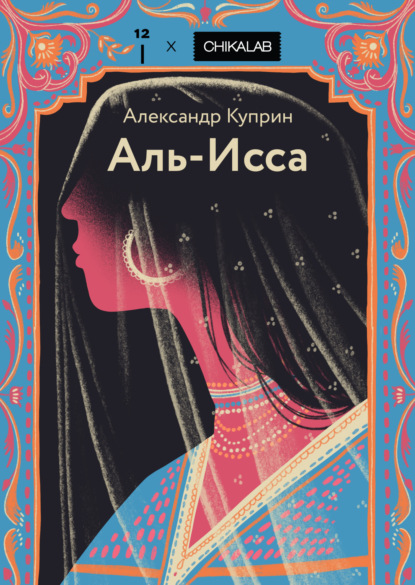- -
- 100%
- +
Für Donovan hat der Ausdruck „Traumatology“ programmatischen Charakter. Er grenzt ihn zunächst von der chirurgischen Traumatologie ab und kommt dann auf das erweiterte besondere Forschungsfeld zu sprechen, das der Ausdruck bezeichnen soll:
„Der Ausdruck ,Traumatologie‘ ist nicht neu in der Medizin. Traditionellerweise bezeichnet er einen Zweig der Chirurgie, der sich beschäftigt mit Wunden und Behinderungen, die von einer Verletzung stammen. Unsere Verwendung jedoch spiegelt das Entstehen eines genuinen Forschungsfeldes wider, das aus Bemühungen entstanden ist, die früher als disparat wahrgenommen wurden. Bei allem Respekt, den wir den vielfältigen mikrokosmischen Universen des menschlichen Körpers schulden und der Komplexität seiner Reaktion auf physische Verletzungen, so bezeichnet unsere Verwendung des Begriffs Traumatologie doch ein viel breiteres, ein wirklich umfassendes Feld, ein schon existierendes Forschungsfeld, das darauf wartet, erkannt, organisiert und entwickelt zu werden – ganz ähnlich wie ein Land darauf wartet, entdeckt zu werden“ (Donovan 1991, 433, Übersetzung G. F.).
Für Donovan stellt also Traumatologie ein übergeordnetes Gebiet dar, das die chirurgische Traumatologie als ein besonderes Fach einschließt. Er kommt zu folgender Definition:
„Traumatologie ist das Studium der natürlichen und vom Menschen hervorgerufenen Traumata (vom ,natürlichen‘ Trauma, von Unfällen und Erdbeben bis hin zu den Schrecken unbeabsichtigter oder auch beabsichtigter menschlicher Grausamkeit), von deren sozialen und psychobiologischen Folgen und den prädiktiven/präventiven/interventionistischen Regeln, die sich aus diesem Studium ergeben“ (434).
Donovan betont, dass die Traumatologie seiner Meinung nach ein neues, in sich zusammenhängendes Forschungsfeld darstelle und als solches betrieben werden sollte. Er führt einige Ansätze an, die als Vorläufer dieser künftig zu entwickelnden Disziplin betrachtet werden können, die aber bezeichnenderweise im etablierten Wissenschaftsbetrieb mehr oder weniger untergegangen seien, so etwa die Erforschung traumatischer Sozialisationserfahrungen, die in der modernen „biologischen Psychiatrie“ heute kaum noch Beachtung finde. Ein ähnliches Schicksal hätten viele Bereiche traumatologischer Forschung erfahren. In verschiedenen Disziplinen führen sie eine Rand- oder Schattenexistenz. Sie haben sich bisher nicht zu einer konsistenten Theorie und Bestimmung eines Forschungsfeldes zusammengefunden. Desto notwendiger erscheint Donovan ein transdisziplinärer Forschungsansatz „Traumatologie“, der in sehr unterschiedliche Felder hineinreicht. Traumatologie sei notwendigerweise so komplex, dass sie sehr unterschiedliche Bereiche von Forschung und klinischer Erfahrung einbeziehen müsse, wie etwa: „Cognitive studies; developmental, clinical and research psychology; medicine, anthropology; epidemiology; and even education research“ (loc. zit.).
Eine so umfassende Konzeption des neuen Forschungsgebietes blieb nicht unwidersprochen. Schnitt (1993) argumentiert zunächst, dass der Begriff „Traumatologie“ schon von der Chirurgie belegt sei. Er äußert im Übrigen die Befürchtung, eine neue Bezeichnung und die Abgrenzung eines neuen Forschungsgebietes könne die von Donovan beklagte Aufsplitterung des traumatologischen Wissens sogar noch weiter fördern und zu Separatismus führen. In seiner Erwiderung hält Donovan (1993) an Programmatik und Namen der neuen Disziplin fest und betont vor allem die Chance, bisher verstreute Wissensbestände zu integrieren. Ein weiterer Diskussionspunkt ist die Frage, ob angesichts der Komplexität des Wissens und der Dringlichkeit seiner praktischen Umsetzung nicht möglicherweise auch eine eigene Berufsgruppe ausgebildet werden sollte. Donovan beurteilt eine solche Möglichkeit grundsätzlich positiv, während Schnitt Dilettantismus befürchtet und den Berufsabschluss in einer traditionellen Disziplin als Voraussetzung für praktische traumatologische Tätigkeit betrachtet.
Zumindest für den deutschen Sprachraum scheint es uns sinnvoll zu sein, den Ausdruck Psycho-Traumatologie zu verwenden, unter anderem in Abgrenzung von der Chirurgischen Traumatologie. In ihrem Lehrbuch beschreiben Kuner und Schlosser (1988) die Geschichte der chirurgischen Traumatologie folgendermaßen:
„Die Erkennung und Behandlung von Unfall- und Verletzungsfolgen gehört zu den ältesten Zweigen ärztlicher Tätigkeit. Verletzungen des Menschen durch Unfälle als Folge menschlicher Auseinandersetzungen sind so alt wie die Menschheit selbst, und in der Notwendigkeit, dem verletzten Mitmenschen zu helfen, liegt die Wurzel jeder Traumatologie“.
Psycho-Traumatologie, die Untersuchung und Behandlung seelischer Verletzungen und ihrer Folgen hat sicher ein ähnliches therapeutisches Ziel wie die chirurgische Traumatologie. Es ist aber aufschlussreich, dass sich eine solche Disziplin erst heute, also sehr viel später als die Wissenschaft von den körperlichen Wunden zu bilden beginnt. Haben die Menschen ihre seelischen Wunden bisher vernachlässigt, vielleicht schon deshalb, weil sie im Unterschied zu den körperlichen unsichtbar sind? Wir kommen im Folgenden Abschnitt auf diese Frage zurück. Jedenfalls stellt eine explizit psychologische und psychosomatische Traumatologie in der Geschichte der Medizin ein Novum dar. Dies sollte in der Bezeichnung auch zum Ausdruck kommen und terminologisch nicht mit der traditionellen medizinischen Traumatologie konfundiert werden. Eine Gefahr dieser Begriffswahl besteht vielleicht darin, das Gebiet zu stark zu verengen, so dass der fächerübergreifende Bezug, den Donovan mit seiner Programmatik fördern möchte, gefährdet wird. Diese Gefahr erscheint uns allerdings geringer als die komplementäre einer erneuten Vernachlässigung der menschlichen Erlebnissphäre, wie sie leider in der Medizin und sogar in der Psychologie lange Zeit zu beklagen war. Als terminologisches Anhängsel einer erweiterten medizinischen „Traumatologie“ sähe die neue Disziplin einem ungewissen oder, angesichts der bisherigen Erfahrungen, wohl sogar gewissen Schicksal entgegen. Der Ausdruck Psycho-Traumatologie soll die Aufmerksamkeit auf die menschliche Erlebnissphäre richten. Dabei dürfen die somato-psychischen und psycho-somatischen Wechselbeziehungen natürlich nicht vernachlässigt werden. Ebenso wenig die sozialen Bezüge der menschlichen Erfahrungswelt. Die Verletzungen jedoch, von denen das neue Gebiet handeln soll, liegen nicht primär im körperlichen und auch nicht vage in einem irgendwie konzipierten „sozialen Bereich“. Betroffen ist auch keine behavioristische „black-box“ oder sonst ein „Konstrukt“, sondern das verletzbare, sich-empfindende und sich-verhaltende menschliche Individuum, wenn es in seinen elementaren Lebensbedürfnissen bedroht und verletzt, in seiner menschlichen Würde und Freiheit missachtet wird. Psychologie als die Wissenschaft vom menschlichen Erleben und Verhalten kann hier zentrale Beiträge leisten, wenn sie sich nicht schon im Vorhinein ihres eigentlichen Gegenstandes entledigt, wie dies der → Behaviorismus tat. Von einer „Verhaltens-Traumatologie“ zu reden, wäre zumindest im deutschen Sprachverständnis einigermaßen widersinnig. Das Festhalten dagegen am Bezugspunkt einer je besonderen, individuellen Erlebnissphäre schafft erst die begriffliche Voraussetzung für eine Lehre von den psychischen Verletzungen, ihrem „natürlichen“, unbehandelten Verlauf und den Möglichkeiten ihrer therapeutischen Beeinflussung. Wie in den folgenden Abschnitten noch deutlich wird, verstehen wir den Ausdruck „Psycho-“ in Psychotraumatologie im Rahmen eines „Mehr-Ebenen-Konzepts“ von der psychosozialen und physischen Wirklichkeit. Die psychische Ebene wird darin als eine Differenzierungsform der körperlich-physischen gesehen. Sie stellt zugleich eine Individuierung, eine Besonderung der gesellschaftlich allgemeinen Kommunikations- und Beziehungsformen dar. Von daher muss die Psychotraumatologie unter sozialen und physiologisch-somatischen Gesichtspunkten zugleich betrieben werden. Ihr zentraler Bezugspunkt ist jedoch die menschliche Erlebnissphäre, die nicht weniger verletzbar, in ihren Funktions- und Regulationsbedingungen nicht weniger stör- und „kränkbar“ ist als die körperliche Ebene des psychophysischen menschlichen Weltverhältnisses.
Mit Donovan sind auch wir der Meinung, dass das „Stress“-Konzept, so große Verdienste es in Psychologie, Psychosomatik und innerer Medizin hat, nicht ausreicht, um das zu bezeichnen, was speziell den Gegenstand einer psychosozialen und psychosomatischen Traumatologie bildet: die Störung bzw. Zerstörung psychischer Strukturen und Funktionen, die in gewissem Sinne analog zu jenen Zerstörungen gesehen werden kann, mit denen sich die chirurgische Traumatologie befasst. Handelt es sich beim Vergleich von körperlichen und seelischen Verletzungen nur um ein Wortspiel, allenfalls eine Metapher? Oder können wir von strukturellen Entsprechungen beider Bereiche ausgehen? Und wenn, wo beginnt und wo endet eine solche Analogie? Mit diesen Fragen werden wir uns im Folgenden Abschnitt befassen.
1.1.1 Psychisches Trauma in einem polyätiologischen Modell
Wir wissen heute, dass psychotraumatische Erfahrungen zu seelischen Folgeschäden führen können, ohne dass zusätzliche Bedingungsfaktoren erforderlich sind. Psychische Traumatisierung ist demnach als eine eigenständige ätiologische (von altgr. = ursächliche) Kategorie der psychologischen Medizin zu betrachten. Darüber hinaus sollten bei Verursachung psychischer Störungen mindestens noch drei weitere typische Einflussgrößen berücksichtigt werden: Übersozialisation (z. B. zu strenge, rigide Erziehung), Untersozialisation (z. B. Verwöhnung oder Vernachlässigung) sowie biologische Faktoren genetisch angeborener, aber auch früh erworbener Art. Abbildung 1 gibt eine Übersicht über ein polyätiologisches Modell, das vier ätiologische Einflusssphären und ihre wechselseitigen Verflechtungen umfasst. Im Folgenden werden die einzelnen Größen und ihr Zusammenspiel diskutiert.
Psychotraumatische Einflüsse. Traumastörungen bilden eine der wenigen nosologischen (von altrg. nosos = Krankheit und logos = Lehre: Lehre von den Krankheitsbildern) Einheiten, deren Verursachung bekannt ist. Aus Forschungen zur Kriegstraumatisierung beispielsweise geht hervor, das PTBS umso eher auftritt, je enger ein Soldat am Zentrum des Kampfgeschehens eingesetzt wird. Allgemein üben Erbfaktoren zwar einen modifizierenden Einfluss aus, es ist bisher aber nicht gelungen, einzelne Gene zu identifizieren (Cornelis 2010). Dem psychotraumatischen Einflussfaktor entspricht nosologisch das Traumaspektrum psychischer Störungen, das über das basale PTBS hinaus die Syndrome der speziellen Psychotraumatologie umfasst sowie dissoziative Störungen, einen Teil der Borderline-Störungen und somatoforme Störungsbilder. Neben einer spezifischen Ätiologie weisen Traumastörungen eine spezifische Pathogenese auf (von altgr. pathos = Krankheit und genesis = Entstehung: Entstehungsverlauf eines Störungsbildes), die sich u. a. aus der Dynamik von Traumaschema und traumakompensatorischem System ergibt.
Übersozialisation. Dieser Einflussfaktor entspricht einem übermäßig strengen, rigiden und einengenden Erziehungsstil. Die Vitalität der Persönlichkeit wird unterdrückt. Triebimpulse und Phantasiesysteme werden durch die rigide Prägeform gewissermaßen „ausgestanzt“. Traditionell konservative Sozialisationsmuster üben hier ihren Einfluss aus, ebenso gibt es modernere, streng leistungsbezogene, aber nicht minder asketische Varianten dieses Sozialisationstyps. Die Pathogenese lässt sich oft nach dem psychodynamischen (Trieb-) Wunsch/Abwehr-Modell beschreiben. Es ließe sich zwar diskutieren, ob und wieweit ein übertrieben strenger und rigider Erziehungsstil im Ganzen als „traumatisch“ bezeichnet werden kann. Jedoch ist von einer Überdehnung des Traumabegriffs abzuraten, da traumatische Ereignisse und Lebensumstände im engeren Sinne unter dieser Voraussetzung ihre Besonderheit verlören und Trauma, ähnlich wie Stress, zu einem „Passepartout“ geriete. Allerdings besteht eine „Schnittmenge“ (A–B) zwischen beiden Bereichen, in die z. B. ein übersozialisativer Erziehungsstil sicher dann hineinreicht, wenn rigide Erziehungsnormen mit brutalen körperlichen Strafen durchgesetzt werden.

Abbildung 1: Polyätiologisches Modell psychischer Störungen (Fischer 2000b, 168). Die ätiologischen Einflussgrößen sind durch vier Kreise veranschaulicht, die bilaterale Schnittmengen aufweisen sowie eine Gesamtschnittmenge im Mittelbereich.
Vom Störungsbild her entsteht unter den genannten Bedingungen die klassische neurotische Persönlichkeit mit ausgeprägter Identität, vertikaler Abwehrorganisation, relativ kohärentem Ich-Selbst-System, die an der übermäßigen Verdrängung vitaler Impulse neurotisch erkranken kann. Es wäre zu untersuchen, wieweit die traditionellen Geschlechtsrollenstereotypen neurotogene Faktoren enthalten, möglicherweise unterschiedlich für beide Geschlechter. Die traditionell von Mädchen erwartete Bravheit, Sittsamkeit, altruistische Hilfsbereitschaft und Unterordnung enthält zweifellos pathogene Elemente aus dieser ätiologischen Einflusssphäre.
Biologisch angeboren und biologisch erworben. Erbgenetische Faktoren verbinden sich mit den übrigen ätiologischen Strömungen in unterschiedlicher Weise, beispielsweise im Sinne der von Freud formulierten „Ergänzungsreihe“ zwischen somatischen und psychischen Einflussgrößen. Die geringste Rolle scheint die genetische Disposition bei psychotraumatischen Situationsfaktoren von mittlerem und hohem Schweregrad zu spielen. Neben den genetisch angeborenen Dispositionen rücken erworbene, gleichwohl physiologisch verankerte Dispositionen neuerdings immer deutlicher ins Blickfeld. Dazu gehören einmal die verschiedenen zentralnervösen, neuromuskulären und neurovegetativen Folgen des Traumas, zum anderen in der Kindheit früh erworbene Veränderungen hormoneller und neuroendokriner Regulationssysteme, z. B. eine Dysregulation des Serotoninhaushalts infolge frühkindlicher Deprivation, die für depressive Erkrankungen im Erwachsenenalter disponiert (vgl. Abschnitt 3.4.1). Bei den erworbenen, traumabedingten physiologischen Dispositionen steht die Forschung erst in den Anfängen.
Untersozialisation. Prototyp sind sog. „verwöhnte“ Kinder, die eine „Laisser-faire“-Erziehung und zu geringe oder auch einseitige normative Strukturierung erfahren. Ein Beispiel sind Eltern, die ihren Kindern immer „Recht geben“, wenn es zu Konflikten mit anderen Kindern oder außerfamiliären Personen oder Instanzen kommt, unabhängig vom realen Konfliktanteil der Kinder. So entsteht ein Mangel an Empathie, Normenverständnis und Verständnis für die fundamentale „Wechselseitigkeit“ (vgl. Fischer 1981) sozialer Beziehungen, die den Kern des kommunikativen Realitätsprinzips (Uexküll u. Wesiack 1988) bildet. Parallel entsteht ein Lerndefizit in Bezug auf soziale Fertigkeiten, die einen wechselseitig befriedigenden Umgang mit anderen Kindern oder außerfamiliären Erwachsenen gewährleisten. Kommen weitere negative Bedingungen hinzu, so kann dieses Sozialisationsmuster in eine dissoziale oder antisoziale Karriere münden. Auch bei diesem Sozialisationstyp können psychotraumatische Faktoren hinzutreten. Sie tragen dann zu einer Verschärfung der Verhaltensdefizite und antisozialen Tendenzen bei. Auch eine erbgenetische Disposition wird diskutiert, welche zu Veränderungen in der Verarbeitung von Angst und Bedrohung und einer veränderten „startle-response“ (= angeborene Schreckreaktion auf ungewöhnliche Umgebungsreize) führt (Patrick 1993, Vaidyanathan 2011, Newman 2010). Daraus resultierende Impulsivität und Schwererreichbarkeit durch Erziehungsmaßnahmen, ist beim „harten Kern“ der antisozialen, soziopathischen Persönlichkeit zu berücksichtigen und kann sich im Sinne einer Interaktion zwischen Erbfaktoren und Umwelteinflüssen aufschaukeln.
Es ist nun aufschlussreich, diese 4 ätiopathogenetischen Muster zu therapeutischen Vorgehensweisen in Beziehung zu setzen, die sich in der Geschichte der Psychotherapie „spontan“ herausgebildet haben. Vereinfachend gesagt, hat die Freudsche Psychoanalyse eine besondere Nähe zu Feld B, die Verhaltenstherapie, schon ihrer historischen Entwicklung aus der Pädagogik nach, zu Feld D, Psychopharmakotherapie und körperbezogene Psychotherapie zu Feld C und Traumatherapie zu Feld A. Insofern bietet die Übersicht zugleich Anhaltspunkte für ein an einer differenziellen Ätiopathogenese orientiertes Vorgehen in der Psychotherapie. Wir kommen in Kapitel 4 darauf zurück. An dieser Stelle kann festgehalten werden:
Psychotraumatologie erforscht und behandelt eine ätiologisch relevante und pathogenetisch spezifische Gruppe von Störungsbildern der psychologischen Medizin. Als weitere ätiologische Einflussgrößen für die Entstehung psychischer Störungen sind Über- und Untersozialisation sowie angeborene oder erworbene biologische Dispositionen zu berücksichtigen.
1.2 Seelische und körperliche Verletzungen: Gemeinsamkeiten und Unterschiede
In einer ersten Arbeitsdefinition können wir psychisches Trauma als seelische Verletzung verstehen (von dem griechischen Wort traûma = Wunde, Verletzung). Wie die verschiedenen somatischen Systeme des Menschen in ihrer Widerstandskraft überfordert werden können, so kann auch das seelische System durch punktuelle oder dauerhafte Belastungen in seinen Bewältigungsmöglichkeiten überfordert und schließlich traumatisiert/verletzt werden. Von dem, was geschieht, wenn eine solche Verletzung eingetreten ist, oder was zur Heilung geschehen sollte, davon handelt eine psychologische und psychosomatische Traumatologie als Lehre von Struktur, Verlauf und Behandlungsmöglichkeiten seelischer Verletzungen und ihrer Folgen. Die Analogie zwischen seelischen und körperlichen Verletzungen ist in einigen umgangssprachlichen Wendungen ausgedrückt, wenn wir etwa sagen: „das hat mich sehr verletzt“ oder „getroffen“ usf. Hier werden bildlich/metaphorisch seelische und körperliche Verletzungen miteinander gleichgesetzt. „Etwas macht mich kaputt, zerreißt mich in Stücke“, oder jemand fühlt sich „gekränkt“ sind weitere Beispiele. Die Metaphern verdeutlichen, dass wir seelische Verletzungen sehr stark vom körperlichen Erleben her interpretieren, dass – wie Freud formuliert hat – das Körper-Ich der Kern auch des psychischen Ich, des seelischen Erlebenszentrums ist.
Es gibt eine zweite Gruppe von umgangssprachlichen Wendungen zur Analogie zwischen körperlichen und seelischen Verletzungen, so etwa: „Zeit heilt alle Wunden“. Hier sind die körperlichen und die seelischen Wunden gleichgesetzt. Wir wissen aus dem Umgang mit körperlichen Erkrankungen/Wunden, dass Heilvorgänge Zeit brauchen. Diese Erfahrung wird auf seelische Verletzungen übertragen. Das Gegenteil stimmt aber auch: Zeit allein heilt nicht alle Wunden, weder die körperlichen noch die seelischen. Vielleicht hat der Organismus eigene, übergreifende Selbstheilungsstrategien entwickelt, die für den körperlichen Bereich ebenso gelten wie für den seelischen. Wahrscheinlich müssen wir die seelischen Verletzungen und deren natürliche Wundheilungsmechanismen mit gleicher Aufmerksamkeit studieren wie die körperlichen. Wir lernen dann unterscheiden nach der Art des verletzten seelischen „Gewebes“, verstehen seelische Vorgänge wie Trauerarbeit oder die verschiedenen Abwehr- und Bewältigungsmechanismen als Selbstheilungsversuche des psychischen Systems und können diese Prozesse gezielt unterstützen bzw. Fehlentwicklungen rechtzeitig erkennen und verhindern. Auf die psychische Traumatologie warten Aufgaben, die nicht geringer sind als in der somatischen Traumatologie und Krankheitslehre.
Gibt es psychische Analogien zur Selbstheilungstendenz des Organismus? Wie versucht der Organismus, schädliche psychische Reize, die seine Abwehr durchbrochen haben, zu eliminieren? Grundsätzlich wäre es nicht verwunderlich, wenn sich bestimmte Selbstheilungsstrategien wie etwa die „Sequestrierung“ als Versuch, einen eingedrungenen Fremdkörper einzukapseln und zu eliminieren, auch auf der psycho-physiologischen Ebene wiederfinden ließen. Ist vielleicht der Trauervorgang einem Eliminierungsprozess analog zu verstehen, wie ihn das Eitern einer Wunde darstellt? Wird – wie in einer psychoanalytischen Metapher – ein Introjekt durch Trauerarbeit aus dem psychischen Organismus gleichsam „ausgeschieden“?
Die Beispiele verdeutlichen vielleicht, dass die Analogie zwischen körperlicher und psychischer Traumatologie durchaus fruchtbar sein kann. Wir müssen allerdings auch auf ihre Grenzen aufmerksam werden. Darauf stoßen wir beispielsweise, wenn wir fragen, weshalb die chirurgische Traumatologie ein wissenschaftliches Fach ist, das auf eine mehrtausendjährige Geschichte zurückblickt, während Psychotraumatologie sich immer noch konstituiert. Wir möchten hierfür eine Erklärungshypothese vorschlagen, die an die sinnliche Gegebenheitsweise körperlicher versus seelischer Verletzungen anknüpft: körperliche Verletzungen kann man sehen und anfassen (behandeln), seelische dagegen nicht. Körperliche haben eine physische Repräsentanz, seelische Verletzungen sind unsichtbar – wenn darum auch nicht weniger real und wirksam als die körperlichen Verletzungen und in letzter Zeit durch Bildgebungsverfahren auch physiologisch nachweisbar.
Nun fällt es den Menschen wohl immer schon leichter, sichtbare Phänomene als wirksam einzuschätzen im Vergleich mit unsichtbaren. Möglicherweise ist die Menschheit in ihrer geistesgeschichtlichen Entwicklung noch nicht sehr lange dazu im Stande, auch unsichtbare Größen wissenschaftlich zu erforschen. Piaget (1947) hat in seiner „genetischen Erkenntnistheorie“ gezeigt, dass vor allem der menschliche Egozentrismus verhindert, die eigene psychische Aktivität als solche zu erfassen. Das Kind in den so genannten voroperationalen und frühen operationalen Stadien (bis 7. Lebensjahr etwa) ist auf die Welt der sichtbaren und manipulierbaren Dinge ausgerichtet. Seine Ontologie beschränkt sich auf eine naive Physik. Seelische Phänomene können in dieser Welt nicht erfasst werden. Sichtbar sind die Gegenstände und Handlungen, nicht aber das Sehen selbst. Die Wahrnehmung als solche ist unsichtbar und daher weniger „real“ – für Kinder oder auch für Erwachsene, die auf das konkret-operationale Stadium der kognitiven Entwicklung fixiert sind. Watson, der Begründer des amerikanischen Behaviorismus, hat die Forschungsstrategie propagiert, alle „mentalen“ Begriffe in Verhaltensbegriffe zu überführen. Mit dieser kognitiven Regression hatte der Behaviorismus als herrschende Richtung in der westlichen Psychologie (analog zu der Pawlowschen Variante von „Psychologie“ im Stalinismus) lange Zeit den psychologischen Gegenstand, nämlich das „unsichtbare“ psychische Erlebniszentrum aus der Wissenschaft verbannt. Die seelischen Verletzungen blieben damit ebenfalls unsichtbar. Auch im täglichen Leben begegnen uns viele Menschen, die sich in einem „vorpsychologischen“ Stadium ihrer seelischen Entwicklung befinden. Sie pflegen manchmal heftige Vorurteile gegen die „Psychologie“. Diese sei keine Wissenschaft und könne auch keine werden, da ihr Gegenstand „nicht greifbar“ sei.
Das naive „Alltagsbewusstsein“ ist zumeist auf die Gegenstände der äußeren Wahrnehmung gerichtet und nicht auf seine eigene Tätigkeit des Wahrnehmens, Beurteilens und Denkens selbst. Die Einsicht in die Realität seelischer Verletzungen setzt jedoch die Einsicht in die Realität seelischer Vorgänge, Prozesse und Strukturen voraus. Zu dieser Erkenntnis gelangen wir, wenn wir uns fragen, was ist eigentlich „realer“, der Gegenstand des Denkens oder das Denken selbst? Oder, um ein anderes Thema der allgemeinen Psychologie anzusprechen: was ist „realer“, die Wahrnehmung oder der Wahrnehmungsgegenstand? Hier wird deutlich, dass beides gar nicht voneinander getrennt werden kann. Die Wahrnehmung ist ohne den Wahrnehmungsgegenstand nicht denkbar, aber auch umgekehrt setzt jeder Wahrnehmungsgegenstand als solcher ein Subjekt voraus, das den Wahrnehmungsakt ausführt. Der subjektive Faktor, die Konstitution des Wahrnehmungsgegenstandes im Akt der Wahrnehmung ist aber häufig demjenigen unzugänglich, der in einer „naiv“ empirischen, alltäglichen Einstellung auf die Gegenstände seiner Wahrnehmung und Handlungen ausgerichtet ist und dabei sich als den Handelnden und Wahrnehmenden vergisst.
Diese reibungslose Ausrichtung auf Gegenstände und alltägliche Geschäfte wird nun durch seelische Verletzungen gefährdet. Eine Abwehrstrategie psychischer Traumatisierung besteht im Ignorieren und einer besonders intensiven Zuwendung zu den äußeren Geschäften des Alltagslebens. Das verletzte psychische System/die psychisch verletzte Persönlichkeit sucht die Verletzung nach Möglichkeit auszublenden und betreibt „business as usual“. Dieser Umgang mit psychischen Verletzungen und Kränkungen findet sich bei vielen traumatisierten Persönlichkeiten. Er scheint aber auch charakteristisch zu sein für den Umgang in der täglichen Lebenswelt mit dem Problem seelischer Verletzungen und spiegelt sich in einem „vulgärmaterialistischen“ Wissenschaftsverständnis ebenso wider wie im methodologischen Behaviorismus, einer Forschungsstrategie, die von Erlebnisphänomenen grundsätzlich absehen zu können glaubt. Das psychische Erlebniszentrum als Zentrum zugleich der seelischen Schmerzempfindung wird für unerkennbar, zur „black box“, erklärt. So beruhen auch manche Konzepte der in sich ja sehr heterogenen „wissenschaftlichen Gemeinschaft“ auf Abwehrvorgängen gegen seelische Verletzungen und bedienen sich dabei ähnlicher Abwehrstrategien, wie verletzte Individuen, die sich reflexhaft vor der Wahrnehmung seelischer Schmerzen schützen.