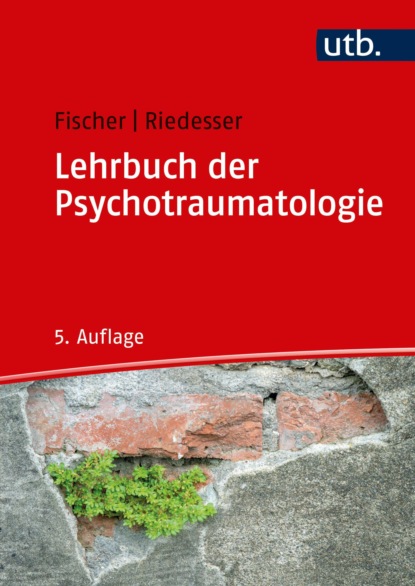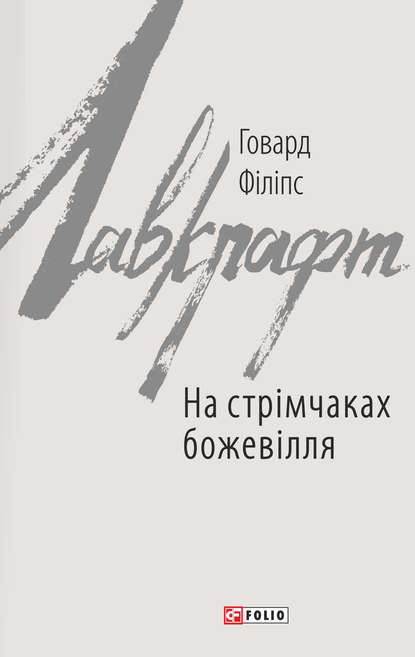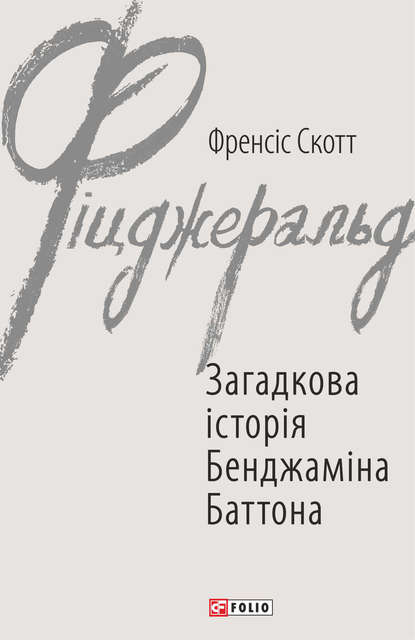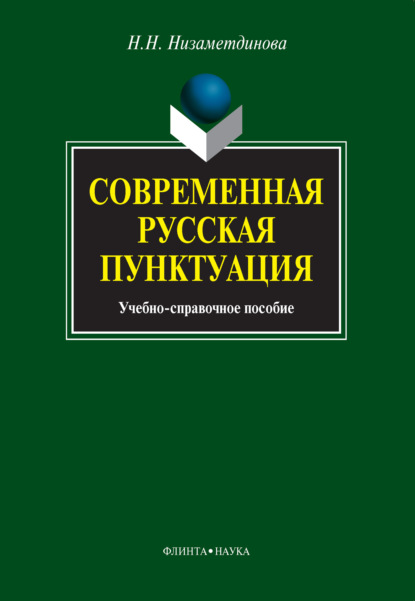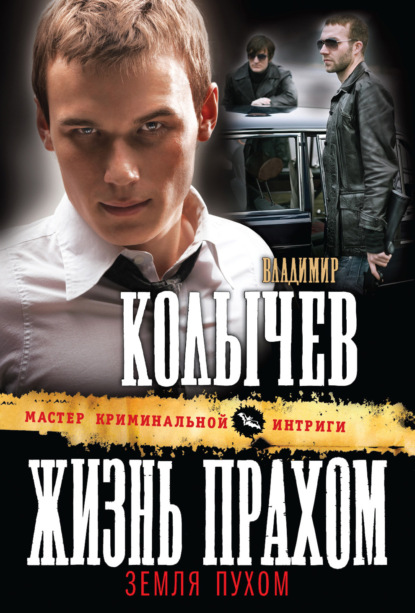- -
- 100%
- +
„Unsichtbarkeit“ des Gegenstandes und reflektorische Abwehr erschweren manchen Menschen den Zugang zur Psychotraumatologie als einer Wissenschaft, die speziell die Verletzlichkeit psychologischer und psychosozialer Systeme untersucht. Psychotraumatologie muss aber vor allem gewisse Eigenheiten des seelischen Systems berücksichtigen, die sich auf der Ebene der physikalischen und biologischen Systeme im engeren Sinne noch nicht antreffen lassen. Solche Eigenheiten lassen sich beschreiben mit dem Begriff einer Regel bzw. Norm, die über verschiedene ontologische Ebenen hinweg, von der physiko-chemischen über die biologische bis hin zur psychosozialen, bestimmte Besonderheiten annimmt. Dies wird deutlich, wenn wir als das Gegenstück zu Norm den Begriff des Abnormalen oder Krankhaften verwenden. Krankheit lässt sich als Abweichung definieren von einer Regel oder Norm, die ihrerseits wiederum das gesunde oder normale Funktionieren des Organismus bzw. des Individuums festlegt. Nun deckt dieser Begriff der Regel oder Norm sehr unterschiedliche Phänomene ab, je nachdem wie wir ihn definieren und auf welchen ontologischen Bereich wir ihn anwenden. Tabelle 1 gibt eine Übersicht über Typen von Normen und ordnet sie verschiedenen ontologischen Ebenen zu.
Tabelle 1: Normen und Ebenen der Wirklichkeit

Die einzelnen Elemente von Tabelle 1 wollen wir schrittweise erörtern. Zunächst zur Norm. Dabei unterscheiden wir drei unterschiedliche Normbegriffe: 1. die funktionelle Norm; 2. die statistische Norm; 3. die Idealnorm. Diese Unterscheidung ist in psychosozialen Fächern, wie der medizinischen oder klinischen Psychologie, weitgehend geläufig. Funktionelle oder strukturelle Normen vergleichen einen Ist-Zustand mit einem vorgegebenen Sollwert. Hierzu gehören z. B. die Blutdruckregulierung und viele andere Normwerte der körperlich-biologischen Selbstregulierung. Bei Abweichung von diesen Normwerten, bei einem Blutdruck über 140 zu 90 (systolisch vs. diastolisch), liegt ein Verdacht auf Hypertonie nahe, auf passager oder chronisch erhöhten Blutdruck. Dieser Wert kann ein Alarmsignal sein, das ein Eingreifen verlangt.
Die meisten funktionalen Normen der biologischen Regulationsebene weisen größere interindividuelle Schwankungen auf innerhalb einer noch als „physiologisch“ zu bezeichnenden Schwankungsbreite. Funktionelle Normen beruhen im subatomaren Bereich auf statistischen Normen (2). Die funktionelle Norm setzt aber der statistischen Schwankungsbreite klare Grenzen. Eine Abweichung von diesen Grenzwerten ist dann potenziell pathologisch.
Die Idealnorm (3) dagegen entspricht einer idealen Setzung, die weniger im biologischen und physikalischen, als vielmehr im psychosozialen Phänomenbereich anzutreffen ist. Ein Beispiel dafür sind Normen, Ziele und Verhaltensregeln, die eine Gesellschaft oder soziale Gruppe für ihre Mitglieder definiert bzw. die – handlungstheoretisch betrachtet – sich die Gesellschaftsmitglieder selbst auferlegen. Solche Normen können mehr oder weniger variabel sein. Es gibt ethische Normen, die man gleichsam zur „hardware“ gesellschaftlicher Systeme zählen muss. Man könnte sie als die „funktionale“ Norm einer Gesellschaft bezeichnen. So etwa die „goldene“ ethische Regel: „Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu“. Auch Kants kategorischer Imperativ stellt eine Variation dieser Regel dar. Die „funktionalen“ Normen der Gesellschaft sind aber – im Gegensatz zu den biologischen – nicht im genetischen Code verankert, sondern existieren in der Idee einer gerechten Gesellschaftsordnung als ideale Setzung und müssen auf dieser Ebene verwirklicht werden. Andere Vorschriften einer „idealen Norm“ erscheinen als mehr oder weniger willkürliche Setzungen und sind historisch und interkulturell variabel. Ein Beispiel ist der Umgang mit Homosexualität in der abendländischen Geschichte und in unterschiedlichen Kulturen. Während homosexuelle Beziehungen im griechischen Altertum unter gewissen Bedingungen als sozial wertvoll geschätzt wurden, wurde diese Form der Erotik später immer stärker diskriminiert bis hin zur Ermordung zahlreicher Homosexueller durch die Nazis.
Da Idealnormen kulturgebunden sind, kann eine interessante Wechselwirkung mit statistischen Normen entstehen, die sich am Beispiel des Kinsey-Reports zum Sexualverhalten der Nordamerikaner zeigen lässt. Als Kinsey (der übrigens von Haus aus Bienenforscher war) seine Befragung in den USA durchführte, waren in vielen nordamerikanischen Staaten sexuelle Verhaltensweisen, nach denen Kinsey fragte, im Sinne einer „idealen“ normativen Setzung mit strafrechtlichen Sanktionen belegt. Oral-genitale Kontakte (Cunnilingus und Fellatio) wurden in einigen Staaten mit Zuchthaus geahndet. Kinsey fand heraus, dass die überwiegende Mehrheit der Erwachsenen solche Liebestechniken pflegte. Als in der Öffentlichkeit deutlich wurde, dass eine Bevölkerungsmehrheit demnach Zuchthausstrafen verdient hatte, wurden nun umgekehrt rechtliche Bestimmungen, die aus der unreflektierten Übernahme sexualfeindlicher religiöser Normen in das politische System eingegangen waren, mehr und mehr in Frage gestellt. Ideologen des jeweils herrschenden Gesellschaftssystems sind bemüht, ihre Interessen oder magischen Vorstellungen ihre „Idealnormen“ als unveränderliches „Naturgesetz“ hinzustellen und deren Anpassung an reale gesellschaftliche Lebensbedürfnisse zu verhindern.
Bezüglich der verschiedenen Normtypen können wir festhalten: In den funktionellen oder strukturellen Normen wird ein Ist-Zustand verglichen mit einem vorgegebenen Soll-Wert. In der statistischen Norm wird der Ist-Zustand relativ zu einem Messwert bestimmt, zumeist in Abweichungseinheiten vom Mittelwert einer statistischen Verteilung. In dieser Verteilung von Messwerten müssen aber keineswegs Naturgesetze oder funktionale Normwerte zum Ausdruck kommen, ebenso gut können Zufallsphänomene oder gesellschaftliche Setzungen der beobachteten Verteilung zugrunde liegen. Bei der Idealnorm wird der Ist-Zustand verglichen mit einem gewählten Soll-Wert. Hierbei können Vorurteile oder auch rational begründete Idealvorstellungen wirksam sein. Ordnen wir die Normtypen unterschiedlichen Wirklichkeitsebenen zu, wie dies in Tabelle 1, Abschnitt B geschieht, so gelten auf der physiko-chemischen Ebene die so genannten „Naturgesetze“ und entsprechend vor allem die Normen 1 und 2, die funktionelle und statistische Norm jeweils mit vorgegebenem Sollwert. Auf der biologischen Ebene gelten ebenfalls die Normen vom Typ 1 und 2; es kommen jedoch selbstregulative Systemeigenschaften bei vorgegebenem Sollwert hinzu, die sich auf der physiko-chemischen Ebene 1 noch nicht finden. Und schließlich tritt auf der psychosozialen Ebene zu den übrigen noch Regeltyp 3 hinzu, die Fähigkeit zur individuellen oder gesellschaftlichen Setzung von Sollwerten.
Das Verhältnis der Wirklichkeitsebenen zueinander kann nun aufgefasst werden im Sinne der Emergenz (= Auftauchen) neuer Systemqualitäten oder der Supervenienz (= Überlagerung) der nächstniederen durch Systemeigenschaften der nächsthöheren Wirklichkeitsebene. Emergenz betont stärker die Diskontinuität im Übergang zwischen den Ebenen, das Supervenienzkonzept eher die Kontinuität im Wandel. Sucht man z. B. im Sozialverhalten von Tieren nach Vorläufern menschlicher Verhaltensnormen, so trifft man auf eine breite Palette strukturell paralleler angeborener und auch erlernter Verhaltensweisen. Durch die Fähigkeit des Menschen, in Gruppenentscheidungen oder Gesetzgebungsverfahren bewusst überlegte Regeln zu setzen, gewinnen jedoch auch die angeborenen sozialen Verhaltensweisen beim Menschen eine neue Systemqualität. Sie können zu deren gestaltbildenden Prinzipien beispielsweise in Widerspruch treten und dadurch konflikthafte Verhältnisse schaffen, die auf der biologischen Ebene noch nicht möglich waren. Ein Bewertungskriterium stellt die mehr oder weniger gelungene Integration der Ebenen dar. Es gelten auf den höheren immer auch die Regeln und Gesetzmäßigkeiten aller niedrigeren Ebenen. Diese werden jedoch in die neue Systemqualität einbezogen, in ihrer bisherigen Geltung relativiert und können mit dem neuen system- oder „gestaltbildenden“ Prinzip (im Sinne der Gestalttheorie) in ein integratives bzw. mehr oder weniger widersprüchliches Verhältnis treten.
Da der Mensch die Fähigkeit zu einer Wahl von „Sollwerten“ besitzt, entstehen auf der psychosozialen Ebene zwei Varianten von funktionellem Fehlverhalten: die Dysfunktionalität von Mitteln gegenüber gesetzten Zielen und die Dysfunktionalität oder Irrationalität von Zielsetzungen selbst. Im neurotischen → Wiederholungszwang beispielsweise werden oft wohlbegründete und wertvolle Ziele verfolgt, jedoch mit Mitteln und Verhaltensweisen, die systematisch das Gegenteil des bewusst Intendierten bewirken. Auf der anderen Seite gibt es die zweckrationale Verwirklichung noch der irrationalsten Zielsetzungen wie beispielsweise die perfekte Organisation des Holocaust und anderer Genozide. Irrationale Zielsetzungen können in Motiven begründet sein wie bei antisozialem Verhalten und manchen Perversionen, die sich der bewussten Selbstwahrnehmung der Persönlichkeit entziehen. Mit der Zunahme von Möglichkeiten der Handlungsplanung und Entscheidungsfreiheit beim Menschen entsteht zugleich ein neuartiges Spektrum seelischer Störungen und Verletzbarkeiten.
Tabelle 1 beruht auf einer Zuordnungsregel zwischen Normen und Wirklichkeitsebenen, die gewissermaßen von „oben“ nach „unten“ gelesen werden muss. Naturwissenschaftlicher → Reduktionismus (Annahme C) verstößt gegen diese Zuordnungsregel und besteht in der Annahme, dass sich die Systemebenen 3 bzw. 2 ohne Informationsverlust auf die Ebenen 2 bzw. 1 zurückführen oder reduzieren lassen. Ein solcher epistemiologischer Reduktionismus folgt der verbreiteten Tendenz zur Reduktion komplexer Fragestellungen. Eine Form davon ist der sog. „Vulgärmaterialismus“, die Annahme, dass unsere psychische Informationsverarbeitung identisch sei mit den physiko-chemischen Prozessen der Gehirnfunktion (Reduktion von Psychologie auf Physiologie, Biochemie und Biophysik).
Wir wollen jetzt diese Überlegungen zum Aufbau der Wirklichkeit und zur Eigenart jener Regeln, welche die unterschiedlichen Wirklichkeitsebenen beherrschen, kritisch auf die früher erwähnte Analogie von körperlichen und seelischen Verletzungen anwenden. Betrachten wir seelische Verletzungen ausschließlich oder vorwiegend analog zu körperlichen, so entspricht dies einer Kurzführung oder – bild-lich gesprochen – einem „Kurzschluss“ zwischen den Ebenen 3 und 2. Damit würden wir die Eigengesetzlichkeit der Ebene 3 verfehlen. Der Gesichtspunkt andererseits, der Emergenz oder Supervenienz bzw. der einer dialektischen „Integration“ der niedrigen in die höhere Systemebene, berechtigt uns dazu, der Analogie zwischen somatischen und psychischen Verletzungen eine relative Berechtigung zuzuschreiben. Wollen wir allerdings der spezifisch menschlichen Qualität von Verletzbarkeit, der → Psychotraumatologie im engeren Sinne, Rechnung tragen, so müssen wir das spezifisch menschliche Welt- und Selbstverhältnis zentral in unsere Überlegungen einbeziehen. Definitionen und Konzepte, die dieses leisten, sind in der Psychotraumatologie den „organologischen“, körperbezogenen Analogien und Metaphern, so wertvoll diese als Verständnisbrücken auch sein mögen, vorzuziehen. Wir müssen beispielsweise berücksichtigen, dass die Verletzung der menschlichen Fähigkeit zur Selbstbestimmung – ein Konzept der „psychosozialen Ebene“ (3) – eine spezifische traumatische Erlebnisqualität besitzt, die wir auf Ebene 2 möglicherweise noch nicht in gleicher Form antreffen. Eine Frau, die Opfer einer Vergewaltigung wurde, wird nicht nur in den Bereichen der biologischen Selbstregulierung gestört und verletzt, sondern auch und vor allem in ihrem Recht auf und ihrer Fähigkeit zu sexueller Selbstbestimmung. Eine nicht-reduktionistische Definition von Trauma muss daher dem Entfaltungsspielraum der menschlichen Individualität und der menschlichen Fähigkeit zur sozialen Setzung, Einhaltung, aber auch Überschreitung normativer Regelungen Rechnung tragen. Traumatische Ereignisse und Erfahrungen führen beim Menschen zu einer nachhaltigen Erschütterung seines Welt- und Selbstverständnisses (→ Trauma). Die Reorganisation und Restitution von Selbst- und Weltverständnis ist wesentlicher Bestandteil der spezifisch menschlichen Traumaverarbeitung. Dieser Prozess folgt Gesetzmäßigkeiten, die sich bei Tieren nicht identisch beobachten lassen, obgleich traumatogene Situationen im Tiermodell in erstaunlicher Weise den menschlichen gleichen (s. Kap.3.1.2, Situationstypologie im Tierversuch). Organische Metaphern, die nicht in einem Mehr-Ebenen-Modell zugleich auch relativiert werden, besitzen oft eine Pseudoplausibilität und können nähere Verständnisbemühungen vorzeitig abblocken. Fortschritte der Psychotraumatologie sind insbesondere vom Bemühen zu erwarten, die menschliche Perzeption, Beantwortung und Verarbeitung traumatischer Situationen in ihren kognitiven, emotionalen und motivationalen Aspekten immer genauer zu verstehen.

Erklärung: Doppelpfeil für Übersetzungsprozesse, einfacher Pfeil für Aufwärts- bzw. Abwärtseffekte. Weitere Erläuterungen im Text.
Abbildung 2: Das Modell der Systemhierarchie
Neben der begrenzten Geltung somatischer Metaphern muss die Psychotraumatologie so genannte „Mehr-Ebenen-Effekte“ berücksichtigen, die sich über die physiko-chemische, biologische und psychosoziale Ebene hinweg fortpflanzen, und zwar in beide Richtungen. Thure von Uexküll und Paul Wesiack sprechen in ihrer Arbeit zur „Theorie der Humanmedizin“ (1988) von Aufwärts- und Abwärtseffekten. Abbildung 2 zeigt das Modell der Systemebenen nach Thure von Uexküll (1988, 171, modifiziert von uns).
Ein psychosoziales Trauma, etwa ein → Beziehungstrauma, kann physiologische Regelkreise einbeziehen und einen dauerhaften Überlastungszustand dieser Systemebene unter Einschluss biochemischer und biophysikalischer Subsysteme nach sich ziehen. Umgekehrt können sich in traumatischen Überlastungssituationen und im Anschluss daran die Funktionsbedingungen von ZNS und autonomem Nervensystem derart verändern, dass es relativ unabhängig vom im engeren Sinne psychischen Prozess der Traumaverarbeitung zu einem „Kurzschluss“ zwischen den Ebenen 1, 2 und 3 kommt: die physiologische Reaktionsebene wird von der psychischen weitgehend abgekoppelt. In diesem Sinne sprach schon Abraham Kardiner (1941) von der traumatischen Neurose als einer „Physioneurose“ (im Unterschied zu den sog. Psychoneurosen).
Eine interessante Hypothese ist, dass extreme traumatische Belastungssituationen regelmäßig einen solchen „Kurzschlusseffekt“ ausüben, indem sie die Ebenen des ontologischen Stufenmodells in pathologischer Weise zusammenführen. Die Folge ist, dass Naturgesetze und funktionale Normen, die normalerweise nur auf den Ebenen 1 und 2 Geltung haben, nun plötzlich auch die psychosoziale Ebene regieren. Das Trauma kann eine künstliche „Physiologisierung“ der psychosozialen Systemebene bewirken. Die Fähigkeit zur freien Bestimmung von Sollwerten und Handlungszielen wird dann tendenziell außer Kraft gesetzt. Im engeren, vom Trauma bestimmten und verzerrten Persönlichkeitsbereich folgt das Individuum funktionellen bzw. statistischen Normen und wird durch die traumatische Reizkonstellation so vollständig beherrscht, wie es das Reiz-Reaktions-Schema im klassischen → Behaviorismus vorsieht. Dies insbesondere in Erlebens- und Verhaltensbereichen, die vom → Wiederholungszwang betroffen sind und Tendenzen der → Traumatophilie unterliegen. Die Erklärung kann hier aber immer nur eine quasi-physiologische sein. Auch hier setzt die umfassende Erklärung an bei der traumabedingten Modifikation von Qualitäten der psychosozialen Systemebene. Die Möglichkeit, Handlungsziele und Werte innerhalb des von den Ebenen 1 und 2 freigelassenen „Spielraums“ unseres Verhaltens (Waldenfels 1980) zu entwerfen und diese mit adäquaten Mitteln zu verwirklichen ist (partiell) verloren. Traumatisch gebrochene Orientierungs- und Verhaltensschemata sind häufig durch eine veränderte Zielorientierung bestimmt, in der Sphäre der Mittel zur Zielverwirklichung wie auch der gesetzten Ziele selbst (vgl. die beiden Typen von „Dysfunktionalität“ in Tabelle 1, Abschnitt B3). Sie erwecken den Anschein rein „biologisch“ gesteuerter Abläufe und könnten dem biologischen Reduktionismus Vorschub leisten. Unser Mehr-Ebenen-Modell kann aber verdeutlichen, dass der biologische Determinismus keine primäre Gegebenheit ist, sondern sich dem traumatischen Verlust selbstregulativer Eigenschaften der psychosozialen Ebene verdankt.
Aus den Überlegungen dieses Abschnitts folgt für die Psychotraumatologie, dass sie mit Begriffen arbeiten muss, die der psychosozialen Ebene und ihrer Verletzlichkeit in besonderer Weise angemessen sind. Wir werden dafür später einige Konzepte vorschlagen wie „Traumaschema“, „traumakompensatorisches Schema“ oder „Desillusionierungsschema“, um die Desorientierung und die Versuche zur Reorientierung zu analysieren, die traumatische Erfahrungen in der Regel auslösen. Organische Metaphern und parallel zu ihnen die Ansätze biologischer Traumaforschung zeigen die verletzten funktionalen Normen der biologischen Wirklichkeitsebene auf und sind insofern für die Traumaforschung unentbehrlich. Als Rahmenkonzepte hingegen eignen sie sich nicht. Letztere müssen der psychosozialen Ebene entstammen und deren Eigenheiten zum Ausdruck bringen. Andernfalls würde Psychotraumatologie auf (somatische) Traumatologie reduziert und es ergäbe sich eine weitere Variante des naturwissenschaftlichen Reduktionismus. Psychotraumatologie verlangt, seelische Verletzungen des Menschen bis in seine Biosphäre hinein zu verfolgen und die Erscheinungen des Traumas auch aus der Verletzung der dort geltenden Regelsysteme zu erklären. Als Psycho-Traumatologie erhält die Traumaforschung jedoch den umfassenderen Bezug zum Welt- und Selbstverhältnis des Menschen aufrecht und thematisiert damit zugleich die spezifisch menschliche Form von Verletzlichkeit.
1.3 Zur Geschichte der Psychotraumatologie
Seelische Verletzungen als Folge von Katastrophen, Verlusten und Kränkungen sind so spektakuläre Erscheinungen, dass sie der Aufmerksamkeit der Menschen zu keiner Zeit entgangen sein dürften. Die „natural history“, gewissermaßen die „Naturgeschichte“ der Psychotraumatologie enthält zahlreiche Belege, dass die Menschen seit frühester Zeit über Kenntnisse und Praktiken zur Milderung traumatischer Erfahrungen verfügten. Wilson (1989) beschreibt Rituale verschiedener Völker, die diesen Zweck erfüllen sollen. Zu unterscheiden von dieser naturwüchsigen Geschichte der Psychotraumatologie ist die Geschichte der modernen Wissenschaft und ihrer Beiträge zur Begründung explizit traumatologischer Konzepte psychologischer oder psychosomatischer Art. In die „natural history“-Forschung fallen folgende Fragen: Wie sind die Menschen in ihrer Geschichte und im interkulturellen Vergleich mit psychischer Traumatisierung umgegangen? Wie haben sie das Phänomen und die Folgen zu beschreiben versucht und welche natürlichen, „intuitiven“ Maßnahmen haben sie gegen Traumata entwickelt? Die wissenschaftlichen Ansätze unterscheiden sich von diesen intuitiven Versuchen durch bewusste Reflexion, Klassifikationsversuche und systematische Forschung. Weder die natürliche Geschichte der Psychotraumatologie noch ihre wissenschaftliche aber sind allein aus sich heraus zu verstehen. Sie müssen vielmehr untersucht werden im Zusammenhang mit erschütternden Ereignissen in der Sozialgeschichte.
Verschiedene wissenschaftliche Konzepte zur Erklärung und Heilung psychischer Traumata sind bei historischen Anlässen entstanden. Das Konzept der „traumatischen Neurose“ wurde im 19. Jahrhundert entwickelt und im 1. Weltkrieg ausgebaut, als die Psychiatrie mit den Opfern von Kriegsneurosen konfrontiert war. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit psychischer Traumatisierung wurde nach dem 2. Weltkrieg durch Überlebende des Holocaust angeregt. In den Entschädigungsverhandlungen vertraten vor allem deutsche Psychiater die These, KZ-Folgeschäden seien maßgeblich auf die erbliche Veranlagung der Betroffenen zurückzuführen. Pross (1995) hat dieses unrühmliche Kapitel der deutschen Nachkriegspsychiatrie unter dem Titel „die Verfolgung der Verfolgten“ medizingeschichtlich aufgearbeitet. Die unsinnige Argumentation hat in der Folgezeit jedoch zu verstärkten Forschungsbemühungen geführt, die unsere Kenntnis der Traumafolgen allmählich auf ein wissenschaftliches Fundament stellen.
Ein weiteres historisches Ereignis, das zur Entwicklung der Psychotraumatologie beitrug, war der Vietnamkrieg. Viele Kriegsveteranen entwickelten psychopathologische Auffälligkeiten. Sie mussten in eigenen Anlaufstellen und „veteran-centers“ betreut werden. Aus der Arbeit der Psychologen, Ärzte, Sozialarbeiter und Pädagogen mit dieser Klientel erwuchs allmählich ein immer detaillierteres Wissen über den Zusammenhang zwischen Kriegssituation und Verarbeitung traumatischer Erlebnisse, das u. a. zur Formulierung des sog. „posttraumatischen Stresssyndroms“ (Posttraumatic Stress Disorder, PTSD) geführt hat. Auch Naturkatastrophen haben die Traumaforschung verstärkt, wie etwa die Flutkatastrophe bei Buffalo Creek in West-Virginia im Jahre 1972. Aus der ersten Hilflosigkeit gingen intensive Forschungsarbeit und therapeutische Bemühungen um die Opfer hervor.
Neben Naturkatastrophen und Kriegen sind als Anstoß für die psychotraumatische Forschungsarbeit auch soziale Bewegungen zu nennen, vor allem solche, die sich gegen Unterdrückung und Ausbeutung wenden. Die Arbeiterbewegung und andere emanzipatorische Strömungen haben ausbeuterische Arbeitsverhältnisse angeprangert, zur Humanisierung der Arbeit beigetragen und zusammen mit den geistigen Kräften der Aufklärung die Abschaffung der Kinderarbeit in Europa erreicht. Seit der Französischen Revolution wurde die Folter in aller Welt geächtet. Die Frauenbewegung hat immer wieder verdeckte Gewaltverhältnisse gegen Frauen und Kinder an die Öffentlichkeit gebracht. Initiativen gegen Kindesmisshandlung und sexuellen Kindesmissbrauch sowie allgemein gegen Unterdrückung und Benachteiligung von Kindern sind zu erwähnen, ferner Befreiungsbewegungen sozial unterdrückter Minderheiten und Völker oder Initiativgruppen, die sich mit diesen Befreiungskämpfen solidarisierten. Im Folgenden wenden wir uns zunächst der „natural history“ zu und kehren dann zur wissenschaftlichen Traumadiskussion zurück.
1.3.1 Naturgeschichte der Psychotraumatologie
Um diese Geschichte zu schreiben, müssen wir uns vor allem mit den kulturellen Erfindungen der Menschheit befassen. Manche Rituale, Sitten und Gebräuche entstammen der Not, mit psychischer Traumatisierung zurechtzukommen. Trauerrituale, die in allen Zeiten und bei allen Völkern verbreitet sind, können hier als Beispiel gelten. Mythen, Religionen, später auch Literatur und Philosophie sind voll von Auseinandersetzung mit Leiden und Tod und dem Eindruck, der Prägewirkung, den diese bei den betroffenen Menschen hinterlässt (→ Todesprägung). Letztlich sind die Menschen in ihren kulturellen Schöpfungen bemüht, eine Antwort zu finden auf die Sinnfrage, welche Leiden, Tod, soziale Gewalt und Naturkatastrophen aufwerfen. Vor allem vom Umgang der Dichterinnen und Dichter mit diesen Problemen kann eine wissenschaftliche Psychotraumatologie lernen. Dichter haben immer wieder traumatisierende Lebensumstände beschrieben und Möglichkeiten der Betroffenen, in ihnen zu überleben. Oft hatte die Darstellung aufrüttelnde und sozial verändernde Auswirkungen. Ein Beispiel ist der Roman „Oliver Twist“ von Charles Dickens. Darin wird einmal die psychische Situation eines Jungen beschrieben, der seine Eltern verloren hat. Sozialkritisch wird zudem dargestellt, wie soziale Einrichtungen, die diese schwere Lebenslage mildern sollen, zusätzlich noch zur Erniedrigung und Traumatisierung der Betroffenen beitragen können. Viele Märchen handeln vom Umgang mit Traumen und von Möglichkeiten ihrer schrittweisen Überwindung (vgl. etwa die Untersuchung von „Prinz Eisenherz“ bei Holderegger 1993)
Ein anderer Zugang zur Kulturpsychologie des Traumas besteht darin, das Lebenswerk kreativer Künstler, von Dichtern und Schriftstellern etwa, auf die Traumabewältigung hin zu untersuchen, die in ihrer literarischen Schöpfung zum Ausdruck kommt. Der Philosoph und Schriftsteller Jean-Paul Sartre beispielsweise hatte um das erste Lebensjahr ein schweres → Deprivationstrauma erlitten, dessen Auswirkung sich bis in seine berühmte Autobiographie „les mots“ (1965) und die Entwürfe seiner Philosophie aufzeigen lässt (Fischer 1992). Wie viele andere Künstler ist Sartre ein Beispiel für kreative Traumabewältigung. Solche Beispiele werfen ein Licht auf die soziale Funktion von Kunst und Philosophie, deren Beitrag zu einem kreativen und kulturell tradierbaren Umgang mit Traumatisierung von den Kulturwissenschaften gerade erst entdeckt wird. Aus der psychoanalytischen Literaturwissenschaft kann die Methode des „traumaanalogen Verstehens“ von Vietighoff-Scheel (1991) erwähnt werden. An Texten von Kafka zeigt die Autorin in sehr subtiler Weise Mechanismen literarischer Traumadarstellung und -verarbeitung auf. Eine Übersicht über psychoanalytische Beiträge zur Literaturtheorie und -forschung bietet das Kompendium von Pfeifer (1989). Psychologisch-historische Forschungsansätze wie etwa die „Geschichte der Kindheit“ von DeMause (1977) haben unser historisch vergleichendes und systematisches Wissen über traumatische Lebensbedingungen in der Kindheit sehr erweitert.