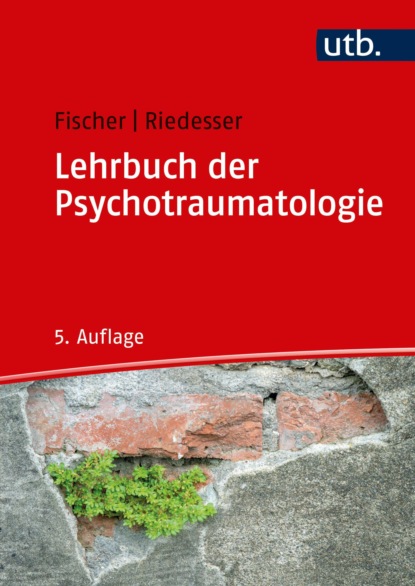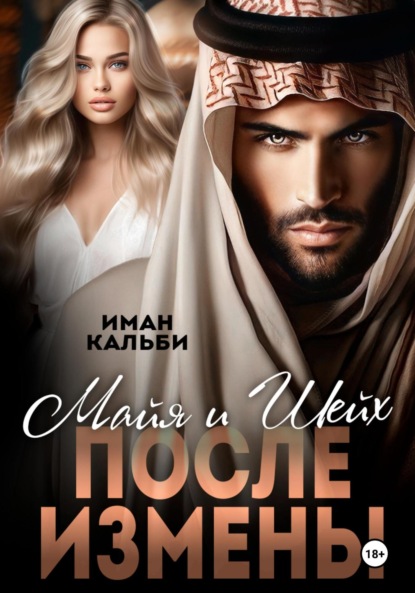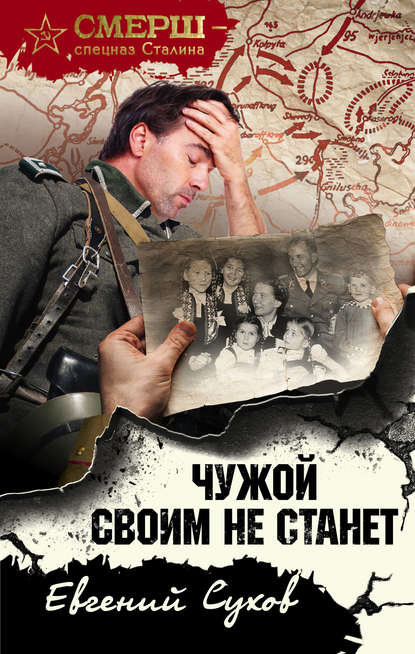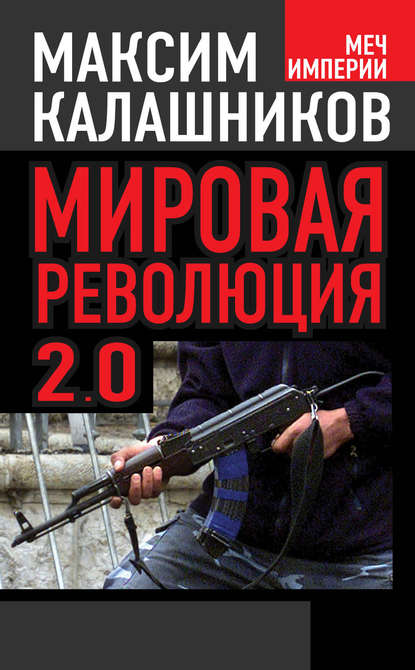- -
- 100%
- +
An der „Ilias“, einem Kriegsbericht aus dem europäischen Altertum lässt sich zeigen, dass Homer, der „Geschichtsschreiber“ und Dichter, traumatische Reaktionen eindringlich zu schildern verstand. Shay (1991) macht darauf aufmerksam, dass die Ilias ein Kriegstrauma detailliert beschreibt und auch Wege zu seiner Überwindung aufzeigt. Der bedeutendste Held der Griechen, Achilles, entwickelt im Kampf vor Troja psychotraumatische Symptome, die recht genau denen, die wir heute kennen, entsprechen.
Shay nennt folgende Merkmale dieser besonderen Form von Kriegstraumatisierung: ein Erlebnis von Verrat oder ein Verstoß gegen das, was der Soldat als sein gutes Recht betrachtet; enttäuschter Rückzug auf einen kleinen Kreis von Freunden und Kameraden; Trauer- und Schuldgefühle wegen des Todes eines besonders befreundeten Kameraden; Lust auf Vergeltung; nicht mehr heimkehren wollen; sich wie tot fühlen; dann eine berserkerartige Raserei mit Entehrung des Feindes und extremen Grausamkeiten. Einzelne Symptome oder auch das gesamte Syndrom finden sich gehäuft in den Berichten von Kriegsteilnehmern, die nach ihrem Einsatz ein psychotraumatisches Belastungssyndrom entwickeln.
Achilles gerät mit dem Heerführer der Griechen, Agamemnon, in Streit, nachdem ihm dieser seine Lieblingssklavin Briseis genommen hatte, welche Achilles für besondere Tapferkeit als Beute zugesprochen worden war. Achilles zieht sich schmollend zurück und pflegt eine intensive Freundschaft mit Patroklos. Als dann die Griechen von den Trojanern immer stärker in die Defensive gedrängt werden, bittet Agamemnon den Achilles als den tapfersten und bewährtesten Krieger, seinen Rückzug aufzugeben, in die Schlacht einzugreifen und das griechische Heer zu retten. Achilles weigert sich und lässt statt dessen seinen Freund Patroklos kämpfen. Diesem gelingt es, die Trojaner zurückzuschlagen. Schließlich wird Patroklos jedoch von Hektor, dem tapfersten Kriegshelden der Trojaner getötet.
Als Achilles die Botschaft von Patroklos̓ Tod überbracht wird, verfällt er in einen affektiven Ausnahmezustand mit extremen Schuldgefühlen, Selbstvorwürfen und heftiger Trauer, den Homer folgendermaßen beschreibt:
„Patroklos liegt nun tot und sie kämpften bereits um den Leichnam. Nackt wie er ist; denn die Waffen besitzt der geschmeidige Hektor. Sprach̓s (der Bote) und jenen (Achilles) umfing die finstere Wolke der Trauer. Gleich mit den beiden Händen den Staub, den geschwärzten ergreifend, überstreut er den Kopf und entstellt er sein liebliches Antlitz. Asche haftete rings am Nektar duftenden Kleide. Selbst aber lag er groß, lang niedergestreckt in dem Staube, raufte sein Haar und beschmutzt̓ es sogleich mit den eigenen Händen“ (Homer, Illias, 18. Gesang, Vers 20, Übers. Hans Rupe: 1990, 387).
Seiner Mutter Tetis, die ihn trösten will, schwört Achilles, nicht eher aus dem Kriege zurückzukehren, bis er den Tod seines Freundes Patroklos an Hektor gerächt habe. Er verfällt darauf in eine raptusartige, berserkerhafte Raserei, worin er alle Rücksichten vergisst und viele Trojaner tötet, schließlich auch Hektor, den Mörder seines Freundes.
Shay beschreibt diesen berserkerhaften Ausnahmezustand als Verlust von Furcht und jedem Gefühl eigener Verletzlichkeit; es wird keine Rücksicht auf die eigene Sicherheit genommen; eine übermenschliche Kraft und Ausdauer entwickelt sich; Wut, Grausamkeit ohne Einhalten oder Unterscheidungsfähigkeit; eine Übererregtheit des autonomen Nervensystems, von den Betroffenen oft beschrieben als „Adrenalinrausch“ oder „als käme Elektrizität aus mir heraus“ (570).
So ergeht es auch dem Achilles. Er steigert sich immer weiter in sein rauschhaftes Racheerleben hinein und scheut nicht einmal davor zurück, den Leichnam des getöteten Gegners, des Helden Hektor zu entehren und ihm die Bestattung zu verweigern. Schließlich erscheint Hektors Vater Priamos, der schon dem Tode nahe ist und bittet Achilles, seinen Sohn herauszugeben. Nach langer Debatte geht dieser schließlich auf die Bitte ein und kehrt so zur Normalität der damaligen Kriegssitten zurück, in denen die Entehrung des toten Feindes dem stärksten Tabu unterlag. Jetzt gibt Achilles auch seinen sozialen Rückzug auf und wird wieder zu einem „normalen“ griechischen Krieger.
Achilles̓ gefährlicher Ausnahmezustand begann demnach mit einer Verletzung von Regeln und Gebräuchen, die im damaligen Griechenland heilig waren. Shay hat in seiner Arbeit mit kriegstraumatisierten Vietnamveteranen beobachtet, dass ein Verstoß gegen geschriebene oder ungeschriebene Regeln selbst in Kriegszeiten, in denen viele der sonst gültigen Normen außer Kraft gesetzt sind, einer späteren psychotraumatischen Belastungsstörung vorausgegangen war. Paradox genug macht sich die traumatische Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis, die wir unserer Traumadefinition zugrunde legen, selbst unter den weitgehend anomischen Bedingungen des Krieges als besonderer traumatogener Faktor bemerkbar.
1.3.2 Wissenschaftsgeschichte der Psychotraumatologie
Unter den wissenschaftlichen Pionierleistungen, die in der Psychotraumatologie zusammenfließen, sind u. a. der sehr eigenständige Ansatz von Janet zu nennen, die Psychoanalyse und die auf den schwedischen Internisten Selye zurückgehende Stress- und → Copingforschung. Pierre Janet (1859-1947) und Sigmund Freud (1856-1939), Begründer der Psychoanalyse, waren Zeitgenossen. Während Freud und sein Werk vor allem auch für den therapeutischen Umgang mit Traumatisierung historisch sehr bedeutsam wurde, blieben Janets Arbeiten lange Zeit ohne großen Einfluss, wurden dann aber in ihrer Pionierrolle für die Psychotraumatologie gewürdigt. Van der Kolk et al. (1989), die sich mit Janet als einem Vorläufer der modernen Psychotraumatologie befassen, bemerken dazu:
„Es ist eine Ironie, daß in den ausgehenden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die Psychiatrie erst langsam eine Wissensbasis wiederentdeckt über die Auswirkung von Traumatisierung auf psychologische Prozesse, die zentral war in den europäischen Konzeptionen der Psychopathologie während der letzten Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts“ (Übers. die Verf., 365).
Demnach hat es beinahe 100 Jahre gedauert, bis die Arbeiten Janets wieder die Bedeutung erlangten, die sie für Psychologie, Psychopathologie und Psychiatrie um die Jahrhundertwende hatten. Janet hatte seinerzeit ebenso wie zeitweilig auch Freud, mit dem berühmten Hypnosearzt Charcot an der Pariser Salpetriere zusammengearbeitet. Aus den Hypnoseexperimenten und den therapeutischen Ansätzen Charcots ging hervor, dass zahlreiche psychopathologische Auffälligkeiten und Symptombildungen, unter denen die psychiatrischen Patienten litten, mit verdrängten Erinnerungen an traumatische Erlebnisse zusammenhingen. Janet zog als erster den Begriff der → Dissoziation als Erklärungskonzept heran. Dissoziationen ergeben sich nach Janet als Folge einer Überforderung des Bewusstseins bei der Verarbeitung traumatischer, überwältigender Erlebnissituationen. In seiner Arbeit „L̓automatisme psychologique“ (1889) führt er aus, dass die Erinnerung an eine traumatische Erfahrung oft nicht angemessen verarbeitet werden kann: sie wird daher vom Bewusstsein abgespalten, dissoziiert, um zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzuleben, entweder als emotionaler Erlebniszustand, als körperliches Zustandsbild, in Form von Vorstellungen und Bildern oder von Reinszenierungen im Verhalten. Die nicht integrierbaren Erlebniszustände können im Extremfall zur Ausbildung unterschiedlicher Teilpersönlichkeiten führen, was der dissoziativen Identitätsstörung entspricht. Janet hat als erster Gedächtnisstörungen beschrieben, die mit Traumatisierung einhergehen. Er erklärte postexpositorische Amnesien oder Hypermnesien (übergenaue Erinnerungsbilder) als eine Art Übersetzungsfehler, als Unfähigkeit, die traumatische Erfahrung in eine weniger furchterregende Erzählung übertragen zu können (Janet 1904).
Die Unterscheidung verschiedener Repräsentationsformen des Gedächtnisses, wie sie auch in der modernen kognitiven Forschung üblich ist, in enaktiv (verhaltensgesteuert), ikonisch (bildhaft) und symbolisch-linguistisch (Kihlstrom 1984) hat Janets Student Jean Piaget aufgegriffen und auf die Entwicklungsstadien von sensomotorisch-präoperationalen und symbolgesteuert-operationalen Denkvorgängen übertragen. Janets Arbeiten sind vielfach im Werk von Piaget wirksam geworden. Den traumazentrierten Ansatz Janets hat Piaget allerdings nicht weiterverfolgt. Bedeutsam auch heute noch für die Psychotraumatologie ist Janets Entdeckung, dass traumatische Erfahrungen, die nicht mit Worten beschrieben werden können, sich in Bildern, körperlichen Reaktionen und im Verhalten manifestieren. Der „unaussprechliche Schrecken“, den das Trauma hinterlässt, entzieht sich den höheren kognitiven Organisationsebenen, hinterlässt aber seine Spuren auf elementaren, → semiotisch niedrigeren Repräsentationsstufen. Wir bezeichnen diese psychische Struktur mit Erinnerungsfragmenten auf unterschiedlichen Repräsentationsebenen und der charakteristischen Spaltung von Wahrnehmungs- und Handlungsteil als → Traumaschema.
Festzuhalten als Verdienst dieses Forschers bleibt eine recht differenzierte Theorie über Traumatisierung und Gedächtnisstörungen, Reinszenierung des Traumas im Verhalten und auf unterschiedlichen kognitiven Repräsentationsebenen. Besonders bedeutsam ist Janets Konzept einer Dissoziation unterschiedlicher Bewusstseinszustände, die in extremen Fällen zu sich verselbständigenden Teilpersönlichkeiten führen kann. In der psychoanalytischen Theorietradition wurde das Konzept sich verselbständigender Erlebniszustände nur von wenigen Forschern aufgegriffen so etwa von Paul Federn (1952) mit seiner Theorie der „Ich-Zustände“ oder von Mardi Horowitz (1979) in seinem Konzept der „states of mind“, von persönlichkeitstypischen Erlebniszuständen oder Stimmungslagen (vgl. hierzu auch Fischer 1989). Ansonsten hat die Entwicklung der Traumatheorie bei Freud einen etwas anderen Verlauf genommen und andere Akzente gesetzt.
Die Frage, wie weit zwischen Janet und Freud grundsätzlich vereinbare oder einander ausschließende Traumakonzeptionen vorliegen, ist nicht leicht zu entscheiden. Fest steht jedenfalls, dass Freud unterschiedliche Akzente setzte. Auch in Freuds frühen Werken findet sich der Begriff Dissoziation. Freud führte aber bald das Konzept der Abwehr ein, als deren Prototyp die Verdrängung gelten kann. Dabei handelt es sich um ein motiviertes, absichtsvolles Vergessen. Traumatische Erfahrungen werden also demzufolge nicht nur deshalb dissoziiert, weil das Bewusstsein momentan mit ihrer Verarbeitung überfordert wäre. Vielmehr werden sie vom Bewusstsein aktiv ferngehalten, weil ihre Integration die Persönlichkeit mit unangenehmen oder gar unerträglichen Affekten überlasten würde.
In seiner Beschäftigung mit dem psychischen Trauma hat Freud sehr unterschiedliche Epochen durchlaufen. In einer frühen Phase, wie sie sich z. B. in den Studien zur Hysterie (1875) widerspiegelt, war er davon überzeugt, dass eine reale traumatische Erfahrung, insbesondere sexuelle Verführung von Kindern, jeder späteren hysterischen Störung zugrundeliege. In einer späteren Forschungsperiode (etwa ab 1905) relativierte er diese Auffassung. Mit der Erforschung des kindlichen Sexuallebens arbeitete Freud die Rolle kindlicher Triebwünsche und Phantasiebildungen bei der Entstehung neurotischer Störungen heraus. An einer realen Verführung als möglicher Ursache späterer Störungen hielt Freud allerdings weiterhin fest: „...ich kann nicht zugestehen, dass ich in meiner Abhandlung 1896 „Über die Ätiologie der Hysterie“ die Häufigkeit oder die Bedeutung derselben überschätzt habe, wenngleich ich damals noch nicht wusste, dass normal gebliebene Individuen in ihren Kinderjahren die nämlichen Erlebnisse gehabt haben können, und darum die Verführung höher wertete als die in der sexuellen Konstitution und Entwicklung gegebenen Faktoren“ (Freud 1905d, 91).
Aus heutiger Sicht stellt sich die Frage, wie weit Freud in seiner frühen Forschung zur Entstehungsgeschichte der Hysterie einer einseitigen Stichprobenauswahl zum Opfer gefallen war. Unter seinen Patientinnen, die in den Studien zur Hysterie erwähnt sind, befand sich möglicherweise eine überhöhte Quote mit realen sexuellen Missbrauchserfahrungen in der Kindheit. Freuds Schlussfolgerung, dass hysterischen Störungen in jedem Falle sexuelle Verführung zugrunde liegen müsse, war forschungslogisch und empirisch tatsächlich nicht haltbar. Heute wissen wir, dass sexueller Missbrauch in der Kindheit zwar auch zu einer hysterischen Störung führen kann, ebenso gut aber auch zu anderen Bildern wie dem Borderline-Syndrom oder dissoziativen Störungen (vgl. Kap. 9.4.6) Auch in der „follow-back“-Perspektive hat eine neurotische Störung, eine hysterische Neurose keineswegs immer psychotraumatische Ursachen. Unterschiedliche biologische und sozialisatorische Einflüsse können eine neurotische Entwicklung einleiten, darunter etwa auch die Verwöhnung von Kindern durch überfürsorgliche Erwachsene. Zudem können sehr unterschiedliche kindliche Traumen später zu einem ähnlichen Störungsbild führen. Ein Deprivationstrauma kann ein depressives, narzisstisches, aber auch hysterisches Störungsbild nach sich ziehen, abhängig wohl vor allem von unterschiedlichen Konstellationen der traumatischen Situation. Nach Kriterien der psychotraumatologischen Forschungslogik hatte Freud gute Gründe, seine erste, pauschal verallgemeinernde Theorie von der Ätiologie der Hysterie zu revidieren.
Daraus ist gegen Freud wiederholt der Vorwurf abgeleitet worden, er habe die Verführungstheorie aufgegeben, um der sozialen Ächtung zu entgehen, die mit seiner frühen Entdeckung verbunden war (etwa Masson 1984b). Zweifellos hatte Freud an ein Tabu gerührt, wie so oft bei psychotraumatologischen Forschungsthemen. Freud berichtet von einem Vortragsabend im „Psychiatrischen Verein“ Wien. Dort hatte er seine Thesen zur Ätiologie der Hysterie vorgetragen. Die Reaktion der Kollegen schildert er in einem Brief an seinen Freund Fließ folgendermaßen:
„Ein Vortrag über Ätiologie der Hysterie im Psychiatrischen Verein fand bei den Eseln eine eisige Aufnahme und von Krafft-Ebing (dem Chef der Psychiatrischen Universitätsklinik) die seltsame Beurteilung: Es klingt wie ein wissenschaftliches Märchen. Und dies, nachdem man ihnen die Lösung eines mehrtausendjährigen Problems, ein caput Nili, aufgezeigt hat!“ (aus den Briefen an Fließ, Freud 1962).
Freud fuhr fort, wie wir aus der erweiterten Ausgabe der Briefe an Fließ inzwischen wissen: „Sie können mich alle Gernhaben“. Er war also keineswegs gewillt, die neue Entdeckung dem gängigen Vorurteil zu opfern. Auch hat er sie später nicht pauschal als irrtümlich bezeichnet. Der Nachweis zwischen traumatischer Kindheitserfahrung und späterer Pathologie wurde in den Studien zur Hysterie sorgfältig geführt. Wir können diese Schrift auch heute noch als einen differenzierten Beitrag zur Erforschung traumatischer Prozesse nach sexuellem Kindesmissbrauch lesen. Vorbildlich sind sie in ihrer Rekonstruktion des komplexen Zusammenhangs zwischen traumatischer Situation, Reaktion und Prozess, der einer ebenso differenzierten qualitativen Methodik bedarf, wie Freud sie damals in Ansätzen entwickelt hatte.
In seinen späteren Arbeiten hat sich Freud stärker der Erforschung des Innenlebens zugewandt als zur Zeit der „Studien“, so z. B. in den „drei Abhandlungen zur Sexualtheorie“ (1905d), in denen er die Phasen der → psychosexuellen Entwicklung erforschte. Der Vorwurf, er habe mit der Hinwendung zu den Sexualphantasien der Kinder und ihrer eigenen sexuellen Neugierde und Aktivität die Verführungstheorie außer Kraft gesetzt oder „verraten“, scheint wenig überzeugend. Kinder haben ein eigenes erotisches und sexuelles Phantasieleben, das durch aktive Sexualisierung, wie sie zur pathogenen Dynamik bei sexuellem Kindesmissbrauch gehört (vgl. Abschnitt 9.4) traumatisch gestört wird. Die Überfremdung und Ausbeutung der kindlichen Spontaneität durch die Erwachsenen bildet hier, wie oft beim kindlichen Beziehungstrauma, ein → zentrales traumatisches Situationsthema und den Punkt → maximaler Interferenz von Subjekt und traumatogenen Situationsfaktoren. Wir verdanken Freud die Einsicht in die kindliche Erlebniswelt, ein Bild vom Kind als unverzagtem kleinem „Sexualforscher“, das mit seiner Intelligenz und Neugierde den Desorientierungsversuchen der Erwachsenen, den Geschichten vom Klapperstorch usf. hartnäckig widersteht. Kinder haben eigene sexuelle Wünsche, Bedürfnisse und Phantasien. Das macht sie besonders verletzlich gegenüber missbräuchlichem Verhalten, das den Entwicklungsaspekt dieser Bedürfnisse übergeht und sie den egoistischen Interessen der Erwachsenen unterwirft. Freud vorzuhalten, er habe den Kindesmissbrauch bagatellisiert oder womöglich noch gerechtfertigt, weil er das sexuelle Eigenleben des Kindes zum Gegenstand der psychoanalytischen Forschung machte, entspricht jener kognitiven Konfusion, die oft ein Ausdruck der grenzlabilen Missbrauchsdynamik ist und zusammen mit den übrigen traumatogenen Faktoren (vgl. Abschnitt 9.4.3) wie Verrat, Stigmatisierung und Misshandlung leider oft auch die wissenschaftliche Diskussion bei traumatologischen Tabuthemen bestimmt bzw. ersetzt.
So weit psychoanalysekritische Argumente sich auf diesem Niveau bewegen, müssen sie von einer wissenschaftlichen Psychotraumatologie nicht sonderlich ernst genommen werden. Autoren wie Alice Miller (1981) oder Masson (1984b) haben jedoch mit ihrer Psychoanalysekritik u. E. eine grundsätzliche, epistemologische Frage aufgeworfen, die sich etwa folgendermaßen formulieren lässt: Wie weit wird in der Psychoanalyse (und in der Psychologie überhaupt) ein Gleichgewicht zwischen „intrapsychischen“ Faktoren und externen Umweltfaktoren in seiner Bedeutung für die psychische Entwicklung anerkannt und angemessen berücksichtigt? Wie weit wird dieser dialektische Zusammenhang von subjektiver Bedürfniskonstellation und objektiven Situationsfaktoren mit der Konzentration auf rein „intrapsychische Verhältnisse“ unterlaufen? Ein kritischer Vorbehalt ist hier sicherlich angebracht bei einzelnen Studien oder auch psychoanalytischen Ansätzen, die bei traumatogenen Störungen keinen phänomenologisch ausgewiesenen Zusammenhang mit traumatischen Situationsfaktoren herzustellen vermögen. Diese Kritik wurde gegenüber den Theorien von Melanie Klein und Bion erhoben. Im Gegensatz dazu fordert Freuds ursprünglicher Traumabegriff dazu auf, pathogene Umweltkonstellationen systematisch in die psychoanalytische Untersuchung einzubeziehen. Freud knüpft zunächst an eine Analogie zum körperlichen Trauma an, wie folgende Definition verdeutlicht:
„Wir nennen so (traumatisch, d. Verf.) ein Erlebnis, welches dem Seelenleben innerhalb kurzer Zeit einen so starken Reizzuwachs bringt, daß die Erledigung oder Aufarbeitung desselben in normal-gewohnter Weise mißglückt, woraus dauernde Störungen im Energiebetrieb resultieren müssen.“ (GW XI, 284).
Eine ähnliche organische Metapher findet sich auch in Freuds Arbeit von 1920g, in „Jenseits des Lustprinzips“, worin er über die Selbstorganisation der lebendigen, organischen Substanz nachdenkt. Das lebende Bläschen wird vor Außenreizen durch eine Schutzhülle oder einen Reizschutz geschützt, der nur erträgliche Energiequantitäten durchlässt. Hat diese Hülle einen Einbruch erlitten, dann liegt ein Trauma vor. Nun ist es die Aufgabe des psychischen Apparates, alle verfügbaren Kräfte zu mobilisieren, um Gegenbesetzungen aufzurichten, die anflutenden Reizquantitäten zu binden und die Wiederherstellung des Lustprinzips zu ermöglichen.
Bedeutsam für Freuds Traumatheorie ist neben ihrer körperlich-organischen Metaphorik noch der Begriff der Nachträglichkeit. Ein Beispiel sind quasi-erotische Kontakte zwischen Erwachsenen und Kindern. Manchmal erst in der Pubertät kommen dem Kind die sexuellen Anklänge der Situation zu Bewusstsein. So wird die frühe Szene rückwirkend neu bewertet, diesmal im Bedeutungshorizont der entwickelten sexuellen Phantasien und Wünsche eines Adoleszenten. Hier nimmt der Traumabegriff eine Tendenz in sich auf, die sich in der gesamten Fortentwicklung des Freudschen Denkens findet: die zeitliche Einbindung der seelischen Phänomene in den Lebensentwurf und die Lebensgeschichte. Die Zeitstruktur der Nachträglichkeit muss beim Studium traumatischer Prozesse generell berücksichtigt werden. Dem trägt das → Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung Rechnung.
In einer späteren Epoche der Entwicklung des Traumabegriffs verschwindet Laplanche und Pontalis (1967) zufolge allerdings die ätiologische Bedeutung des Traumas für die Neurose zugunsten des Phantasielebens und der Fixierungen der Persönlichkeitsentwicklung auf verschiedenen Libidostufen. Genauer gesagt entwickelt Freud einen zweiten Traumabegriff. Neben unerträglichen Situationsfaktoren werden inakzeptable und unerträglich intensive Triebwünsche und -impulse als Traumafaktor untersucht. Wenn somit auch der traumabezogene Standpunkt nicht verlassen wird, wie Freud betont, so wird er doch in eine breitere ätiologische Konzeption einbezogen, die „innere“ Faktoren berücksichtigt wie die physische Konstitution und die Kindheitsentwicklung in ihrem gesamten Verlauf. Trauma wird jetzt Bestandteil einer Geschichte als Lebensgeschichte und als Geschichte der Entwicklung von Triebwünschen und Lebenszielen. In dieser weiten Konzeption der Neurose-entstehung ist das Trauma ein ätiologisches Moment unter anderen, das sich in einer → Ergänzungsreihe mit Erbfaktoren und Triebschicksal befindet. Der Ausdruck bezeichnet ein komplementäres Ergänzungsverhältnis interner und externer ätiologischer und pathogenetischer Faktoren, die sich zu einem pathologischen Schwellenwert aufschaukeln können. Die kritische Frage an den psychoanalytischen Umgang mit Traumata lässt sich folgendermaßen konkretisieren: Werden im Einzelfall beide Traumakonzepte – unerträgliche Situation vs. unakzeptabler Impuls – (→ Traumatisierung) gleichermaßen in Erwägung gezogen? Welchem Konzept wird der Vorzug gegeben? Bei nur oberflächlicher Kenntnis kann die „Situation“ allzu leicht als normal, unauffällig oder durchschnittlich betrachtet werden, wodurch ev. Traumafolgen „automatisch“ dem → Trieb- oder Phantasieleben der Persönlichkeit zugeschrieben werden. Solch eine Vorentscheidung kann weit reichende Konsequenzen haben. Wird z. B. die psychoanalytische Langzeitbehandlung traumatisierter Patienten nicht explizit auch als → Traumatherapie geführt (vgl. Abschnitt 4), so wird die Verleugnungstendenz des Opfers unterstützt, damit auch die gefährlichen Tendenzen zur Selbstbeschuldigung. Hier ist schon vom Therapiekonzept her eine Retraumatisierung des Patienten zu erwarten. Dieses Problem stellt sich besonders in der gegenwärtigen kleinianischen Richtung, die nach der Einschätzung von Schafer (1997, 354 passim) auf die Rekonstruktion und Aufarbeitung von Traumata generell zu verzichten scheint.
Eine extern traumatische Entstehungsgeschichte nimmt Freud bei der traumatischen Neurose an. Laplanche und Pontalis (1967, 521) fassen sein Verständnis dieses psychiatrischen Konzepts folgendermaßen zusammen:
„Hier sind 2 Fälle zu unterscheiden, a) das Trauma wirkt als auslösendes Element, es enthüllt eine präexistente neurotische Struktur, b) das Trauma hat einen determinierenden Anteil gerade am Inhalt des Symptoms. Wiederholung des traumatischen Ereignisses, immer wiederkehrende Alpträume, Schlafstörungen etc., was als ein wiederholter Versuch erscheint, das Trauma zu binden und abzureagieren; eine ähnliche Fixierung an das Trauma geht einher mit einer mehr oder weniger generalisierten Aktivitätshemmung des Subjekts. Diesem zuletzt genannten klinischen Bild behalten Freud und die Psychoanalytiker gewöhnlich die Bezeichnung traumatische Neurose vor“.
Während wir heute die erste Konstellation eher als auslösendes Moment einer neurotischen Reaktion bezeichnen, gehört zu den differenziellen Merkmalen der traumatischen Neurose der inhaltliche Bezug zwischen traumatischer Situation und der jeweiligen Symptomatik.
Unter den psychoanalytischen Autoren, die das Traumakonzept weiterentwickelt bzw. spezielle Bereiche der Traumatisierung näher erforscht haben, sind zu nennen Abraham Kardiner, Masud M. Khan, John Bowlby, Donald W. Winnicott, Max Stern, Henry Krystal und andere mehr (eine Übersicht bei Brett 1993). Kardiner verfasste sein Werk „The traumatic neuroses of war“ während des zweiten Weltkrieges im Jahre 1941. Seine klinische Erfahrung ging zurück auf die psychotherapeutische Arbeit mit amerikanischen Soldaten, die im Krieg gegen Nazi-Deutschland und Japan kämpften. Er war der erste, der die massiven physiologischen Begleiterscheinungen traumatischer Reaktionen schon in der Namengebung berücksichtigte, indem er von der traumatischen Neurose als einer „Physioneurose“ sprach. Kardiner formulierte ein Syndrom von Folgeerscheinungen, das in vielem bereits als Vorläufer des heutigen basalen PTBS gelten kann. Er übernahm die von Sandor Rado geprägte Sichtweise der Neurose als einer Form des Anpassungs- und Bewältigungsversuchs und wies darauf hin, dass es wichtig sei, den Sinn hinter den Symptomen zu entdecken, um die Folgeerscheinungen zu verstehen. Folgende Leitmerkmale wurden von Kardiner aufgeführt: 1. Schrumpfen oder Einengung des Ichs (ego contraction); 2. Ausgehen der inneren Ressourcen oder energetische Verarmung; 3. „disorganization“, was wir heute als Strukturverlust und evtl. auch Dissoziation bezeichnen würden.