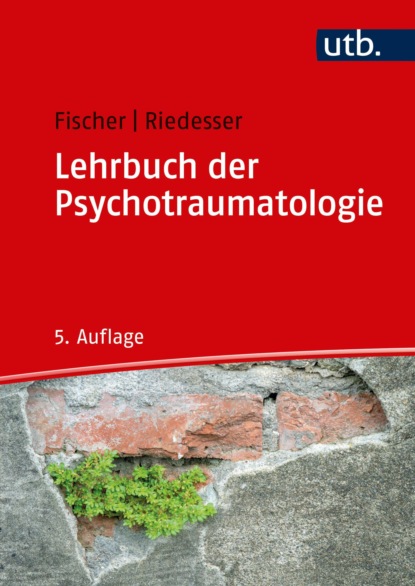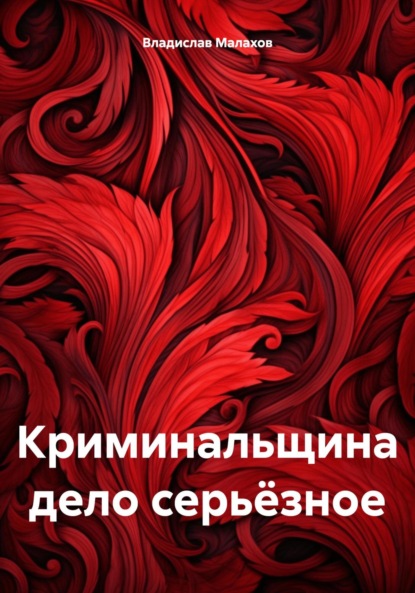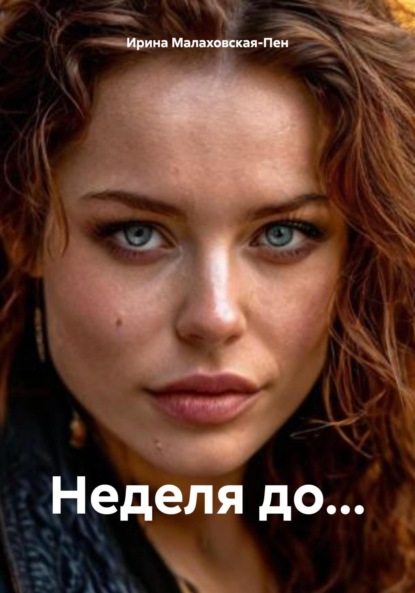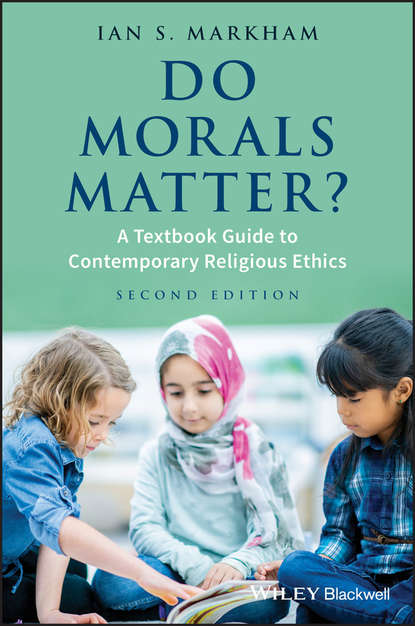- -
- 100%
- +
Die Symptomatik, die er im Einzelnen beschrieb, war sehr komplex. Sie konnte akut oder chronisch sein und bestand aus Ermüdungserscheinungen und Lustlosigkeit, Depressionen, schreckhaften Reaktionen, wiederkehrenden Alpträumen, Phobien und Ängsten, die situationsbezogen mit dem Trauma assoziiert waren, eine Mischung aus impulsivem Verhalten und Unbeständigkeit der zwischenmenschlichen Beziehungen sowie eine Neigung zu Misstrauen, Verdächtigungen und Ausbrüchen von Wut und Gewalttätigkeit.
Eine Erweiterung des Freudschen Traumakonzeptes findet sich bei Masud Khan mit seinem Begriff des → kumulativen Traumas (1963). Hier addieren sich Ereignisse und Belastungen, die jedes für sich subtraumatisch, d. h. unter der Schwelle der Traumatisierung im engeren Sinne verbleiben würden, zu einer insgesamt traumatischen Verlaufsgestalt. Immer wenn das Ich seinen Schutzschild, seine Reiz-Abwehr-Barriere wieder aufrichten will, tritt statt sozialer Unterstützung eine weitere Belastung ein. Dies lässt auf die Dauer die Selbstschutzfunktionen des Ich zusammenbrechen.
Zu erwähnen sind auch die Ausführungen von D. W. Winnicott – eines Londoner Kinderarztes und Psychoanalytikers – zum Trauma und zur Auswirkung von Traumata, dessen Werk zu den gedankenreichsten der Psychoanalyse zählt. Winnicott geht davon aus, dass die frühkindliche Entwicklung nur dann ungestört verläuft, wenn das Kind in der frühesten Lebensperiode auf eine Umwelt trifft, die seine noch unentwickelten Möglichkeiten so optimal ergänzt, dass es sich der Illusion kindlicher Allmacht, einer völligen Verfügungsgewalt über die psychosoziale Umgebung überlassen kann. Allein diese Allmachtillusion ermöglicht eine selbstbewusste Entwicklung, die dem Kind die Gewissheit vermittelt, seine Umweltbedingungen kreativ gestalten zu können. Auch wenn die Illusion später schrittweise abgebaut wird, bleibt sie doch die Grundlage späterer „Selbsttätigkeit“ („self efficacy“ in der „sozial-kognitiven Lerntheorie“ von Bandura 1976) und schöpferischer Leistungen, welche die sozial und physikalisch vorgegebene Umwelt nicht passiv hinnehmen, sondern sie auf die menschlichen Bedürfnisse und Möglichkeiten hin ausgestalten. Durch Versagen der Umwelt oder durch Übergriffe gegenüber dem Kind kommt es zu einer Minitraumatisierung, welche die kindliche Allmachtphantasie zerstört und eine verfrühte → Desillusionierung bewirkt. Statt einer „genügend guten“ Umgebung, die sich in ausreichendem Maß den kindlichen Bedürfnissen anpasst, muss nun umgekehrt das Kind sich seiner Umgebung anpassen, was es in dieser frühen Periode überfordert. So kommt es zum Aufbau eines falschen Selbstsystems, worin das Subjekt sich den Umweltanforderungen unterwirft und dabei oft lebenslang begleitet ist von einem Gefühl der Fremdheit und inneren Leere, der Empfindung, in seinen Handlungen selbst nicht wirklich präsent zu sein (Winnicott 1954; Schacht 1996).
Ein Autor, der in einem psychoanalytischen Verständnishorizont arbeitet, ausgebildeter Analytiker war und psychoanalytische Konzeptionen eigenständig weiterentwickelt hat, ist John Bowlby. Er war einer der ersten Psychoanalytiker, die empirische Forschung mit psychoanalytischer Theorie und Praxis verbanden. So entstand das auch heute noch bedeutendste Standardwerk zum → Deprivationstrauma. In den drei Arbeiten „Separation“, „Bounding“ sowie „Loss, Mourning and Depression“ (1976, 1987) hat Bowlby Forschungen und Konzepte zur Auswirkung von frühkindlicher Deprivation wie z. B. früher Elternverlust, häufig wechselnde Beziehungserfahrungen und Trennungstraumata zusammengefasst. Bowlby verbindet psychoanalytisches Gedankengut und die subtilen Beobachtungen, die in der psychoanalytischen Situation möglich werden mit einer Vielzahl anderer Ansätze, von kognitiver Entwicklungspsychologie über neurobiologische Konzepte und Verhaltensbiologie bis hin zur Soziologie, → Epidemiologie und Kulturgeschichte. Auch in methodischer und methodologischer Hinsicht kann Bowlbys Werk als Vorbild für die Psychotraumatologie betrachtet werden.
Max Stern (1988) sieht die unmittelbare Folge von massiver Traumatisierung in einer katatonoiden Reaktion einerseits, einem Erstarren und in einem agitierten Bewegungssturm andererseits. Dies sind die ersten Notfallreaktionen auf massive psychische Traumatisierung. H. Krystal (1968) greift die katatonoide Reaktion von Stern auf und sieht sie als Folge von massiver anhaltender psychischer Traumatisierung. In diesen Zuständen, in der so genannten katastrophischen Reaktion, verfällt das Individuum in völlige Hilflosigkeit. Hier ergibt sich eine Parallele zum Konzept der erlernten → Hilflosigkeit nach Seligman. Die katatonoide Reaktion auf ein katastrophisches Trauma kann zur Aufgabe aller Selbsterhaltungsfunktionen und somit, im übertragenen Sinne, zum psychogenen Tod führen. In der Psychoanalyse war Krystal der erste, der zwischen massiver katastrophischer Traumatisierung und leichteren Formen des Traumas deutlich unterschieden hat.
Eine dritte Forschungsrichtung, die zur Entstehung der Psychotraumatologie wesentlich beigetragen hat, ist die Stressforschung mit den Pionierarbeiten von Selye. Selye näherte sich der Frage belastender Umweltfaktoren als Internist unter dem Gesichtspunkt der körperlichen Reaktionen und der Krankheiten, die durch kurz- oder langfristige Belastung hervorgerufen werden können. Im Jahre 1936 formulierte er sein Modell der → Stressreaktion mit den drei Phasen des Alarms, des Widerstandsstadiums und schließlich des Erschöpfungsstadiums. Die Alarmreaktion ist gekennzeichnet durch einen erhöhten Sympathicotonus und eine sympathicoton gesteuerte „Bereitstellungsreaktion“, bei der der Energieumsatz erhöht und ATP-Reserven freigesetzt werden. Im Widerstandsstadium werden denn diese Reserven des Körpers genutzt, um die massive Belastung kompensieren zu können. So kommt es physiologisch etwa zur Produktionssteigerung von Nebennierenhormonen wie Cortisol und zur Erhöhung des Blutzuckerstoffwechsels. Dauert der dann pathogene Umweltreiz, der „Stressor“, wie Selye ihn nannte, weiter an, so treten massive und zum Teil irreversible Folgen auf wie Dekompensation der Reproduktionsfunktionen und Sexualfunktionen, der Wachstumsvorgänge und der Immunkompetenz. Ebenfalls kann andauernder Stress in klinisch relevantem Maße die Wundheilung beinträchtigen (Gouin 2011). Als Extrembeispiel können die nach den langdauernden Stellungskriegen beobachteten „Kriegszitterer“ gelten. Unter dem dauerhaft fortgesetzten extremen Stress entwickelte sich ein Syndrom, das zum Teil schwersten Tremor bis hin zur Gangunfähigkeit beinhaltete.
Selye unterteilte die Umweltreize in Stressoren mit positiver versus negativer Bedeutung für den Organismus. Die positiven nannte er Eustress (von altgr. eu = wohl, gut), die negativen Disstress (von altgr. dys = schecht). Er ging davon aus, dass die organismische Reaktion auf negative Stressoren gleichförmig sei. Diese Annahme konnte erst in letzter Zeit physiologisch widerlegt werden. So ergaben etwa Untersuchungen, die Weiner (1984) zusammenfasst, dass eine differenzielle physiologische Reaktion auf verschiedenartige Umweltsituationen schon im Tierversuch zu beobachten ist. Weiner bezeichnete das 3-phasige Verlaufsmodell der Stressreaktion nach Selye auch als generelles Adaptationssyndrom (GAS), das umweltabhängig spezifische Varianten aufweisen kann.
Die Untersuchungen Selyes haben sich für die Erforschung der Psychosomatik innerer Krankheiten sehr fruchtbar ausgewirkt. Zumal Selye auch schon psychologische Symptome beschrieben hat, die dem physiologischen Stressverlauf entsprechen, kann man diese Forschungsrichtung insgesamt als wichtigen Beitrag zu einer psychologischen und psychosomatischen Traumatologie bezeichnen. Das Ungleichgewicht zwischen Organismus und Umwelt wurde in seinen Folgen auf verschiedenen Ebenen des psychophysischen Weltverhältnisses erforscht – eine Konstellation, die im Modell des → Situationskreises nach Thure v. Uexküll und Wesiack veranschaulicht werden kann, das wir im Abschnitt 2.2 zur Darstellung traumatischer Situationserfahrungen verwenden.
Da Selye einen „Reiz“, den Stressor und andererseits eine organismische „Reaktion“, die Stressreaktion als Bezugspole seines Modells gewählt hatte, wurde die Stressforschung, besonders innerhalb der nordamerikanischen Psychologie und Medizin über lange Zeit nach dem → behavioristischen Reiz-Reaktions-Modell fortgeführt. In dieser Interpretation „bewirkt“ der Stressor als Reiz unmittelbar die Stressreaktion und schließlich die Krankheit, eine Vereinfachung gegenüber einem → ökologischen Verständnis der Subjekt-Objekt-Beziehung, die zwar, und das ist der für die Traumaforschung wertvolle Aspekt des Modells, zur Analyse von Umweltfaktoren anregt, aber dem subtilen Zusammenspiel von Subjekt und Objekt im Erleben von Stress und Trauma zu wenig Aufmerksamkeit schenkt. Erst im Zuge der sog. kognitiven Revolution gegenüber dem → Behaviorismus entstand eine differenziertere Konzeption der Subjekt-Umwelt-Beziehung, wie zum Beispiel im sog. „transaktionalen Stressmodell“ nach Lazarus (1984). Organismus und Umwelt werden hier als aufeinander bezogene Größen gefasst, eine Vorstellung, die sich einer ökologischen und dialektischen Konzeption, von der wir ausgehen, zumindest annähert. Dementsprechend wurden jetzt auch subjektive „Vermittlungsgrößen“ wie z. B. → Abwehr- und → Copingprozesse berücksichtigt. Es entstand eine Forschungsrichtung, die salopp als „Stress- and Coping-Approach“ bezeichnet wird. Hierin verbinden sich kognitiv-behaviorale Ansätze mit Konzepten der Anpassungs- und Bewältigungsmechanismen aus der psychoanalytischen Ich-Psychologie. Der „Stress und → Coping“-Zugang ist neben der Psychoanalyse eine der Strömungen, die in der Psychotraumatologie zusammenfließen. Faszinierend ist die Beobachtung, dass Forschungsrichtungen mit zunächst völlig unterschiedlichem Ausgangspunkt und unterschiedlichen Begriffssystemen sich zunehmend auf die Wechselwirkung zwischen Individuum und Umwelt zu konzentrieren beginnen, sobald sie sich mit Phänomenen der Traumatisierung befassen. Von daher sollte die immer genauere phänomenologische Beschreibung und wissenschaftliche Erforschung der menschlichen Umweltbeziehung in ihren subjektiven wie objektiven Aspekten die epistemologische Grundlage der Psychotraumatologie bilden.
1.4 Diagnostik als „Momentaufnahme“: Syndrome der allgemeinen und speziellen Psychotraumatologie
Wir schlagen in diesem Lehrbuch eine Betrachtungsweise psychotraumatischer Phänomene vor, die wesentlich am Verlaufsprozess psychischer Traumatisierung ausgerichtet ist. Dieser Zugang scheint uns den bisher bekannten Phänomenen am besten zu entsprechen, da hier die Variationsbreite der individuellen Biographien und Lebensentwürfe konzeptuell in den Blick genommen wird. Klassifikatorische, taxonomische Systeme haben dagegen etwas Statisches und können der Gefahr einer einseitigen und damit auch willkürlichen diagnostischen Klassifikation von Individuen oder Gruppen nur schwer entgehen. Während ein Verlaufsmodell vom zeitlichen Längsschnitt von Lebensläufen oder geschichtlichen Prozessen ausgeht, versuchen diagnostische Taxonomien, diese zeitlich bewegten dynamischen Phänomene in überzeitliche statische Raster einzufangen. Man kann diese querschnitthaften Aufrisse von Biographien mit einer oder mehreren Momentaufnahmen vergleichen, die aus dem Handlungsverlauf beispielsweise eines Spielfilms herausgelöst werden. Solche Standphotos können gelingen, sie können für die Rolle und den Schauspieler im „Lebensfilm“ charakteristisch sein, sie können seine Verfassung zutreffend wiedergeben. Es ist aber auch möglich, dass die Momentaufnahme ganz untypisch ausfällt. Aus Bedürfnissen von klinischer Praxis und Forschung heraus sind andererseits die „Blitzlichter“ und querschnitthaften Momentaufnahmen, die uns Diagnosen und Testuntersuchungen liefern, unverzichtbar. Die Kunst besteht darin, Längs- und Querschnittmethoden so aufeinander abzustimmen, dass die „Momentaufnahme“, um im Bild zu bleiben, wesentliche Züge auch der dynamischen Verlaufsprozesse erfasst.
In der Psychotraumatologie müssen wir mit einer Vielzahl von Symptomen und Syndromen als mögliche Folgeerscheinungen rechnen. Diese lassen sich auf die Variationsbreite traumatischer Situationen einerseits, individueller Reaktionen andererseits zurückführen, vor allem aber auf die wechselseitige Verschränkung von objektiven und subjektiven Momenten, die sich aus der im Lebenslauf gebildeten individuellen Wirklichkeitskonstruktion des Menschen ergibt. Natürlich bedeutet diese Variationsbreite keineswegs Regellosigkeit und reinen Zufall. Hier herrschen neben allgemeinen Gesetzmäßigkeiten auch Regeln, die man paradoxerweise vielleicht als „individuelle Gesetzmäßigkeiten“ (→ individuell-nomothetischer Ansatz) bezeichnen kann. Letztere immer besser zu verstehen, ist ein besonders lohnenswertes Ziel psychotraumatologischer Forschung und therapeutischer Praxis.
Um terminologisch der Bandbreite möglicher Folgeerscheinungen des Traumas zu entsprechen, schlagen wir vor, von allgemeinen und speziellen psychotraumatischen Syndromen zu sprechen. Die Unterscheidung entspricht dem Aufbau dieses Lehrbuchs in einen Teil I, der von allgemeinen Gesetzmäßigkeiten traumatischer Erfahrungsprozesse handelt und Teil II mit einer Auswahl spezieller traumatischer Situationen und Situationskonstellationen. Vergewaltigung, Deprivation, Folter, sexueller Missbrauch in Kindheit oder in Psychotherapie und Psychiatrie sind Beispiele für Themen der speziellen Psychotraumatologie. Die Bandbreite dieser in sich gleichwohl typisierbaren traumatischen Situationserfahrungen ist so groß, dass bei den Folgeerscheinungen ein einheitliches „Traumasyndrom“ kaum zu erwarten ist. Vielmehr hat sich auch bisher schon „spontan“ bei Forschern und Klinikern die Gewohnheit gebildet, besondere Syndrome in diesen Bereichen zu beschreiben: etwa ein Vergewaltigungstrauma, → professionales Missbrauchstrauma, spezielle Dynamiken und Folgen bei sexuellem Kindesmissbrauch, ein KZ-Syndrom, ein Foltersyndrom usf. Dem wollen wir Rechnung tragen, indem wir diese als „Syndrome der speziellen Psychotraumatologie“ oder als „spezielle psychotraumatische Belastungssyndrome“ bezeichnen (spezielle PTBS). Sie werden zumeist nach der traumatischen Situation benannt. Natürlich treten auch bei den speziellen Syndromen aus den genannten Gründen wiederum vielfältige individuelle Varianten auf.
Als Syndrome der allgemeinen Psychotraumatologie oder als allgemeine psychotraumatische Belastungsyndrome bezeichnen wir hingegen solche Klassifikationen, die versuchen, Symptome und Syndrome zu formulieren, die mehreren speziellen Syndromen oder vielleicht sogar allen gemeinsam sind. Hier bewegen wir uns also auf einer abstrakteren Ebene mit allen Vor- und Nachteilen weit reichender Verallgemeinerung. Dennoch scheinen sich hier einige Taxonomien herauszubilden, die für die klinische Praxis und weitere Forschung heuristisch von großer Bedeutung sein können. Am bekanntesten ist das sog. „posttraumatische Stresssyndrom“ (Posttraumatic Stress Disorder, PTSD) aus dem Diagnostisch Statistischen Manual der nordamerikanischen psychiatrischen Gesellschaft, das nachfolgend beschrieben wird.
Tabelle 2: Diagnostische Kriterien der Posttraumatischen Belastungsstörung nach DSM-5
A. Bedrohung mit Tod, ernsthafter Verletzung oder sexueller Gewalt in einer oder mehreren der folgenden Formen:
1)Direktes Erleben eines der traumatischen Ereignisse.
2)Persönliches Miterleben eines dieser traumatischen Ereignisse bei anderen Personen.
3)Mitteilung, dass eines der traumatischen Ereignisse einem engen Familienmitglied oder einem Freund widerfahren ist. Im Falle eines Todesfalles (drohenden Todes) muss dieser durch einen Unfall oder eine Gewalthandlung eingetreten sein.
4)Wiederholte Konfrontation mit aversiven Details einer traumatischen Situation (z. B. Notfallhelfer, die Leichenteile einsammeln müssen; Polizeibeamte, die wiederholt mit Details kindlicher Missbrauchsgeschichten konfrontiert sind). (Exposition durch elektronische Medien, Fernsehen, Film oder Bilder nur dann, wenn sie beruflich bedingt ist.)
B. Eines oder mehrere der folgenden Intrusionssymptome, die mit dem Trauma assoziiert sind und nach dem Trauma auftreten:
1)Wiederholte eindringliche belastende Erinnerungen an das traumatische Erlebnis. (Bei Kindern > 6 Jahre kann das traumatische Erleben in wiederholten Spielszenen ausgedrückt werden, in denen Aspekte des Traumas dargestellt werden.)
2)Wiederholte und belastende Träume, in denen der Inhalt und/oder der Affekt des Traums in Beziehung zum Trauma stehen. (Bei Kindern können Angstträume ohne erkennbaren Inhalt vorkommen.)
3)Dissoziative Symptome (z. B. Flashbacks), in denen die Person fühlt oder handelt, als ob sich die traumatische Situation gerade wiederholt. (Die Reaktionen können in einem Kontinuum vorkommen, wobei bei einer maximalen Ausprägung ein völliger Verlust der Wahrnehmung der aktuellen Umgebung auftreten kann.)
4)Intensive oder anhaltende psychische Belastung bei Konfrontation mit internen oder externen Reizen, die die traumatische Situation symbolisieren oder an einen Aspekt des Traumas erinnern.
5)Deutliche körperliche Reaktionen bei Konfrontation mit internen oder externen Reizen, die die traumatische Situation symbolisieren oder an einen Aspekt des Traumas erinnern.
C. Anhaltende Vermeidung von Reizen, die mit dem Trauma verbunden sind, auf mindestens eine der folgenden Weisen:
1)Vermeidung belastender Erinnerungen, Gedanken oder Gefühlen, die mit dem Trauma in Verbindung stehen.
2)Vermeidung externer Reize, die an das Trauma erinnern (Personen, Plätze, Unterhaltungen, Aktivitäten, Situationen).
D. Negative Veränderungen der Kognitionen und der Stimmung nach dem Trauma. Mindestens zwei der folgenden Symptome liegen vor:
1)Unfähigkeit, sich an wichtige Aspekte des Traumas zu erinnern (als Folge einer dissoziativen Amnesie und nicht durch andere Faktoren wie z. B. eine Hirnverletzung, Alkohol oder Drogen bedingt).
2)Persisierende und übersteigerte negative Kognitionen oder Erwartungen in Bezug auf sich selbst, andere oder die Welt (z. B. „Ich bin schlecht“, Man kann niemandem trauen“, „Die gesamte Welt ist gefährlich“, „Mein gesamtes Nervensystem ist für immer zerstört“).
3)Andauernde kognitive Verzerrungen in Hinblick auf die Ursachen oder die Folgen der traumatischen Situation, die dazu führen, dass die Person sich selbst oder anderen Vorwürfe macht.
4)Anhaltende negative Emotionen (z. B. Angst, Furcht, Ärger, Schuld, Scham).
5)Deutlich vermindertes Interesse an wichtigen Aktivitäten.
6)Gefühl der Entfremdung von anderen Personen.
7)Anhaltende Unfähigkeit, positive Emotionen zu empfinden (z. B. Fröhlichkeit, Zufriedenheit, Liebe).
E. Anhaltende Symptome erhöhten Arousals und übersteigerter Reaktionen. Mindestens zwei der folgenden Symptome liegen vor:
1)Irritabilität und aggressive Ausbrüche (ohne oder nach geringer Provokation), die sich in verbalen oder körperlichen Aggressionen gegen andere Personen oder Objekten manifestieren.
2)Rücksichtslosigkeit und selbstzerstörerisches Verhalten.
3)Gesteigerte Wachsamkeit.
4)Übertriebene Schreckreaktionen.
5)Konzentrationsschwierigkeiten.
6)Schlafstörungen (Ein- oder Durchschlafstörungen, unruhiger Schlaf).
F. Das Störungsbild (Kriterien B, C, D und E) dauert länger als einen Monat.
G. Das Störungsbild verursacht klinisch bedeutsames Leiden oder eine Beeinträchtigung der sozialen, beruflichen oder anderer bedeutsamer Fähigkeiten.
H. Das Störungsbild ist nicht auf physiologische Effekte von Substanzen (z. B. Medikamente, Alkohol) oder eine andere körperliche Erkrankung zurückzuführen.
Die American Psychiatric Association (APA) veröffentlichte 2013 die nunmehr fünfte Version ihres Klassifikationssystems Diagnostic and Statistical Manual for Psychiatric Disorders (American Psychiatric Association 2013). Die Traumata und belastungsbezogenen Störungen erhalten hier erstmals ein eigenständiges Kapitel um den selbständigen Charakter der Syndrome in Abgrenzung zu den anderen Angststörungen zu zeigen (Ausführlich zum Übergang von DSM-IV-TR zu DSM-5 siehe Friedman et al. 2011b; Friedman, Keane, & Resick, 2014; Friedman, Resick, Bryant & Brewin, 2011a; Kapfhammer, 2014; Weathers, 2017; Wittchen, Heinig, & Beesdo-Baum, 2014).
Gründe für die Herauslösung aus dem Kapitel der Angststörungen. Ätiologische Überlegungen werden bei der Klassifikation der Störungen im DSM in der Regel ausgeklammert, um sich auf eine spezifische Symptombeschreibung zu beschränken. Doch gerade bei den traumata– und belastungsbezogenen Störungen ist die ätiologische Komponente zwingend notwendig. Auch im DSM-5 wird die Posttraumatische Belastungsstörung, sowie auch alle anderen Traumastörungen, als Symptomkomplex in Folge der Exposition einer oder mehrerer traumatischer Ereignisse aufgefasst.
Werden nur die Symptome betrachtet, ergeben sich vielfältige Überlappungen mit anderen Syndromen. So finden sich Symptome des Hyperarousals (Schlaflosigkeit, Konzentrationsschwäche und gesteigerte Schreckhaftigkeit) auch bei allgemeinen Angsterkrankungen. Physiologische Erregungszustände, Derealisation und Depersonalisation finden sich auch bei den Panikstörungen, persistierende, intrusive Gedanken zeigen sich auch bei der Zwangsstörung, der Depression, der generalisierten Angststörung und der Panikstörung (Friedman et al. 2011b).
Die DSM-5 Arbeitsgruppe stellt zurecht die Annahme einer Angstkonditionierung als Grundlage der Erkrankung in Frage. Bei erfolgter Angstkonditionierung zeigt sich oftmals ein spezifisches Muster neuronaler Erregung zwischen den Mandelkernen, dem medialen Präfrontalkortex und Kortex Insularis bei erhöhter Reaktivität der Mandelkerne (Duvarci u. Pare 2014; Janak u. Tye 2015). Bei Patienten mit PTBS, insbesondere bei jenen mit dissoziativen Symptomen wie Depersonalisierung und Derealisierung, zeigt sich hingegen eine reduzierte Reaktivität der Mandelkerne (Lanius et al. 2010). Anders als bei möglichen assoziativen Furcht- und Angstlernprozessen empfinden Patienten mit PTBS oftmals auch Scham, Schuld und/oder Ärger, so dass die Störung bereits in ihrer Konstruktion über das Bild der Angsterkrankung hinausgeht.
Diagnostik der posttraumatischen Belastungsstörung nach DSM-5. Die Diagnostik der Posttraumatischen Belastungsstörung im DSM-5 unterscheidet zwischen einem ätiologischen Kriterium (A), vier Symptomgruppe (B–E), einem zeitlichen Kriterium (F), einem Kriterium subjektiver Belastung (G) und einem Kriterium zum Ausschluss der Symptome als Folge anderer Erkrankungen oder von Substanzmissbrauch (H). Darüber hinaus können dissoziatives Erleben und ein verspäteter Symptombeginn spezifiziert werden (siehe Tabelle 2).
Kriterium (A): Ein traumatisches Ereignis – bspw. die Bedrohung mit dem Tod oder schwerer Verletzung und sexuelle Gewalt – muss direkt selbst erlebt oder direkt bezeugt werden. Von einem derartigen Erlebnis zu erfahren, wenn es Familienmitgliedern oder Freunden widerfuhr, kann ebenfalls auslösendes Momentum sein. Neu ist, dass nur ein objektives ätiologisches Kriterium der Traumaexposition gefordert wird. Bislang war für eine Diagnose nach DSM zusätzlich eine intensive emotionale Reaktion in Form von Angst, Hilflosigkeit und Entsetzten notwendig. Dieses subjektive ätiologische Kriterium war bereits Bestandteil des Kriterienkataloges des DSM-III und wurde im DSM-IV gar zur notwendigen Voraussetzung einer Diagnose. Allerdings zeigte sich, dass emotionale Reaktionen wie Ärger und Scham den gleichen prädiktiven Wert eines späteren Auftretens einer PTBS aufweisen (Breslau u. Kessler 2001). Post-hoc-Studien belegen, dass bei gleichbleibender Symptombelastung und Schwere der Erkrankung rund 20 Prozent der Betroffenen das subjektive Kriterium der intensiven emotionalen Reaktion nicht zeigen (O‘Donnell, Creamer, McFarlane, Silove, & Bryant 2010). Das trifft insbesondere auf ausgebildete Fachkräfte wie Rettungsassistenten und Soldaten zu (Friedman et al. 2014, 45), sodass die Notwendigkeit der subjektiven Belastung für eine Diagnose zu einer strukturellen Benachteiligung dieser Gruppen führte.
Die Kriterien der Symptomgruppen wurden auf vier erweitert, nachdem man in faktorenanalytischen Untersuchungen fand, dass neben der im DSM-IV-TR beschriebenen Trias aus traumabezogenem intrusivem Wiedererinnern, Vermeidung und emotionaler Betäubung auch negative Veränderungen von Kognition und Stimmung wesentlich zur Syndromkonstruktion beitragen (Yufik u. Simms 2010). So umfassen die Symptomgruppen nun Intrusionen (B) als wiederkehrende und belastende Erinnerungen, Träume, Flashbacks oder Stressreaktionen auf internale oder externale Reize als Symbole oder Hinweise auf das im Kriterium (A) beschriebene Erleben. Das bisherige Kriterium der Vermeidung und Betäubung (Numbing) wurde unterteilt in eine passive Vermeidung (C) und Dysphorie (D), wobei letzteres um die häufig anzutreffende Selbstzuweisung von Schuld sowie die Gefühle der Unzulänglichkeit, Schwäche und negativen Zukunftsaussicht ergänzt wurde. Somit wurde hier die bereits erwähnte Erweiterung des emotionalen Erlebens um Zustände der Schuld, Scham und Ärger berücksichtigt. Im Symptomkomplex des Hyperarousal (E) steht im DSM-5 die Verhaltenskomponente im Vordergrund und auf eine Bestimmung emotionaler Zuständen wurde verzichtet. Dies trägt auch den Erkenntnissen Rechnung, dass aggressives Verhalten ein bona fide Symptom der Posttraumatischen Belastungsstörung ist (Elbogen et al. 2010). Der Komplex umfasst nun Schlaflosigkeit, Konzentrationsprobleme, Hypervigilanz und Schreckhaftigkeit sowie leichtsinniges und selbstverletzendes Verhalten. Alle Symptome müssen mindestens vier Wochen vorliegen (F), um eine spontane Selbstheilung zunächst zu ermöglichen.