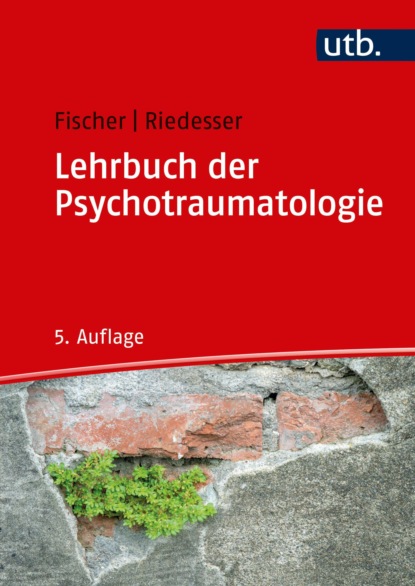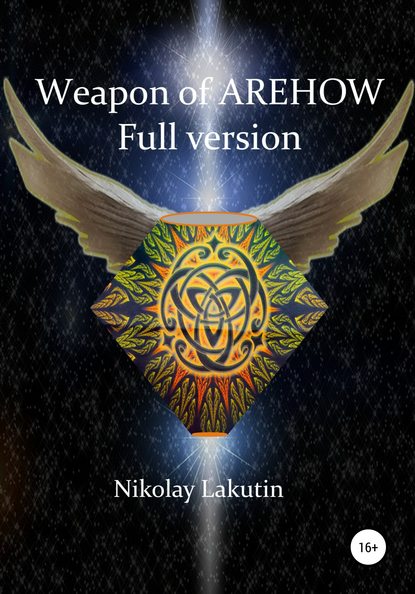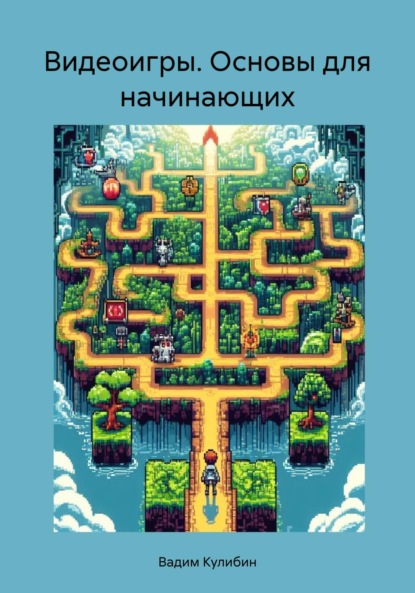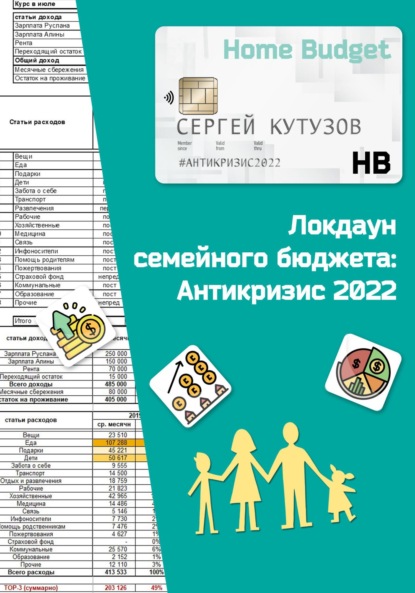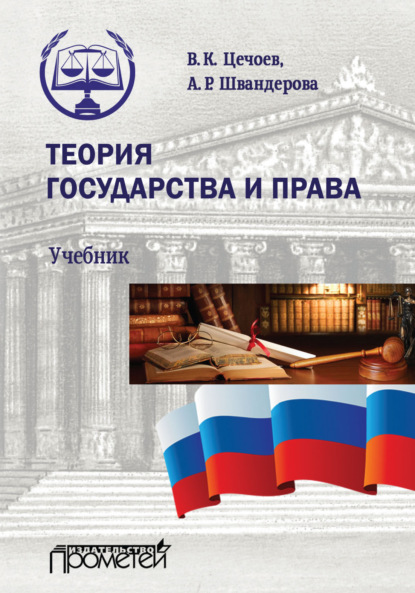- -
- 100%
- +
Der Begriff der „Situation“ hat in Psychologie, Philosophie und Soziologie deshalb Bedeutung gewonnen, weil er sich dazu eignet, objektive und subjektive Faktoren oder, methodologisch gesprochen, den objektiven und subjektiven Zugang zum menschlichen Erleben und Verhalten systematisch aufeinander zu beziehen. Gerade dieser Zwang, Objektivität und Subjektivität in ihrer wechselseitigen Verschränkung und → Dialektik zu sehen, macht den Situationsbegriff für die Psychotraumatologie interessant. Situationen bilden die minimale Beobachtungseinheit in den Sozialwissenschaften, die ohne Verzicht auf entscheidende Sinnbezüge nicht weiter unterschritten werden kann. So können wir als die elementare Beobachtungseinheit der Psychotraumatologie die traumatische Situation definieren. Wir werden uns im Folgenden mit einigen Konzeptualisierungen des Situationsbegriffs in Philosophie, Sozialwissenschaften und Psychologie befassen und uns von hier aus der Struktur traumatischer Situationen nähern.
Die entscheidende philosophische Vorarbeit zur begrifflichen Fassung von Situationen verdanken wir der phänomenologischen Tradition in Philosophie und Psychologie im Anschluss an die Arbeiten von Edmund Husserl (1969). Die meisten Autoren, die sich systematisch dieses Begriffs bedienen, bemühen sich um eine Thematisierung des Bezugs von Subjektivität und Objektivität, die über die traditionelle Fassung dieser Begriffe als Erkenntnisbegriffe hinausgeht und die realen lebensweltlichen Bedingungen des Handelns und der menschlichen Orientierung umfassen. Die gründliche Ausarbeitung eines Situationsmodells für die Soziologie von Arbeitssituationen verdanken wir Konrad Thomas (1969). Thomas definiert Situation als die „Einheit von Subjekt und Gegebenheit, bestimmbar durch das Thema, umgrenzt von einem Horizont“ (S. 60). Im Unterschied zu Situation, verwendet er den Begriff der „Lage“ für die objektiven, zunächst nur von außen bestimmbaren Faktoren, die in den Situationsbezug des Subjekts zwar eingehen, aber dennoch nicht in ihm aufgehen. In anderen Modellen wird dieser objektive Aspekt auch Umgebung oder Außenwelt genannt, während z. B. im Situationskreismodell nach Thure von Uexküll „Umwelt“ die schon auf das Subjekt bezogene, vom Subjekt erfahrene Umgebung oder Außenwelt bezeichnet. In einer dialektischen Fassung des Situationsbegriffs sind Situationsfaktoren immer schon auf das erlebende und handelnde Subjekt bezogen. D. h. eine → Situationsanalyse erfasst die objektiven Lagebestimmungen in der Perspektive des handelnden und sich orientierenden Subjekts. Das Subjekt andererseits befindet sich in einer Situation, d. h., es ist selbst ein integrativer Bestandteil derselben, nicht ein abgegrenztes Element oder Subsystem, das sich einer Situation „gegenüber“ befindet. Wenn ich also das Verhalten und Erleben eines Subjekts verstehen will, so muss ich es immer „situiert“ (ein Ausdruck, den Sartre häufig verwendet hat) verstehen.
Ein Irrweg in der Situationsanalyse ist die voreilige Psychologisierung des subjektiven Situationsmoments. Wenn wir z. B. sagen, jemand „fühlt sich traumatisiert“, so bleibt dieses Erleben so lange unverständlich, wie wir es nicht im Kontext der entsprechenden Erlebnissituation verstehen und analysieren. Die Dialektik im situationstheoretischen Denken erfordert Begriffe, in denen Subjektivität und Objektivität als aufeinander bezogene Größen gefasst werden. Ein solcher Begriff ist bei Thomas das Konzept der situativen Gegebenheiten. Gegebenheiten sind Situationsfaktoren, so wie sie sich für ein erlebendes und handelndes Subjekt, also auch vermittelt durch dessen Erfahrungsschemata darstellen. Gegebenheiten sind andererseits für einen außenstehenden Beobachter beispielsweise auch die Schemata des Subjekts selbst, mit Hilfe derer es seine Erfahrung organisiert.
Situationen sind bestimmbar durch ihr jeweiliges Thema. In einer therapeutischen Situation z. B. werden andere Dinge thematisch als in einer alltäglichen Unterredung zwischen Freunden oder nahen Bekannten. Das Thema verbindet sich also eng mit den sozialen Rahmenbedingungen. Diese unterliegen einem mehr oder weniger hohen Grad an sozialer Normierung und Standardisierung. In der Psychotherapie beispielsweise haben wir es im Allgemeinen mit einer hochstandardisierten Interaktionssituation zu tun. In Anlehnung an Konzepte der „kognitiven Psychologie“ wurde neuerdings die Normierung und Standardisierung von Situationen mit dem Begriff des Scripts bezeichnet (für die kognitive Psychologie z. B. Rumelhart; zum Situationsbegriff Schott 1991, 135 ff). Script ist eine Metapher, die ursprünglich aus der Filmsprache stammt. Einer Szene in einem Film liegt ein Drehbuch zugrunde. Dieses besteht aus einem Script, das die Schauspieler und der Regisseur in Handlung umsetzen. Das Konzept erscheint uns für die Situationsanalyse deshalb geeignet zu sein, weil es objektiv standardisierte und subjektive Elemente umfasst, die in konkreten Situationen miteinander verwoben sind. Nach Lindsay und Norman (1981) enthält ein Script drei Arten von Handlungsabläufen:
1.Kulturell normierte Abläufe.
2.Situativ gesteuerte, d. h. durch die gegenseitigen Erwartungen der Interaktionspartner bestimmte Abläufe.
3.Personengesteuerte Handlungsabläufe, die sich auf die beteiligten Persönlichkeiten und ihre individuelle Biographie zurückführen lassen.
Am Beispiel einer Arztvisite weist das Drehbuch unter 1 hochgradig ritualisierte Handlungsabläufe auf. Gleichzeitig gehen aber auch die gegenseitigen Erwartungen jeweils von Arzt und Patient in die Handlungssequenz ein und wenn man die Analyse genau genug betreibt, lässt sich auch eine personengesteuerte Dramaturgie in ihnen entdecken, die über die jeweilige Interaktionssituation hinausreicht in die Biographie der Handelnden hinein. Auch hier können vor allem bei interaktionsgestörten Persönlichkeiten hochgradig ritualisierte Abläufe entdeckt werden, wie auch der Scriptbegriff bei Eric Berne in „Spiele der Erwachsenen“ zeigt (1964). „Script“ bezeichnet bei Berne den unbewussten Lebensentwurf einer Person, ein „Drehbuch“, das die verschiedenen Szenen und Situationsfolgen eines ganzen Lebenslaufes bestimmen kann. Situationen sind umgrenzte Einheiten von Erleben, Verhalten und sozialer Interaktion, die zwar auseinander hervorgehen und ineinander übergehen können, sich aber durch eine Grenze voneinander unterscheiden. Für die Bezeichnung dieser Grenze zwischen Situationsfolgen schlägt Thomas (1969) den Begriff des Horizonts vor. Die Horizont-Metapher entstammt der phänomenologischen Tradition von Edmund Husserl und entspringt der räumlichen Erfahrung, beispielsweise der eines Wanderers. Eine Situation ist demnach begrenzt von dem Erlebnishorizont dessen, der sich in ihr befindet. Es ist aber immer auch möglich, diesen Horizont zu „erweitern“, die Situation zu „überschreiten“ und sie dadurch zu verändern.
Dieses Überschreiten einer Situation auf eine künftige Lösung und Weiterentwicklung hin, ist Bestandteil des Situationsmodells von Thomas. Ist es ausgeschlossen, den Horizont einer Situation zu überschreiten, sie auf einen Zukunftsentwurf hin zu verändern, so geraten wir bereits in die Sphäre pathogener, möglicherweise sogar traumatischer Situationen, da das menschliche Weltverhältnis auf die Veränderung negativer Situationsfaktoren hin angelegt ist. Auch das „Thema“ der Situation hat objektive und je persönliche Aspekte. Das Thema einer psychotherapeutischen Situation beispielsweise bilden Erleben und Verhalten des Patienten. Ebenso können aber auch die therapeutische Beziehung und das Erleben oder Verhalten des Therapeuten zum Thema werden. Das Situationsthema ist also zunächst vorgegeben, durch reflexive Thematisierung des in der Situation Thematischen kann sich eine Situation jedoch weiterentwickeln. Ein Wechsel des Themas führt oft schon einen Wechsel der Situation herbei, so etwa, wenn in einer traditionellen Vorlesungsveranstaltung eine hochschulpolitische Diskussion gefordert wird und dann auch stattfindet. Der Übergang vom vorgegebenen Thema zur „Thematisierung“ der Situation entspricht dem Übergang von Kommunikation zur Meta-Kommunikation. Dieses meta-kommunikative Überschreiten vorgegebener Situationsthemen gehört zum „offenen Horizont“der einer gelingenden Situationsgestalt normalerweise eignet. Umgekehrt sind der Verlust des „offenen Horizonts“ und die Unmöglichkeit von Meta-Kommunikation charakteristische Merkmale potenziell traumatischer Situationen.
Wenn wir nun versuchen, das Situationskonzept für die Analyse traumatischer Situationen heranzuziehen, so müssen wir zunächst einmal der Forderung nach „Einheit von Subjekt und Gegebenheiten“ Rechnung tragen. Dies bedeutet, dass wir die objektiven Lagebestimmungen einer traumatischen Situation als „Situationsfaktoren“ fassen müssen, d. h. in der Weise, wie sie sich für das erlebende und handelnde Subjekt in dieser „traumatischen Situation“ darstellen. Eine Beschreibung traumatischer Lagefaktoren an sich, d. h. ohne Bezug auf ein erlebendes Subjekt, wäre in der Psychotraumatologie ein sinnloses Unternehmen. Zwar ist es möglich, subjektive und objektive Aspekte der traumatischen Situation getrennt darzustellen, wie wir dies in den folgenden Kapiteln versuchen werden. Für die Grundlagen einer allgemeinen Psychotraumatologie jedoch muss die Klammer des Situationsbezuges stets erhalten bleiben. Nur so wird es möglich, Situationen wirklich zu erfassen. Das Gleiche gilt umgekehrt für die Untersuchung der Strukturen und Funktionen des erlebenden und sich verhaltenden Subjekts. Auch hier ist es möglich, das Erleben des Subjekts getrennt zu thematisieren, z. B. eine Analyse der traumatischen Reaktion als solcher vorzunehmen, etwa unter physiologischen Aspekten. Wir können traumatische Erlebnisreaktionen beschreiben, müssen uns dabei jedoch bewusst sein, dass hier eine Abstraktion vorliegt, die unserer Begrifflichkeit entstammt und nicht der realen Verfassung unseres Gegenstandes. „Nichtsituierte“ oder „desituierte“ Subjekte sind Abstraktionen, die lediglich zu Darstellungszwecken vorübergehend gerechtfertigt erscheinen. Sobald eine solche Abstraktion in ihrer Bedeutung für das reale Leben verstanden werden soll, ist es notwendig, sie zu resituieren, d. h., sie wieder in den konstitutiven Situationsbezug erlebender und handelnder Subjekte einzufügen.
Wir wollen dieses Prinzip der Resituierung unserer Begrifflichkeit am Beispiel des Syndroms der allgemeinen Psychotraumatologie, des bPTBS darstellen. Es stellt eine Abstraktion dar, die für die Beschreibung häufig zu erwartender kurz- und langfristiger Reaktionen auf traumatische Situationen von begrenztem Nutzen ist. Wir dürfen diese Abstraktion jedoch nicht mit der Wirklichkeit erlebender und handelnder Subjekte verwechseln. Diese erleben stets eine bestimmte traumatische Situation in ihrer historischen und individuellen Besonderheit. Die Reaktion auf diese traumatische Erfahrung, der Versuch, die traumatische Situation zu überschreiten, ist immer geprägt durch diese individuelle und historisch spezifische Situationserfahrung. Und nur wenn wir in einer Untersuchung dieser situativen Besonderheit auch gerecht werden, können wir erwarten, die erforderlichen psychotraumatologischen Verständnisrahmen erreicht zu haben. Abstraktionen wie das PTBS können hierbei behilflich sein, sie können aber auch, de-situiert verstanden, die Verständnisbemühungen abschneiden und irreleiten.
Wir kommen hier auf das Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung zurück. Nur in solch einer integrativen Verlaufskonzeption lässt sich verhindern, was traditionell bisher häufig geschehen ist, dass traumatische Reaktionen, die im Situationserleben fundiert sind, von diesem Situationsbezug abgelöst und in eine Eigenschaft der traumatisierten Subjekte umgebogen werden. Weite Bereiche der traditionellen Psychopathologie müssen in der beschriebenen Weise „resituiert“ werden. Nur so lässt sich langfristig entscheiden, welche psychopathologischen Symptome auf traumatische Situationserfahrungen zurückgeführt werden müssen. In diesem Sinne kann die Rückverwandlung von Psychopathologie in Psychotraumatologie als ein programmatisches Ziel verstanden werden.
Wir werden im Folgenden einige Konzepte entwickeln, die bei der Analyse traumatischer Situationen von Nutzen sind. Beide Untersuchungsrichtungen, die objektive und die subjektive, sind zwar aufeinander bezogen, sie sind aber nicht durch einander ersetzbar. Methodisch sollte die objektive Situationsanalyse zeitlich vor der subjektiven erfolgen. Hier fragen wir nach objektiven, potenziell traumatischen Situationsfaktoren. Bei Desastern menschlichen Ursprungs und den oft über lange Zeit sich hinziehenden Beziehungstraumen muss die objektive Situationsanalyse vor allem nach solchen Strukturen und Beziehungsformen suchen, die den offenen Horizont der Situation eliminieren und geschlossene Situationen schaffen. Bei Gewaltverbrechen ist die Ausweglosigkeit offensichtlich gegeben. Bei Beziehungstraumen, etwa vom Typus des → Double-Bind ist dieses Kriterium weniger offensichtlich. Dennoch lassen sich bei eingehender Untersuchung die kommunikativen Mittel rekonstruieren, die eine analoge Auswegslosigkeit erzielen, indem z. B. → Metakommunikation verhindert, Einflussnahme verschleiert wird usf.
Ein häufig eingesetztes Mittel, um eine künstliche Schließung der Situation zu erreichen, ist die Verwirrung kognitiver Kategorien. Wir wollen diesen Mechanismus als → Orientierungstrauma bezeichnen (vgl. Abschnitt 3.1.1). Klassisches Beispiel ist das Double-Bind. Die Verwirrung kognitiver Kategorien im Double-Bind ist bei Fischer (1986a) genauer analysiert im Hinblick auf die Entstehung von Charakterstörungen und selbstschädigendem, parasuizidalem Verhalten. Die → Double-Bind-Situation bildet einen Prototyp des Orientierungstraumas, nicht aber seine einzige Form. In manchen Familien sind Beziehungsmuster mit ihren über Generationen hinweg tradierten Scripts und deren situativer Reinszenierung so verwirrend, dass den Opfern solcher Beziehungsfallen kaum noch wirksame Handlungsmöglichkeiten bleiben. Ziel der objektiven Situationsanalyse ist es hier, die Situationsstrukturen herauszuarbeiten, das zentrale Thema der Situation, die situativen Gegebenheiten, situations- und kulturgesteuerte Scripts, die Kontextbedingungen usf.
Dieser objektiven Untersuchungsrichtung steht die subjektive Situationsanalyse gegenüber. Hier ist zunächst darauf zu achten, welche der objektiv vorhandenen Reaktionsmöglichkeiten ein Individuum tatsächlich wahrnimmt. Von dem Hintergrund der objektiven Situationsstrukturen heben sich jene subjektiven Wahrnehmungs- und Reaktionsweisen ab, mit denen das Subjekt versucht, die potenziell traumatische Situation zu überschreiten. Ergänzen wir hier die objektive Situations- und Script-Analyse durch die subjektive Untersuchungsrichtung, so nähern wir uns dem zentralen Untersuchungsgegenstand, dem Verständnis nämlich für das Zusammenspiel von subjektiven und objektiven Komponenten der traumatischen Situation.
Als Hilfsmittel bieten sich Konzepte an, die wir als Vermittlungsgrößen zwischen dem objektiven und dem subjektiven Moment kennen gelernt haben, wie beispielsweise das „Thema“. Es kann jetzt in seiner objektiven und subjektiven Bedeutung genauer untersucht werden. Nehmen wir das Fallbeispiel des Autofahrers aus Abschnitt 1.4, der durch ein besonders geschicktes Ausweichmanöver einen tödlichen Unfall vermeiden kann, jedoch noch lange nach dem Unfall unter den psychischen Folgen der Traumatisierung leidet. Die traumatogene Situation ist thematisch zunächst dadurch bestimmt, dass Herr R. sich auf einer ganz alltäglichen Autofahrt befindet, um einen seiner Kunden zu besuchen und ihn zu beraten. Mit einer Behinderung in diesem gewohnten Tagesablauf rechnet er nicht. Wie aus dem Nichts kommt durch das Fehlverhalten eines Verkehrsteilnehmers die Todesdrohung auf ihn zu. Wir haben den konkreten Ablauf der Ereignisse ausführlich geschildert. Welches nun sind die für die Traumaverarbeitung entscheidenden Situationselemente? Von der objektiven Seite her mag eine Rolle spielen, dass der Unfallverursacher sich in Panik befand und unfähig war, einem Zusammenstoß auszuweichen, sich hinterher jedoch seinem Retter gegenüber anscheinend in keiner Weise dankbar oder auch nur konziliant verhielt. Beim zeitlichen Verlauf der traumatischen Situation berücksichtigt werden muss auch die mangelnde soziale Anerkennung durch die mit dem Unfall befassten Instanzen, wie beispielsweise die Versicherung des Unfallverursachers.
Wir werden in einem späteren Kapitel das Trauma als eine systematische Diskrepanz zwischen subjektiven und objektiven Situationskomponenten definieren. Hier können wir vorwegnehmen, dass diese Diskrepanz sich in der Interferenz von objektivem und subjektivem Situationsthema am deutlichsten zeigt. Das subjektive Situationsthema ist u. a. dadurch bestimmt, dass Herr R. sich ohne eigenes Zutun und außerhalb seiner Kontrollmöglichkeiten einer Lebensbedrohung ausgesetzt sieht. Er sieht in den kritischen Sekundenbruchteilen seinen Lebensfilm vor Augen, was die Vermutung nahe legt, dass er sich innerlich bereits auf das Lebensende vorbereitete. Vielleicht lag die Möglichkeit des Sterbens seinem bisherigen, sehr aktiven Lebenskonzept besonders fern, was das Diskrepanzerlebnis in der tödlichen Bedrohung noch weiter verschärft haben mag.
Das objektive „Script“, das Drehbuch sozialtypischer Abläufe nach einem lebensbedrohlichen Verkehrsunfall, das die gegenseitige Erwartung der Beteiligten regelt, erfordert den Ausgleich mit dem Unfallgegner, vielleicht die Anerkenntnis von Schuld, primär wohl persönlich-zwischenmenschlich, nicht in erster Linie bestimmt von Versicherungen und deren besonderer Interessenlage. Herr R. erwartet sicherlich mit einiger Berechtigung eine solche Regelung. Sie findet weder persönlich statt noch institutionell. So erlebt er ein scharfes Missverhältnis zwischen den objektiven Situationsfaktoren und seinen persönlichen Erwartungen. Dieses Ergebnis einer Interferenz von objektiven Situationsfaktoren und subjektiven Erwartungen be-zeichnen wir als das „zentrale traumatische Situationsthema“ (ZTST). In diesem Themenkomplex greifen beide Faktorengruppen so ineinander, dass es zu einer → maximalen Interferenz zwischen subjektiven (schematisierten) Erwartungen und objektiven Gegebenheiten kommt, bildlich gesprochen zu einer Blockierung der psychischen Informationsverarbeitung oder auch zu einem Bruch von Strukturen des psychischen Netzwerks.
Das ZTST muss nun zum einen aktualgenetisch, aus dem momentanen Situationsverlauf heraus, erfasst werden, zum anderen in seiner lebensgeschichtlichen Bedeutung und Genese. Aktualgenetisch könnte es bei dem Unfallpatienten etwa so umschrieben werden: „Ich wurde unvorbereitet, durch fremdes Verschulden und ohne eigenes Zutun, aus einem sehr aktiven Leben heraus mit dem Tod konfrontiert. Es gab keine (genügende) Hilfestellung bei meiner inneren Auseinandersetzung mit dem Geschehen. Alle Bemühungen, mein bisher aktives und selbstbestimmtes Leben fortzuführen, scheitern an meiner Krankheit und der Verweigerung von Hilfe“.
Verfolgen wir das ZTST in der lebensgeschichtlichen Richtung weiter, so stoßen wir auf die Kindheitserinnerung an eine Bombennacht während des zweiten Weltkriegs, als Herr M. mit seiner Mutter vor dem Angriff zu fliehen versuchte und dabei auf brennende Häuser, Verwundete und Tote stieß. Auch im „Lebensfilm“ waren die Kriegsszenen an erster Stelle aufgetaucht. Vieles spricht dafür, dass Herr M. mit seinem besonders aktiven Lebensstil bemüht war, dieser früh erfahrenen Unsicherheit und Bedrohung des Lebens seine energische Fürsorge für das materielle Wohl und die Sicherheit der Familie entgegenzusetzen. Genau dieser kompensatorische Lebensentwurf wird durch den Unfall außer Kraft gesetzt. Seine berufliche Tätigkeit, die Sicherheit und Schutz garantieren soll, wird zum Instrument eines grausamen „Schicksals“, das ihn mit einem Schlag in die frühe → Hilflosigkeit und Todesgefahr zurückwirft. Die beruflich bedingte Autofahrt, welche Wohlstand und Sicherheit weiter festigen und so vor der früh erlebten Not des Krieges schützen soll, wird ihrerseits zum Vehikel einer existenziellen Bedrohung. Hier „verhakt“ sich also das auf kompensatorische Sicherheit ausgerichtete „Lebensthema“ in fataler Weise mit dem gegenwärtigen Situationserleben. Das ZTST entspricht diesem Punkt einer maximalen Interferenz von subjektiven und objektiven Situationsfaktoren. Besonders zerstörerisch wirkt es sich aus, wenn durch die oft zufällige situative Konstellation das Subjekt in seinen zentralen kompensatorischen Bemühungen und/oder seinem Weltentwurf getroffen wird. Da diese kompensatorischen Mechanismen oft schon aufgebaut wurden, um früheren (potenziell) traumatischen Situationen zu begegnen, lebt mit dem Bruch des → traumakompensatorischen Schemas und der neuen Bedrohung zugleich die alte Bedrohung wieder auf. In lebensgeschichtlicher Betrachtung bildet das ZTST einen dynamischen Kristallisationspunkt, in dem sich vergangene und gegenwärtige traumatische Erfahrungen verbinden und bisweilen unheilvoll potenzieren können. Die lebensgeschichtliche Kontinuität lässt sich oft auch in der subjektiven Traumaerfahrung feststellen, im Informationsvorrat des → Traumaschemas. So wird im „Lebensfilm“ sogleich die Verbindung zwischen der frühen und der jetzigen Traumaerfahrung hergestellt mit der Erinnerung an die Bombennacht. Das frühe → Schema „assimiliert“ die gegenwärtige Erfahrung, was dem aktuellen Geschehen eine besondere Brisanz verleiht.
Lindy (1993) berichtet von einem Vietnamveteranen, der jahrelang unter einem schweren psychotraumatischen Belastungssyndrom litt. Er war ursprünglich vom positiven Zweck des Krieges überzeugt gewesen und sah seinen Einsatz als Verteidigung von unterdrückten und hilflosen Minoritäten. Der Schutz für Schwache und Hilflose zählt zu der persönlichen Werthaltung, die er sich schon früh in der Lebensgeschichte zu eigen gemacht hatte. Mehrfach wurde er Zeuge von Strafexekutionen in Dörfern von Partisanen.
Eines Tages entdeckte er unter den Exekutierten die Leiche eines vietnamesischen Jungen, mit dem er sich vor einiger Zeit angefreundet hatte. Er wusste, dass der Junge und seine Familie keineswegs „Partisanen“ waren, sondern Sympathisanten der Amerikaner. Dennoch musste er feststellen, dass die Exekution von der amerikanischen Armee durchgeführt worden war. Er verlor den Glauben an die Gerechtigkeit des Krieges, fühlte sich von der Armeeführung getäuscht und musste letztlich auch sich selbst als mitschuldig an der Vernichtung seines jungen Freundes und anderer unschuldiger Zivilisten betrachten. In der späteren Psychotherapie stellte sich die Konfrontation mit der Leiche des befreundeten Jungen als zentrales traumatogenes Erlebnis heraus. Lindy (1993) spricht von „traumaspecific meaning“ und meint damit die subjektive, ganz persönliche Bedeutung, die eine traumatische Situationskonstellation gewinnt. Diese Fallskizze können wir auch in der Begrifflichkeit des ZTST verstehen, wenn wir nämlich annehmen, dass der Schutz von Schwachen und Hilfsbedürftigen eine kompensatorische, ev. sogar traumakompensatorische Funktion für den Veteranen hatte. Jedenfalls war diese Haltung ein zentraler Bestandteil seines Selbstkonzepts gewesen. Sie war auch ein wichtiges Motiv, sich an einem „gerechten“ Krieg zu beteiligen. Nun wurde er selbst zum Mörder seiner Schutzbefohlenen, gerade in Verfolgung seiner durchaus altruistischen Motive. Solch „tragische“ Verwicklungen und eine paradoxe Gegenläufigkeit von Absicht und Handlung entsprechen oft der Struktur des zentralen traumatischen Situationsthemas.
Im Folgenden wollen wir uns mit einem weiteren situationstheoretischen Konzept befassen, das beim Verständnis der traumatischen Situation hilfreich sein kann, der Singularität versus Generalität von Situationen. In der Literatur findet sich häufig die Bemerkung, dass traumatisierte Personen dazu neigen, ihre Erfahrung und damit die traumatische Situation zu stark zu „generalisieren“, also in unangemessener Weise zu verallgemeinern. In der äußerlichen, objektiven Betrachtungsweise trifft diese Beobachtung ganz offensichtlich zu. Manche Traumapatienten verhalten sich so, als könnte die traumatische Situation sich jederzeit wiederholen. Dies geschieht allerdings auf der Ebene unbewusster Informationsverarbeitung. Herr R. z.B. kann deshalb nicht mehr mit dem Auto fahren, weil er auf der Ebene vorbewusster oder unbewusster → Kognitionen und daran gekoppelter physiologischer Reaktionsmuster die ständige Wiederholung des Unfalls erwartet. Es liegt in der Natur der so genannten phobischen Reaktion, dass eine bestimmte Reizkonfiguration übermäßig verallgemeinert und dann übertragen wird auf Situationen, die objektiv, von außen betrachtet in keinem Zusammenhang mit der traumatischen Erfahrung stehen. Für einen außenstehenden Beobachter ist diese Feststellung leicht zu treffen. Wie aber erkennt das betroffene Subjekt selbst den Unterschied zwischen einer Situation der Sicherheit und der Bedrohung? Wo endet der eine Situationstypus, wo beginnt der andere, und welche Kriterien entwickeln Betroffene für eine solche Unterscheidung?