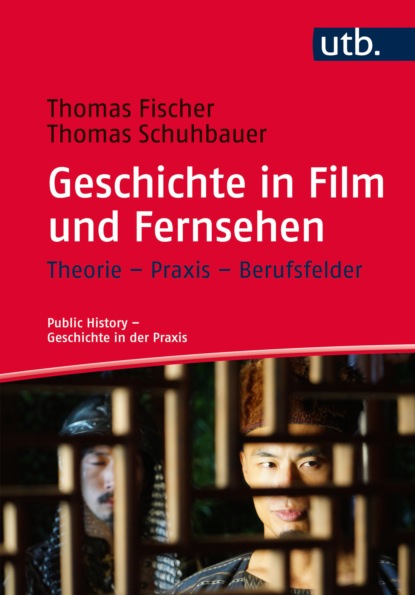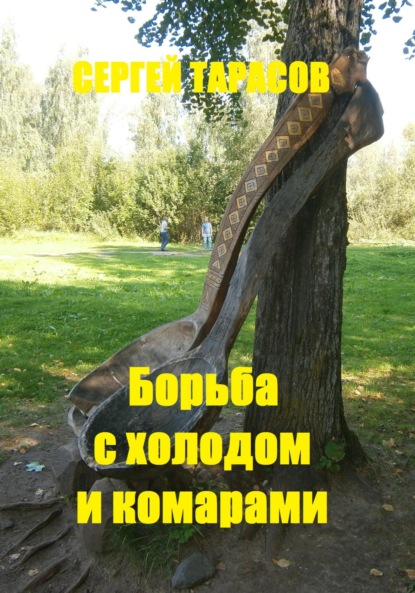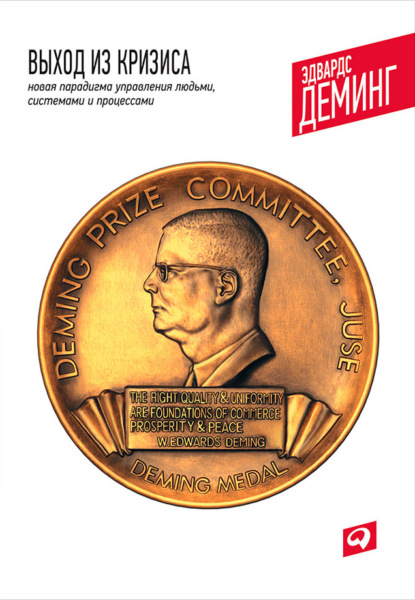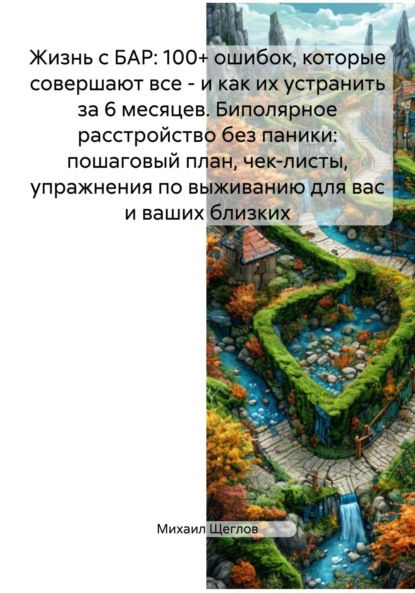- -
- 100%
- +

Thomas Fischer / Thomas Schuhbauer
Geschichte in Film und Fernsehen
Theorie – Praxis – Berufsfelder
A. Francke Verlag Tübingen
A. Francke Verlag Tübingen
Wer sich für Geschichte in Film und Fernsehen interessiert, kann das aus zwei Gründen tun. Er möchte entweder selber Geschichten in diesen Medien erzählen und deshalb wissen, welches Handwerkszeug man dazu braucht und wie man es verwendet. Oder er will Filme und Fernsehsendungen analysieren, um anderen darüber zu berichten, wie audiovisuelle Massenmedien Geschichten aus der Vergangenheit aufzeichnen, verarbeiten, speichern und vermitteln. Dieses Buch will beiden Interessentengruppen etwas bieten: Den Studierenden, die sich für die Medienpraxis interessieren, weil sie vielleicht einmal Journalist, Filmautor, FernsehredakteurRedakteur, RechercheurRecherche, Rechercheur, Requisiteur, Kostümbildner oder Produzent werden wollen. Und den anderen, die sich vielleicht einmal in der Schule, im Museums- und Ausstellungsbereich oder in der Wissenschaft mit Geschichtsfilmen beschäftigen werden und die an Erzähltheorie und Filmanalyse, ihren Begriffen und Methoden interessiert sind, um den Gegenstand ‚Geschichtsfilm‘ anderen besser vermitteln zu können.
Entsprechend ist dieses Buch zweigeteilt: Im ersten Teil werden die Grundlagen für die Beschreibung und Analyse von Geschichtsfilmen gelegt, während im zweiten Teil dargestellt wird, wie Geschichtsfilme gemacht werden. Der erste Teil ist notwendigerweise analytischer ausgerichtet und stärker von abstrakten Begriffen durchzogen als der zweite. Er schlägt eine sinnvolle Typisierung von Geschichtsfilmen vor und bietet den Lesern passende Werkzeuge sowie Kriterien zu deren Analyse an. Im zweiten, mehr praktisch ausgerichteten Teil wird dann die Nützlichkeit der Instrumente zur Herstellung von Geschichtsfilmen geprüft. Die Leser erhalten dabei Einblick in die Arbeitswelt der Geschichtsfilmproduzenten und können sich über mögliche Berufswege im Film- und Fernsehgeschäft informieren.
Der erste Teil (Autor: Thomas Fischer) beginnt mit einem Überblick über die Wissenschaftsbereiche, die sich mit Geschichte in Film und Fernsehen befassen. Es geht dabei um die wichtigsten Ergebnisse und die aktuellen Forschungstrends, ihre Fragestellungen und Methoden. In den anschließenden Kapiteln werden Grundfragen des audiovisuellen historischen Erzählens behandelt. Zunächst wird unter dem Aspekt der audiovisuellen Darstellbarkeit von geschichtlichen Lebenswelten in Film und Fernsehen das Verhältnis von tatsächlicher und erzählter Lebenswelt diskutiert (→ Kap. 2). Anschließend geht es um die Frage, wie sich die vergangene tatsächliche Welt in audiovisuellen Erzählungen darstellen lässt. Hier werden zwei Erzählweisen voneinander unterschieden: Der szenische [2]Geschichtsfilm und der dokumentarische Geschichtsfilm. Darüber hinaus wird unter dem Aspekt der erzählten Zeit zwischen HistorienfilmenHistorienfilme und ErinnerungsfilmenErinnerungsfilme getrennt (→ Kap. 2.1). Es folgt ein Kapitel über das Kino, in dem Erzählanordnungen, Reichweiten, Programme und die Erinnerungsfunktion des Kinos dargestellt werden (→ Kap. 2.2). Daran schließt sich die Darstellung und Untersuchung der zwei Haupttypen des Geschichtsfilms an, die ursprünglich zum Kino gehören: der szenische Historienfilm (→ Kap. 2.2.1) und der szenische Erinnerungsfilm (→ 2.2.2). Nach dem Kino geht es um das Fernsehen. Zunächst werden auch hier Erzählanordnungen, Reichweiten, Programme und Erinnerungsfunktionen des Mediums analysiert (→ Kap. 2.3). Anschließend untersuchen wir die zwei Haupttypen des Geschichtsfilms, die ihrer Erzählweise nach zum Fernsehen gehören: die dokumentarischen Erinnerungsfilme (→ Kap. 2.3.1) und die dokumentarischen Historienfilme (→ Kap. 2.3.2).
Nach den analytischen und systematischen Überlegungen zu den Typen und Darstellungsformen des Geschichtsfilms werden wir am Ende von Teil eins noch auf außerfilmische Themen zu sprechen kommen: Zum einen geht es um Geschichtsfilm und Öffentlichkeit. Hier wird auf Pressekampagnen, plurimediale Aushandlungsdebatten, Erinnerungsdiskurse, Vermarktungsstrategien, Verwertungsketten eingegangen, also auf die außerfilmischen Prozesse, die vor und nach einem Filmstart ablaufen (→ Kap. 2.4). Zum anderen gehen wir auf das Thema Geschichtsfilm und Geschichtswissenschaft ein. Hier interessieren uns vor allem die Fragen, welche unterschiedlichen Haltungen Filmemacher und Wissenschaftler in Bezug auf Geschichte einnehmen und wie sie sich in den Darstellungsweisen voneinander unterscheiden. Wir möchten einige Vorschläge unterbreiten, wie die Wissenschaft Filme mehr als bisher als Quelle nutzen und welche Werkzeuge sie zur ihrer Analyse verwenden könnte (→ Kap. 2.5).
Im zweiten Teil des Buches (Autor: Thomas Schuhbauer) geht es um die Praxis des Geschichtenerzählens (→ Kap. 3). Als Massenmedien möchten Film und Fernsehen mit ihren Geschichtsfilmen möglichst viele Menschen erreichen, damit die eingesetzten finanziellen Mittel ihren Zweck erfüllen. Die Erzählungen müssen deshalb verständlich und spannend sein, sie müssen einen Informationswert besitzen, aber auch emotional anrühren, kurz: sie müssen vom Erzähler publikumswirksam erzählt werden. Für das große Geschichtsformat, den historischen Spielfilm, arbeiten in Deutschland meist große Produktionsfirmen. Spielfilme, die aufwendig historische Lebenswelten inszenieren und sichtbar machen, haben allein schon aufgrund ihrer szenischen Darstellungsform spezielle Produktionsbedingungen. Viel öfter als die teuren Spielfilme werden über das Jahr hinweg Geschichtsdokumentationen (45/52 Minuten) produziert. Hergestellt werden sie in ihrer übergroßen Mehrheit von auf ganz Deutschland verteilte Firmen, die sich auf Geschichtsfilme spezialisiert haben und meist im Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten arbeiten. Das führt uns in die Büros der Produzenten, [3]RedakteureRedakteur und Autoren. Sie handeln gemeinsam aus, welche Ideen das Zeug zum erfolgreichen Geschichtsfilm haben (→ Kap. 3.1). Der Produktionsprozess bringt zahlreiche Akteure ins Spiel: Autoren, Regisseure und Produzenten, die das Drehbuch ausarbeiten und mit den Redaktionen absprechen. Ist das DrehbuchDrehbuch genehmigt, kommen Produktionsleiter, Produktionsteams, Cutter, Sprecher, Komponisten u.v.m. hinzu. Sie alle fertigen als Team in einem hochkomplexen künstlerischen und technischen Prozess unter regelmäßiger Rücksprache mit dem Auftraggeber die einzelne Sendung (→ Kap. 3.2). Am Ende entscheidet über Erfolg oder Misserfolg eines Geschichtsfilms das Publikum. Der Erzähler muss sich mit dessen Wünschen und Erwartungen auseinandersetzen und seine Erzählung dramaturgisch so gestalten, dass das Publikum ‚dran‘ bleibt. Über allem steht jedoch die Glaubwürdigkeit. Mit ihr steht und fällt jede Geschichtssendung, die sich darauf beruft, dass alles, was sie erzählt, tatsächlich auch passiert ist (dokumentarischer Geschichtsfilm) bzw. so oder so ähnlich passiert sein könnte (szenischer Geschichtsfilm). Um diese Versprechen einzulösen, müssen vielfältige Gestaltungsprobleme gelöst werden (→ Kap. 3.3). Dazu gehören, besonders bei Dokumentationen, die Homogenisierung heterogener Erzählelemente (Neudrehs, Archivmaterial, ZeitzeugenZeitzeugen etc.), der Einbau eines Erzählers und die Verwendung von Spielszenen (→ Kap. 3.4). Im Anschluss an dieses Kapitel wird der lange Weg nachgezeichnet, den die Geschichtssendungen von der Ausarbeitung eines Exposés, über die Vorlagen von Treatments und Drehbuchentwürfen, die Vor-Ort- und ArchivrecherchenRecherche, Rechercheur, die Dreharbeiten, SchnittSchnitt, PostproduktionPostproduktion, Bild- und Tonbearbeitung, Sprachaufnahmen, Abnahmen bis hin zur Sendung gehen (→ Kap. 3.5). Danach werden die Verwendung zahlreicher Bild-, Film- und Tondokumente aus den Archiven thematisiert, die recherchiert und lizensiert werden müssen (→ Kap. 3.6). Abgeschlossen wird dieser Teil mit zwei Kapiteln, die sich mit ZeitzeugenZeitzeugen (→ Kap. 3.7) sowie mit rechtlichen Fragen (→ Kap. 3.8) beschäftigen.
Abschließend werden zur Orientierung des Lesers die wichtigsten Berufsfelder vorgestellt, die mit Geschichte in Film und Fernsehen zu tun haben (→ Kap. 4).
In Kapitel 5 sind wertvolle Hinweise zu relevanten Ausbildungseinrichtungen, Studiengängen, Produktionsfirmen und Berufsverbänden aufgeführt.
Ein Literaturverzeichnis, eine Filmliste und ein Register sollen die Nutzung des Buches erleichtern und zur weiteren Auseinandersetzung mit dem Thema anregen (→ Kap. 6 und 7).
Eine Anmerkung zur Begrifflichkeit: Wenn von Leser, Regisseur, Produzent etc. die Rede ist, schließt diese Form sowohl die weiblichen als auch männlichen Akteure ein.
[4]1.1 Stand der Forschung
In diesem Buch geht es um ‚audiovisuelle Geschichte‘ in den Massenmedien Film und Fernsehen. Massenmedien sind öffentlichkeitsbezogen, weshalb auch audiovisuelle Geschichte immer auf eine breite öffentliche Wahrnehmung ausgerichtet ist (Public HistoryPublic History). Das bedingt, dass es sich bei ihr um allgemeinverständliche Geschichte handelt (Popular HistoryPopular History). Populärgeschichte verzichtet auf Fachbegriffe und wissenschaftliche Analysen. Ihr geht es um spannende Geschichten aus der Vergangenheit, sie ist zu allererst erzählte Geschichte. Erzählte Geschichte(n) in Film und Fernsehen knüpfen meist an historische Ereignisse an: konkrete Personen, Orte und Situationen stehen im Mittelpunkt. Audiovisuelle Geschichte ist also die populäre Erzählung von historischen Ereignissen im Medium Film und deren Verbreitung und Rezeption mittels Kino, Fernsehen und Internet.
Audiovisuelle Geschichte findet entweder als szenische Erzählung (Spielfilm) statt, die historische Ereignisse dramatisiert, oder als verbale Erzählung eines leibhaftigen oder unsichtbaren (Voice-OverVoice-Over) Erzählers, der die Geschichte mit Hilfe historischer Quellen darstellt (Dokumentation). Aus diesen zwei Grundtypen des audiovisuellen Erzählens entstehen dann vermehrt seit den 1980er Jahren verschiedene hybride ErzählformenHybride Erzählformen, die dokumentarisches und szenisches Erzählen vermischen (→ Kap. 2.1 und 2.3.1). Audiovisuelle Geschichte beginnt in dem Moment, in dem im Kinosaal der Projektor anläuft oder die Aufzeichnung beim Fernsehsender ‚abgefahren‘ wird und auf der Leinwand oder dem Bildschirm eine vergangene Lebenswelt sicht- und hörbar wird. Nur während ein Film läuft, wird er als Erzählung zu einem tatsächlichen audiovisuellen Ereignis – zu einer sich in Raum und Zeit entfaltenden filmischen Vergangenheitserzählung. Mit Beginn dieser Erzählung setzt beim Publikum ein komplexer Prozess der Wahrnehmung, Decodierung und Interpretation der sicht- und hörbaren filmsprachlichen Zeichen ein, in dessen Verlauf der Film sowohl als kollektive Erzählung rezipiert als auch mit den je individuellen Erfahrungen und Erinnerungen der Zuschauer und Zuhörer in Einklang gebracht wird. Erst im konstruktiven Zusammenwirken von Erzähler und Publikum wird die Erzählung soziale Realität und Teil der kollektiven Erzähl- und ErinnerungskulturErinnerungskultur. Das ist der Grund, warum sich der folgende Bericht über den Forschungsstand nicht nur auf die geschichtswissenschaftliche Betrachtung des Geschichtsfilms beschränkt, sondern auch Forschungen anderer Wissenschaften zu den Themen Erinnerung, Gedächtnis, ErinnerungskulturErinnerungskultur, Vergangenheitserzählungen etc. einbezieht.
[5]Gedächtnis und Erinnerung
Audiovisuelle Geschichtsdarstellungen sind Erzählungen, die selbst wieder in großem Umfang auf erzählende Quellen zurückgreifen, um vergangene Lebenswelten wieder ‚lebendig‘ werden zu lassen. Da diese Vergangenheitserzählungen zentrale Bestandteile von kollektiven und individuellen Erinnerungsprozessen sind, weil sie zur Festigung gesellschaftlicher und personaler Identität beitragen, beschäftigen sich die Sozial- und Kulturwissenschaften u.a. mit den Fragen, wie Erzählungen überhaupt entstehen, wie sie im kommunikativen und kulturellen Gedächtnis gespeichert und erinnert und wie sie in die von den Massenmedien verstärkten Erinnerungsprozesse integriert werden.
Der Sozialpsychologe und Soziologe Harald Welzer schrieb 2002 das sehr beachtete Buch „Das kommunikative Gedächtniskommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung“. Welzer ging darin der Frage nach, „wie sich unser Gedächtnis bildet, wie es arbeitet und wie es verarbeitet“, schilderte die sozialen Prozesse der Erfahrungs- und Vergangenheitsbildung und klärte schließlich, „wie sich lebensgeschichtliche Erinnerung über die Zeit hinweg verändert.“ (Welzer 2002, 11f.). Diese Veränderung tritt nicht nur dadurch ein, dass der Einzelne immer neue, lebensgeschichtlich wichtige Ereignisse abspeichert, sondern auch dadurch, dass er normalerweise seine Erinnerungen kontinuierlich mit anderen austauscht. Welzer zeigte, dass Kinder im Zuge des Spracherwerbs, ca. ab dem vierten Lebensjahr, in die familiäre Erzählgemeinschaft integriert sind. Voraussetzung ist die nach und nach erworbene Fähigkeit des Kindes, wahrgenommene Geschehensabläufe im Medium der Sprache so zu codieren und zu strukturieren, dass sie als Ereignisablauf mit einem Anfang und einem Ende, einem Schauplatz und den dort handelnden Personen erzählt werden können. Eigene Erfahrungen, aber auch audiovisuelle Vorlagen (z.B. TV-Nachrichtenbilder) und fremde Erzählsegmente (z.B. Zeitungsartikel) werden ins Gedächtnis importiert und zu Erinnerungsepisoden montiert. Von besonderer Bedeutung ist dabei, „dass unsere autobiografischen Erzählungen Organisationsprinzipien folgen, die sozial gebildet sind. Wir alle haben im Prozess des ‚memory talk‘, in der gemeinsamen Praxis des konventionellen Erinnerns, durch jedes gelesene Buch und jeden gesehenen Film gelernt, dass eine richtige Geschichte bestimmten Grundmustern zu folgen haben muss, um vom Zuhörer unmittelbar verstanden zu werden.“ (Welzer 2002, 172) Dazu gehört die Bedeutsamkeit des erzählten Ereignisses, die Einhaltung der Zeitenfolge, eine klare Strukturierung der einzelnen Erzählelemente auf einen Endpunkt hin, eine Botschaft etc. Das Erzählen von gegenwärtigen und vergangenen Ereignissen ist in diesem Sinne eine „diskursive Leistung“ zum Zweck der Teilhabe an der kulturellen Tradition (Gergen 1998, 191) und zur Aufrechterhaltung der Gemeinschaft, die sich zu allererst als Erzählgemeinschaft versteht. Der gesellschaftliche Erzählfluss verläuft einerseits in die Breite, indem [6]die millionenfachen tagtäglichen Erzählungen unterschiedlicher gesellschaftlicher Schichten als In- und Exporte zeitgleich ablaufen und dabei von den Mainstreamerzählungen der Massenmedien begleitet werden. Andererseits verläuft er zeitlich aber auch in die Tiefe: Erzählungen gehen Erzählungen voraus, die selbst wieder auf Erzählungen beruhen und wiederum Erzählungen werden. Alles in allem ist somit das „gesamte Verhältnis von Erzählvorlagen, Erlebnissen, Weitergaben von Erlebnisberichten und Bebilderungen mit vorhandenem visuellen Material unentwirrbar komplex“ (Welzer 2002, 173). Da sich also menschliches Gedächtnis und die Erinnerung von Kindheit an über sinnliche Wahrnehmungen, das Medium der Sprache und über die Praxis des Erzählens formt und ein Leben lang anhält, ist leicht zu verstehen, warum sehr viele Menschen tagtäglich Geschichten in Zeitungen, Zeitschriften und Büchern lesen oder sich audiovisuell im Kino, Fernsehen und Internet erzählen lassen.
ErinnerungskulturErinnerungskultur und kulturelles GedächtnisKulturelles Gedächtnis
Mit den Fragen der Bedeutung von Erzählungen zur Konstruktion von gesellschaftlicher Identität und zur Abgrenzung (oder manchmal auch für den Brückenschlag) nationaler Kulturen zu anderen Kulturen befassen sich seit vielen Jahren auch die Kulturwissenschaften. Ausgangspunkt waren Forschungen von Aleida und Jan Assmann in den 1980er Jahren zum kulturellen und zum kommunikativen Gedächtnis. Das kulturelle Gedächtnis stand dabei als „Sammelbegriff für alles Wissen, das im spezifischen Interaktionsrahmen einer Gesellschaft Handeln und Erleben steuert und von Generation zu Generation zur wiederholten Einübung und Einweisung ansteht.“ (Assmann 1988, 9) Zum ‚Wissen‘ gehört somit auch das über Generationen tradierte geschichtliche Wissen, das in großem Maße auf (erforschten) Erzählungen beruht. Das kommunikative GedächtnisKommunikatives Gedächtnis ist demgegenüber weniger festgelegt und organisiert. Es ist noch im Fluss und unfertig wie die Erinnerung (ebd. 10). Im Unterschied zur Alltagsferne des kulturellen Gedächtnisses ist es an Personen und Erfahrungen gebunden und durch Alltagsnähe gekennzeichnet. Das kommunikative Gedächtnis beruht auf mündlicher Kommunikation und lässt sich als fortlaufender Prozess des Erzählens verstehen. Es hat keinen festen Zeithorizont, sondern durchwandert gewissermaßen die Lebenszeit der Erzählgemeinschaften. Jan Assmann geht davon aus, dass das kommunikative GedächtnisKommunikatives Gedächtnis 80 bis 100 Jahre, also etwa drei Generationen umfasst. Es funktioniert als eine Art kommunikativer Arbeitsspeicher der Gesellschaft, in dem Erzählungen über Gegenwart und Vergangenheit kursieren, temporär gelagert und immer wieder ergänzt und umgeschrieben werden.
Die kulturwissenschaftliche Gedächtnisforschung hat das Gedächtnis zunächst hauptsächlich als Speichermedium für Wissen und Erzählungen betrachtet und sich für seine Funktion als Verbreitungsmedium von Wissen und [7]Erzählungen weniger interessiert. Das betraf auch die Geschichtsfilme im Kino und Fernsehen, bei denen das Augenmerk mehr auf der Archivierung als auf der Verbreitung lag. Astrid Erll und Stephanie Wodianka haben 2008 deshalb vorgeschlagen, die Aufmerksamkeit innerhalb der kulturwissenschaftlichen Gedächtnisforschung von den Speichermedien stärker auf die Verbreitungsmedien, von den Symbolsystemen hin zu den Sozialsystemen zu verlagern und nicht mehr allein das Produkt (Gedächtnis), sondern in erster Linie die Prozesse (ErinnerungsdiskurseErinnerungsdiskurs) der kulturellen Erinnerung zu untersuchen (Erll/Wodianka 2008a). Dadurch ließe sich feststellen, welche Erzählungen denn tatsächlich in den gesellschaftlichen ErinnerungsdiskursErinnerungsdiskurs eingegangen seien und welche nicht (Erll 2008, 16). Erste Filmanalysen, die diese neue Fragestellung nutzbar machen, liegen vor. So wurden zum Beispiel die Filme „Das Leben der Anderen“ (D 2006) von Lu Seegers (2008) und „Luther“ (USA/D/GB 2003) von Carola Fey (2008) daraufhin befragt, welche Akteure und Medien an ihrer Entstehung beteiligt sind, wie und warum sie in die gesellschaftliche Diskussion geraten und wie der Diskurs außerfilmisch (also vor, während und nach der Kinolaufzeit) in begleitenden Medien als ein dynamischer, auf lange Dauer gestellter Prozess verläuft (Plurimedialität).
Erzählweisen und Erzählstrukturen
An audiovisuellen Erzählungen sind nicht nur die Sozial- und Kulturwissenschaften, sondern naturgemäß auch Film-, Literatur- und Erzählwissenschaft (Narratologie) stark interessiert. Als der Film um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aufkam, wurde er von der Literaturwissenschaft anfangs nicht ernst genommen, er galt als Volksvergnügen ohne größere kulturelle Bedeutung. Zudem war ja der Roman und nicht der Film das Hauptbetätigungsfeld der Literaturwissenschaft und Erzähltheorie. Es war deshalb auch die sich herausbildende Filmwissenschaft selbst, die dem Film seit den 1920er Jahren einen Kunststatus zusprach und ihn von den literarischen Formen des Erzählens radikal abgrenzte. Dabei verwies sie auf die Tatsache, dass das Medium ‚Film‘ völlig andere Zeichen benutzt, um sichtbare Welten darzustellen, als das Medium ‚Literatur‘, nämlich bildliche statt sprachliche Zeichen. Das Visuelle und das Literarische galten als unvereinbar; showing stand gegen telling, unmittelbares Darstellen im Film gegen mittelbares Erzählen im Text (dazu Bietz 2013, 81ff.). Während der literarische Text gewissermaßen aus ‚toten‘ Buchstaben besteht und wie eine ‚Partitur‘ gelesen wird, d.h. beim Lesen von den Lesern „zur Aufführung gebracht wird“ (Seel 2013, 120), ist der Film selbst eine Aufführung, die die Zuschauer in einen raumzeitlich strukturierten audiovisuellen Geschehensablaufs hineinzieht und diesen miterleben lässt. Die mediale Kluft zwischen Film und Roman schien unüberbrückbar. Erst seit ein paar Jahren versuchen einige Literaturwissenschaftler, Filmwissenschaftler [8]und Erzähltheoretiker wieder Brücken zwischen Film und Literatur zu schlagen, indem sie darlegen, dass beide Darstellungsformen eines gemeinsam haben: das Erzählen.
Diese zuletzt von Christoph Bietz in seinem Buch über „Die Geschichten der Nachrichten“ (2013) vorgeschlagene transmediale Ausweitung des Erzählbegriffs von den Literatur auf das bewegte Bild und das vermittelnde Wort von Erzählstimmen im Film, führt damit auch den filmischen Erzähler wieder mit denen zusammen, die einer audiovisuellen Erzählung zusehen und zuhören, dem Publikum. Beide treffen sich im Erzählraum des Kinos oder vor dem Bildschirm im Fernsehzimmer. Der eine erzählt in Bild und Ton eine Geschichte, die zuvor vielleicht ein historischer Roman war, und die anderen verwandeln diese Bild-Ton-Geschichte wieder in mittelbare sprachliche Erzählungen, wenn sie zu Hause oder bei der Arbeit über das Filmereignis berichten.
Die Erzähltheorie interessiert sich aber nicht nur für die unterschiedlichen Modi des Erzählens (visuell vs. literarisch bzw. szenisch vs. dokumentarisch), sondern auch für das Verhältnis von Erzählung und dem ihr zugrunde liegenden Ereignis. Es geht dabei um die Frage, ob und wie Geschichtsfilme die vergangene tatsächliche Welt abbilden bzw. darstellen können. Auch hier hat zuletzt Bietz erneut klargelegt, dass es keinem audiovisuellen Medium und keinem Erzähler gelingen kann, die äußere Welt unmittelbar, objektiv, geschweige denn vollständig abzubilden. Bietz zeigt das bei der Analyse aktueller Fernsehnachrichten unter erzähltheoretischen Gesichtspunkten. Das von ihm erprobte Analyseinstrumentarium wird in diesem Buch teilweise zur Systematisierung und Analyse von Geschichtsfilmen benutzt.
Film und Geschichtswissenschaft
Das Medium ‚Film‘ ist von der Historiografie jahrzehntelang nicht als ‚geschichtswichtig‘ angesehen worden. Erst in den 1970er Jahren gab es in Frankreich und England Interesse von Seiten der Historiker (Marwick 1974; Ferro 1975). In den 1980er Jahren hat dann Irmgard Wilharm eine geschichtsdidaktisch orientierte Auseinandersetzung mit dem Medium ‚Film‘ in die Geschichtswissenschaft eingeführt. Sie hat Geschichtsfilme nicht nur in ihrem Bezug zur tatsächlichen Welt befragt, sondern die erzählte filmische Welt auch quellenkritisch analysiert. Im Zentrum ihrer Analysen standen mentalitätsgeschichtliche Überlegungen: die Filmbilder und die durch sie vermittelten Aussagen wurden als Quellen für Bewusstseinslagen zeitgenössischer Lebenswelten interpretiert (Wilharm 2006). Auch Anton Kaes begann in den 1980er Jahren mit der Untersuchung von Geschichtsfilmen der deutschen Nachkriegsgeschichte, beschränkte sich aber, wie andere auch, hauptsächlich auf werkimmanente Interpretationen (Kaes 1987). Ein stärkeres Historikerinteresse an Geschichtsfilmen blieb aber aus, selbst [9]dann noch, als das Fernsehen in den 1990er Jahren zum Leitmedium der populären Geschichtsdarstellung wurde. Erst nach der Jahrtausendwende begann eine breitere wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Geschichte in populären Medien, allerdings noch nicht grundsätzlich und systematisch, sondern bezogen auf Teilaspekte.
Untersucht wurde hauptsächlich die Darstellung der NS-Zeit im deutschen Nachkriegsfilm (so z.B. Bösch 2009; Vatter 2008), aber auch dem Mittelalter, der Antike und der Archäologie wurden Studien gewidmet (Meier/Slanička 2007a; Lochman/Späth/Stähli 2008; Gehrke/Sénécheau 2010). Der zweite Untersuchungsschwerpunkt bezog sich auf die Rolle von ZeitzeugenZeitzeugen in Geschichtsdokumentationen seit den 1980er Jahren (Keilbach 2003, 2005, 2008; Sabrow/Frei 2012). Dabei ging es einerseits um die Fragen der Glaubwürdigkeit und des Erkenntnisgewinns von Zeitzeugenaussagen, also um Zeitzeugen als Quelle, andererseits um die Zeitzeugen als Katalysatoren einer zunehmenden Personalisierung und Emotionalisierung von Geschichte im kollektiven, massenmedial gestützten Erinnerungsdiskurs der Gegenwart. Drittens nahmen sich die Historiker das Themenfeld der populären Darstellung von Geschichte in unterschiedlichen populären Medien (Zeitschrift, Comic, Film, Fernsehen, Internet) und Einrichtungen der Erinnerungskultur (Denkmäler, Museen, Ausstellungen etc.) vor. Barbara Korte und Sylvia Paletschek leisteten 2009 mit der Herausgabe des Sammelbandes „History Goes Pop. Zur Repräsentation von Geschichte in populären Medien und Genres“ einen wichtigen Beitrag zum Untersuchungsfeld der populären Geschichtskultur. Zeitgleich widmete sich auch die Zeitschrift „Zeithistorische Forschungen“ in einem monothematischen Heft (3/2009) der populären Geschichtsschreibung. Wie diese populären Geschichtsmedien im Einzelnen genutzt werden und welche Wirkung sie entfalten, das ist allerdings noch ziemlich unklar. Viertens beschäftigt sich die Geschichtswissenschaft zunehmend auch mit den Fragen der historischen AuthentizitätAuthentizität, authentisch, Authentifizierung und ‚Objektivität‘ in audiovisuellen Geschichtsdarstellungen. Dabei ist man sich weitgehend darüber einig, dass es sich bei erzählter Geschichte, unabhängig davon, welches Erzählmedium genutzt wird, um Rekonstruktionen von historischen Welten handelt, die die tatsächliche historische Welt weder abbilden noch darstellen, sondern sie allenfalls repräsentieren. Je stärker die filmische Rekonstruktion dabei auf die Einarbeitung von historischen Quellen setzt (Archivbilder und -filme, Originaltöne, schriftliche Dokumente, ZeitzeugenZeitzeugen etc.), desto stärker erzeugt sie den Eindruck von AuthentizitätAuthentizität, authentisch, Authentifizierung und desto größer wird damit auch ihre dokumentarische Glaubwürdigkeit. Je weniger sie es tut und stattdessen auf Spielszenen baut, desto mehr verschwimmen die Grenzen zwischen szenischer und dokumentarischer bzw. zwischen fiktionaler und faktualer Geschichtsdarstellung (Fischer/Wirtz 2008).