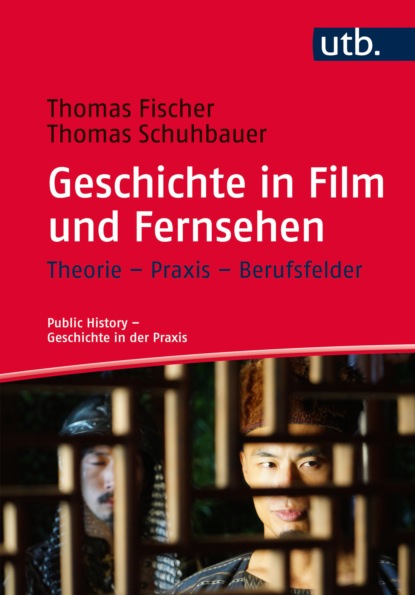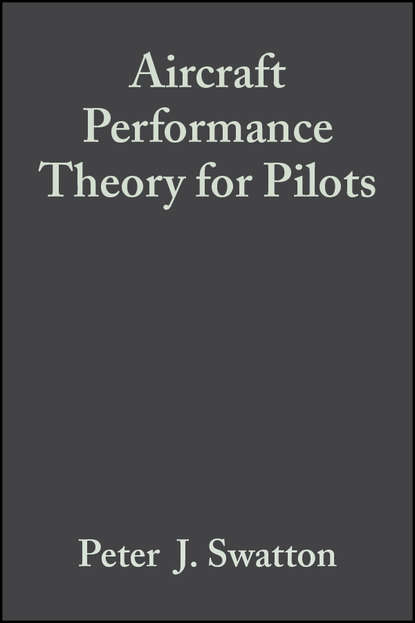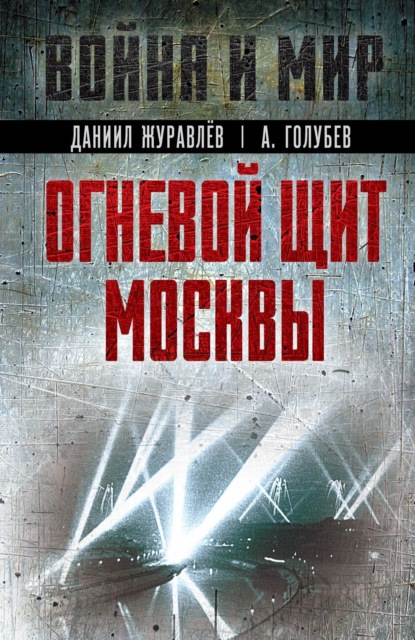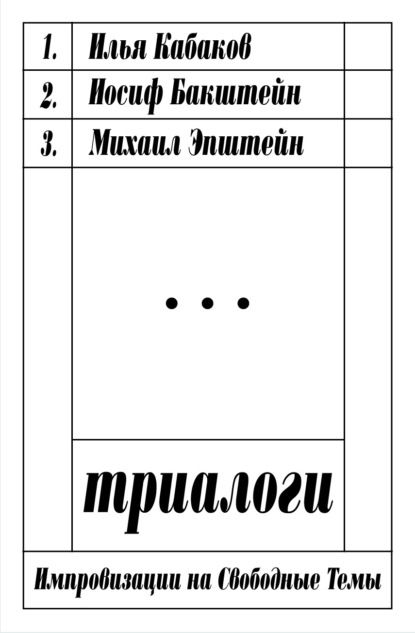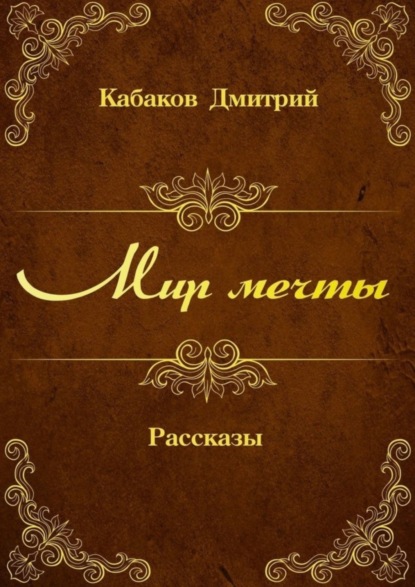- -
- 100%
- +
[10]Die Flüchtigkeit der Filmbilder hat viele Historiker bis in die 2000er Jahre hinein davon abgehalten, adäquate Mittel und Methoden für die wissenschaftliche Analyse von Geschichtsfilmen mit explizit geschichtswissenschaftlichen Fragestellungen zu entwickeln. Erst seitdem sich Geschichtsfilme problemlos von jedermann leicht aufzeichnen und speichern lassen, haben die Bemühungen zugenommen, audiovisuelle Geschichte generell und systematisch mit standardisierten Methoden zu analysieren. Dabei konnten die Historiker auf die große Erfahrung der Medienwissenschaft bei der Filmanalyse zurückgreifen, die seit langem genreübergreifend idealtypische Handlungsmuster in Drehbuch und Film sowie die typischen Rollenzuweisungen, Konfliktmuster und standardisierte Lösungen untersucht. Auf der Grundlage medienwissenschaftlicher Forschungen hat Annerose Menninger in ihrem Buch „HistorienfilmeHistorienfilme als Geschichtsvermittler“ (2010) erstmals ein ausgefeiltes und erfolgreich an zwei Kolumbus-Filmen erprobtes Analysemodell zur Verfügung gestellt. Sie untersucht dabei nicht nur Quellen und Rezeption der filmischen Geschichtserzählungen, sondern fragt auch nach den ErzählformErzählformen und -strukturen, wobei sie die verschiedenen audiovisuellen Erzählebenen genauer in den Blick nimmt: „Auf narrativer Ebene wird die Filmhandlung mit ihrer Erzählstrategie (Erzähler, chronologische Handlung oder Rahmenhandlung), ihrer Geschichte, Problematik und Aussage sowie den Akteuren (Held oder Antiheld, statische oder sich entwickelnde Charaktere) untersucht. Auf visueller Ebene werden Sequenzen und SchnittSchnitte sowie Blickpunkt, Einstellungen und Perspektiven, Wechsel und Fahrten der Kamera betrachtet. Ihr Einsatz hat entscheidende Bedeutung für das Filmerlebnis, die Filmspannung wie auch die Zeichnung handelnder Personen. […] Auf auditiver Ebene werden Sprachmittel (Monologe, Dialoge, Erzähler, Voice-OverVoice-Over), Geräusche (die erst eine natürliche Atmosphäre erzeugen) und Filmmusik (die die visuelle Ebene unterstützt) als dramaturgische Elemente ausgeleuchtet“ (Menninger 2010, 15).
‚Audiovisuelle Geschichte‘ ist ein Element des Visualisierungsschubs, der im 19. Jahrhundert mit der massenmedialen Nutzung von Fotografie, Illustration, Grafik in den Printmedien begann und sich mittels Film, Video, Computergrafik etc. immer weiter in der Gegenwart ausgebreitet hat. Als Folge dieses visual turn leben wir heute in einer Bilderwelt, die sehr viele gesellschaftlichen Erzähl- und Erinnerungsformen prägt. Die Geschichtswissenschaft beschäftigt sich seit einiger Zeit unter dem Label ‚Visual History‘ mit Bildern als historischer Quelle. Sie hat dazu neue Fragestellungen und Untersuchungsmethoden entwickelt.1 Dabei geht es allerdings in erster Linie um das Einzelbild, insbesondere um die Fotografie. Eine ‚Audio Visual History‘ als Forschungszweig der Geschichtswissenschaft steht noch in den Anfängen.
[11]Weiterführende Literatur
Erll/Wodianka Erll/Wodianka 2008a: Astrid Erll/Stephanie Wodianka (Hg.), Film und kulturelle Erinnerung: Plurimediale Konstellationen. Berlin, New York 2008.
Hickethier 2010: Knut Hickethier, Einführung in die Medienwissenschaft. Stuttgart, Weimar 20102.
Paul 2006: Gerhard Paul, Visual History: Ein Studienbuch. Göttingen 2006.
Menninger 2010: Annerose Menninger, Historienfilme als Geschichtsvermittler: Kolumbus und Amerika im populären Spielfilm. Stuttgart 2010.
Straub 1998a: Jürgen Straub (Hg.), Erzählung, Identität und historisches Bewußtsein. Die psychologische Konstruktion von Zeit und Geschichte. Frankfurt a.M. 1998.
[13]2 Audiovisuelles Erzählen
Die Welt steckt voller Erzählungen. Wir lesen und hören, wir verbreiten und erhalten Tag für Tag Erzählungen, die von gegenwärtigen und vergangenen Ereignissen handeln. Als gesellschaftliche Wesen brauchen wir nicht nur Erzählungen, sondern definieren wir uns auch über sie. Erzählen ist ein Lebenselixier, eine ständige Kräftigung und Verjüngung von familiären, sozialen oder nationalen Gemeinschaften. Erzählungen führen zwei Perspektiven zusammen, die des Erzählers und die des Zuhörers. Dieses Zusammenspiel ist unabdingbar für das Erzählen: Jede Erzählung entsteht, nimmt sprachliche Gestalt an, entwickelt Spannung und Tempo einzig und allein in Hinblick auf einen tatsächlichen oder imaginären Zuhörer. Und umgekehrt: jeder Mensch hört auf die Stimmen in seiner Umgebung, seien sie natürlichen Ursprungs (Familie) oder technischen Ursprungs (Massenmedien) in der steten Erwartung, es könne sich eine Erzählung entwickeln. Wenn etwas erzählt wird, geht es meistens um die Gegenwart, um das Hier und Heute. Neuigkeiten werden gehandelt, die all das enthalten, was uns Menschen persönlich gerade interessiert und aufregt und was wir gerne an andere weitererzählen. Dazu gehört neben dem alltäglichen Tratsch und Klatsch auch das, was an Besonderem in der Welt passiert, das, was die Nachrichten erzählen. Das ist nicht nur heute so, sondern gilt auch für die Vergangenheit. Bevor wir aber die audiovisuellen Geschichtserzählungen untersuchen, wollen wir uns in diesem Kapitel mit den audiovisuellen Nachrichtenerzählungen der Gegenwart befassen. Das hat zwei Gründe: Zum einen enthalten die Nachrichtenerzählungen bereits all jene grundlegenden Aspekte und Probleme, die auch bei den Geschichtserzählungen wieder auftauchen werden. Zum anderen liefern die Nachrichtenerzählungen den Grundstock für die meisten Geschichtserzählungen: Viele Ereignisse, von denen die Nachrichten heute erzählen, werden Jahre oder Jahrzehnte später in Geschichtserzählungen erneut zum Thema werden.
Audiovisuelle Erzählungen gibt es erst seit knapp 100 Jahren. Sie setzen technische Medien voraus, die Bilder und Töne synchron aufzeichnen, speichern, verarbeiten und verbreiten können. Das begann Ende der 1920er Jahre mit dem Tonfilm, der im Kino als audiovisuelle Erzählung ‚lebendig‘ wurde. Heute sind es meist die digitalen Camcorder, die im Profi- und Amateurbereich zum Einsatz kommen und die Ereignisse nicht nur audiovisuell aufzeichnen, sondern auch direkt wiedergeben können. Bei den alten wie auch den neuen AV-Medien [14]befinden sich Bild und Ton auf unterschiedlichen, voneinander getrennten Ebenen (Spuren). Die visuelle Ebene speichert alle Bildquellen der sichtbaren Welt, zum Beispiel Landschaften oder Personen, aber auch Fotos, Texte, Grafiken. Die auditive Ebene speichert alle Tonquellen der hörbaren Welt, zum Beispiel Geräusche, Stimmen, Musik. Handelt es sich um Aufnahmen von professionellen Fernsehteams, dann werden diese durch Bild- und Tonprotokolle dokumentiert (Tag, Uhrzeit und Ort der Aufnahme; bei Interviews auch Namen der interviewten Person). Damit wird die Tatsächlichkeit des gefilmten audiovisuellen Ereignisses belegt. Genannt wird auch der Name des Kameramanns, weil er für die (technische) Bildqualität, die Einstellungen, die Perspektiven verantwortlich zeichnet und den Bildern seine ‚Handschrift‘ gibt. Da die filmischen Nachrichtenerzählungen der Gegenwart der Stoff für zukünftige Geschichtserzählungen sind, behalten auch die Bild- und Tonprotokolle ihre Bedeutung. Sie dienen dazu, das in Geschichtsdokumentationen verwendete Archivmaterial als authentisch zu deklarieren (→ Kap. 2.3.2).
Ereignis und Erzählung
Im Leben eines jeden Menschen spielen selbst erlebte oder medial vermittelte Ereignisse eine wichtige Rolle. Die als ,bedeutend‘ empfundenen Ereignisse werden vom Einzelnen verarbeitet, in dem dieser sie in seine sprachlich erworbenen Denk- und Erzählmuster einfügt. Diese Muster entsprechen in hohem Maße denen, die im jeweiligen sozialen und kulturellen Umfeld Verwendung finden. Solche Erzählmuster (Klischees, Stereotypen) erleichtern den Austausch von Erzählungen zwischen den Mitgliedern von Erzählgemeinschaften (Familie, Freundeskreise etc.). Und sie vereinfachen das Speichern von wissenswerten Dingen im Gedächtnis. Wenn wir Wirklichkeit wahrnehmen, deuten und schließlich erinnern, so die Kulturwissenschaftlerin Astrid Erll, „greifen wir auf kulturspezifische Schemata zurück, d.h. auf innerhalb von Kollektiven (Familien und anderen Gruppen, Gesellschaften usw.) standardisierte mentale Wissensstrukturen, die bestimmte Aspekte der Realität in abstrakter und generalisierender Form repräsentieren“ (Erll 2008, 12f.). Die wichtigen erlebten oder medial vermittelten Ereignisse werden im Verlauf des Lebens durch Erinnerung zu Merkposten der jeweiligen Lebensgeschichte.
Auch das kollektive Gedächtnis speichert Ereignisse ab, die von sozialen Gruppen wahrgenommen und für wichtig erachtet werden. Wahrgenommen werden sie vor allem in den Massenmedien, und zwar meist als Nachrichtenerzählungen, die tagtäglich die wichtigsten Ereignisse des Weltgeschehens vermitteln. Um diese aktuellen Geschehnisse des öffentlichen Lebens aufzuzeichnen und audiovisuell bereitzustellen, sind weltweit tausende Reporter und Kameraleute im Auftrag von Nachrichtenredaktionen und -sendern zu den Schauplätzen des [15]Geschehens unterwegs, um von dort zu berichten. Heutzutage treffen die Nachrichtenprofis dort natürlich auch auf zahlreiche Foto- und Videoamateure, die die Geschehnisse mit ihren Camcordern oder Handys festhalten. So entstehen ‚vor Ort‘ audiovisuelle Erzählungen mit sehr unterschiedlichen Perspektiven und für ganz unterschiedliche Personengruppen, die je nach Nachrichtenwert entweder wieder gelöscht werden, als unterhaltsame buzz feed im Internet kursieren oder als breaking news die Nachrichtensendungen beherrschen.
BREAKING NEWS – ANSCHLAG AUF DAS WORLD TRADE CENTER (USA 2001)
Am 11. September 2001 sind die Brüder Jules und Gedeon Naudet mit ihrem Kamerateam in New York unterwegs. Sie drehen eine Alltagsreportage über eine Feuerwache. Bis zum 11. September war nichts Aufregendes passiert und auch an diesem Tag erwartet niemand etwas Besonderes. Die Männer von der Feuerwache brechen zu einem Routineeinsatz auf, aus irgendeinem Kanaldeckel in der Nähe des World Trade Centers (WTC) war Gas ausgetreten. Die Kameras der Brüder Naudet beobachten, wie die Männer unschlüssig um den Gullydeckel herumstehen und überlegen, was sie machen sollen. In diese Allerweltszene hinein dringt das Geräusch eines niedrig fliegenden Passagierjets. Der Lärm der Triebwerke nimmt zu und plötzlich, wie um sich zu orientieren und diesem Geräusch auf die Spur zu kommen, schwenkt die Kamera hoch und erfasst das Flugzeug. Sie folgt ihm, wie es durch die Häuserschluchten fliegt und sich dann beim Einschlag in das World Trade Center in einen Feuerball verwandelt. Auf den Gesichtern der Beobachter zeichnet sich erst ungläubiges Erstaunen, dann Entsetzen ab. Noch kann niemand von ihnen begreifen, was genau geschehen ist, doch jeder weiß, dass der Einschlag der Flugzeuge ein katastrophales Ereignis ist, das das Land verändern wird …
So oder so ähnlich könnte eine Erzählung beginnen, die von den Schreckensereignissen des 11. September 2001 in New York erzählt. Ein Leser, der sich nicht nur für den Inhalt und Verlauf der Ereignisse interessiert, sondern auch für das Erzählen selbst, wird bemerken, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Erzählung, die er gerade liest, und dem Ereignis, das ihr zugrunde liegt. Dieser Unterschied wird in vielen alltäglichen Erzählsituationen erfahrbar, wenn jemand ankündigt, „ich erzähle dir jetzt mal, was passiert ist.“ Der Erzähler unterscheidet nämlich dabei zwischen seiner Erzählung, die gleich folgen wird („Ich erzähle Dir jetzt mal,…“) und einem ‚Ereignis‘, das sich in der unmittelbaren oder früheren Vergangenheit ereignet hat („… was passiert ist“) und das Ausgangspunkt der Erzählung ist. Die Unterscheidung markiert einen fundamentalen Sachverhalt: Tatsächliche Ereignisse sind Unikate, die es nur einmal gibt. Sie haben ihre Zeit, ihren Ort, ihre Akteure und Abläufe, sind aber zum Zeitpunkt ihres Geschehens noch nicht erzählbar. Erst durch die Fähigkeit der Menschen, [16]sichtbare und hörbare Geschehensabläufe aus der sie umgebenden Welt mit den Sinnen zu erfassen (Wahrnehmung), sprachlich zu benennen (Codierung, Formung) und zu erzählen (Vermittlung), wird die Welt meist amorpher sprachloser Geschehnisse zu einer erzählten Welt. In dieser erzählten Welt werden die als ,wichtig‘ eingestuften Ereignisse als bedeutsame Zustandsänderungen im raumzeitlichen Ablauf des Weltgeschehens dargestellt (Mauerfall, 9/11, Brexit). Sie markieren einen Unterschied zwischen einem Zustand ‚davor‘ und einem ‚danach‘, haben einen Anfang und ein Ende. Dennoch kann es von einem einzigartigen tatsächlichen Ereignis zahlreiche verschiedene Erzählungen geben, abhängig davon, wie viele Erzähler sich des Ereignisses im Laufe der Zeit annehmen und von welchem Standpunkt aus sie erzählen.
So war es auch am 11. September 2001, als die Kameraleute der Brüder Naudet zufällig Zeugen des Einschlags der Flugzeuge in die Twin Towers wurden. Damals dauerte es nicht lange, bis auch die kommerziellen News-Sender mit ihren Übertragungswagen (Ü-Wagen, ausgestattet mit Aufzeichnungs-, Schnitt- und Sendetechnik) vor Ort waren. Sie richteten ihre Kamera(s) auf die Twin Towers und ihre Antennen auf den Satelliten aus und sendeten die Bilder live als ‚cleanfeed‘ (unbearbeitet) an ihre Fernsehstationen. Dort wurde der große Nachrichtenwert der Bilder sofort erkannt und entschieden, das laufende Programm sogleich zu ändern und die Bilder vom Geschehen als ‚breaking news‘ mit maximaler Reichweite zu verbreiten. Als die Bilder öffentlich wurden, wollten weltweit auch viele andere Fernsehsender das Live-Signal übernehmen, aber es gab die üblichen rechtlichen, technischen und redaktionelle Probleme: Nachrichtenteams mussten zusammengerufen, die Leitungen angemietet und geschaltet, die Studios besorgt und hochgefahren, die Lizenzkosten für Bilder ausgehandelt werden – alles Dinge, die einige Zeit brauchen. Auch bei deutschen Fernsehsendern gab es Schwierigkeiten. Als man dort über die Live-Bilder verfügte, mussten die Nachrichtensprecher aus ihren 6000 km entfernten Studios einen ‚livestream‘ von schockierenden Bildern kommentieren, zu denen die Hintergrundinformationen noch weitgehend fehlten.
Erzähler
Aktuelle Ereignisse werden in audiovisuellen Medien meist von Nachrichtenerzählern (Moderatoren) präsentiert. Bei Auslandsberichten treten neben dem Moderator weitere Erzähler auf: die Reporter oder Korrespondenten. Am Ort des Geschehens beobachten sie Akteure und Handlungsabläufe und formen die Geschehnisse zu Ereignissen um, indem sie Zeit, Ort und Akteure des Geschehens präzise benennen und die von ihnen wahrgenommenen Unterschiede im raumzeitlichen Geschehensablauf festhalten. Die Beachtung der raumzeitlichen Abläufe ist deshalb wichtig, weil (verständliche) Erzählungen nur dann entstehen, [17]wenn der Erzähler die Geschehenselemente schlüssig auseinander hervorgehen lässt (Kausalität), die zu erzählenden Inhalte nachvollziehbar einander zuordnet (Kohärenz) und sich insgesamt an die genaue zeitliche Abfolge der Geschehnisse hält (Chronologie). Der Erzähler vor Ort steht dabei vor einigen Problemen: Erstens, weil er sich selbst am Schauplatz des Geschehens befindet, das Geschehen also nicht nur beobachtet, sondern es auch erlebt (und indirekt nicht selten auch beeinflusst). Zweitens muss er sich auf dem Schauplatz einen Standpunkt suchen, von dem aus er das Geschehen beobachtet. Wer einen Standpunkt hat, bekommt damit aber auch eine bestimmte Sichtweise (Perspektive) auf das Geschehen, er sieht nur einen Ausschnitt des Geschehens (Selektion) und verfügt deshalb auch nur über ein begrenztes Wissen von dem, was geschieht (Fokalisierung). Drittens ist das Geschehen in der Regel noch im Fluss, wenn der Reporter den Schauplatz betritt. Als erfahrener Beobachter und Erzähler kann er zwar einschätzen, ob es sich bei dem Geschehen um ein wichtiges Ereignis mit großem Nachrichtenwert handelt, aber er kennt nur den Anfang des Ereignisses und noch nicht sein Ende. Diese Ungewissheit über den Ausgang eines Ereignisses ist nahezu tagtäglich in den Fernsehnachrichten wahrnehmbar, wenn Auslandskorrespondenten von Kriegs- oder Katastrophenschauplätzen berichten und über den weiteren Verlauf von Ereignissen spekulieren. Viertens ist ein Reporter zwar ein unmittelbarer Beobachter, aber er kann seine Beobachtung nicht unmittelbar, sondern nur sprachlich oder bildlich vermittelt weitergeben. Der Erzähler kann also immer nur mittelbar von einem Ereignis erzählen, was die Frage aufwirft, in welcher Relation die erzählte Welt der Ereignisse zur tatsächlichen Welt der Geschehnisse steht. Fünftens schließlich muss sich der Erzähler eines technischen Mediums bedienen, um seine Erzählung zu vermitteln. Von der Wahl des Mediums hängt es ab, ob eine Erzählung etwa als fortlaufender Text sichtbar wird oder, wie das bei den audiovisuellen Medien der Fall ist, als komplexe Bild-Ton-Abfolge mit verschiedenen Erzählkanälen (visuelle, auditive und verbale Kanäle), die erst synchronisiert werden müssen, damit eine Erzählung entsteht.
Erzählung
Katastrophen, die die Normalität der Alltagswelt aus den Angeln heben und zu einem verzweifelten Überlebenskampf der betroffenen Opfer sowie zu dramatischen Rettungsaktionen der herbeieilenden Helfer führen, finden sich zu allen Zeiten und sind, gerade wegen ihrer Dramatik, häufig Erzählinhalt von Kinofilmen und Fernsehdokumentationen. Vor allem das Erzählschema der Spielfilme wiederholt sich dabei meist stereotyp: Am Anfang der Erzählung steht ein Schreckensereignis, das einen bestehenden Zustand radikal verändert und bestimmte Personen oder Personengruppen zum Handeln zwingt. Sie müssen gegen die Katastrophe ankämpfen. Einzelne Akteure (z.B. Polizisten, Ärzte, Forscher) treten [18]dabei in den Vordergrund und nehmen entscheidenden Einfluss auf das Handlungsgeschehen. Die Helfer sind bemüht, in einem Wettlauf gegen die Zeit möglichst viele Menschen zu retten und das katastrophale Geschehen schnell zu beenden. Dennoch können sie nicht verhindern, dass viele Menschen der Katastrophe zum Opfer fallen. Bei solchen oft als Actionfilm inszenierten Ereignissen rücken ‚Erzählzeit‘ (Zeit der Erzählung) und ‚erzählte Zeit‘ (Zeit des Ereignisses) eng zusammen, weil der Kampf gegen die (ablaufende) Zeit die Handlung strukturiert. Ein Katastrophenfilm lässt sich natürlich auch aus der Opferperspektive erzählen. Dies versucht anlässlich von 9/11 beispielsweise der Film „Extrem laut und unglaublich nah“ (USA 2011). Aber auch dort gibt es Protagonisten, Antagonisten und weitere Handlungsfiguren sowie innere und zwischenmenschliche Konflikte, die die Handlung vorantreiben und das Ende der Erzählung bestimmen. Das sich in vielen Katastrophenfilmen wiederholende Erzählschema verweist wiederum auf die raumzeitliche Struktur der Ereignisabläufe selbst, die sich nicht nur in den Erzählungen wiederfindet, sondern auch schon den tatsächlichen Geschehnissen innewohnt, auf die sich die Erzählungen beziehen. So ist es nicht weiter erstaunlich, dass es bei Geschehensabläufen, Ereignissen und Erzählungen immer um dasselbe geht, um handelnde Akteure in Zeit und Raum oder, etwas erzählerischer formuliert, um konkrete Menschen, die zu einer bestimmten Zeit an bestimmten Schauplätzen handeln müssen, weil ein Ereignis ihren Lebensalltag destabilisiert hat und sie zwingt, die Stabilität auf neuer Grundlage wieder herzustellen.
9/11 zeigt schließlich auch, dass es Ereignisse gibt, die einen nur kurzen Zeitablauf haben – die Flugzeuge trafen die New Yorker Türme innerhalb von Sekundenbruchteilen – und dass es Ereignisse mit längerem Zeitablauf gibt: das WTC Building 7 stürzte nach achteinhalb Stunden in sich zusammen. Zur gleichen Zeit lösten diese Ereignisse eine Kaskade neuer Ereignisse aus (Domino-Effekt). Schon kurz nach dem Angriff wurde der Präsident der Vereinigten Staaten an einen sicheren Ort gebracht, wo ihm die Gesamtlage vorgetragen wurde. Nicht nur das WTC, sondern auch das Pentagon war mit einem Flugzeug angegriffen worden, und ein weiteres Angriffsflugzeug war abgestürzt und hatte viele Unschuldige in den Tod gerissen. Der Präsident sah darin einen Angriff auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Dem Angriff folgte eine Kriegserklärung an die für den Angriff Verantwortlichen. Der Terrorist Osama Bin Laden wurde zum Antagonisten (Anführer der ‚Bösen‘) erklärt, ihm standen George W. Bush als Protagonist (Anführer der ‚Guten‘) und seine Helfer gegenüber. Mit dem ‚Krieg gegen den Terror‘ begann ein neues Ereignis mit weltweiten Auswirkungen. In diesem Großereignis fanden zwar Teilereignisse ihren Abschluss (Tod Saddam Husseins, Tod Osama bin Ladens u.a.), der Abschluss des Gesamtereignisses (‚Krieg gegen der Terror‘) selbst steht aber noch aus und wird vielleicht nie erfolgen, da Terror vermutlich immer wieder auftritt. Viele Teilereignisse dieses Kampfes sind auch [19]bereits Gegenstand von Filmen geworden – „Von Löwen und Lämmern“ (USA 2007), „Essential Killing“ (HU/IE/NO/PL 2010), „Zero Dark Thirty“ (USA 2012), „Blackwater“ (USA 2015) und andere – das Gesamtereignis wird filmisch aber wohl kaum jemals erzählt werden können, da die filmische Erzählzeit stets nur auf wenige Stunden begrenzt ist.
Erinnerung
Dramatische Ereignisse bleiben in Erinnerung. Das trifft nicht nur auf die Ereignisse zu, die den Lebensalltag einzelner Menschen radikal verändern, sondern auch auf die nationalen Dramen, die im kollektiven Gedächtnis verankert sind. Insbesondere den Massenmedien ,Film‘ und ,Fernsehen‘ fällt dabei die Aufgabe zu, die kollektiven Erinnerungen immer wieder zu erzählen und damit den gesellschaftlichen Erinnerungsdiskurs in Gang zu halten (siehe Kap. 2.2.2 und 2.3.2). Bei dramatischen Ereignissen mit großer Reichweite beginnt dieser gesellschaftliche Erinnerungsdiskurs früh. Auch das belegt das Ereignis 9/11 eindrücklich. Unmittelbar nach dem Angriff in New York rief der Sender Home Box Office (HBO) auf Anregung des New Yorker Bürgermeister Rudolph Giordano in lokalen Anzeigen die Einwohner dazu auf, Fotos und Videos von dem Schreckensereignis zur Verfügung zu stellen. Ein Erinnerungsfilm der New Yorker sollte entstehen. Das Ergebnis lief sechs Monate später, im Mai 2002, unter dem Titel „In Memoriam: New York City 9/11/01“ bei HBO. Über 800 Stunden Material von mehr als 100 Privatpersonen sowie die Filmaufzeichnungen von vielen Profikameraleuten waren gesammelt, gesichtet und zu einem einstündigen Film zusammengeschnitten worden. Die Dokumentation lief auch bei ‚CNN International‘ und konnte so von mehr als 170 Millionen Haushalten in über 200 Ländern und Territorien rund um die Welt gesehen werden. Kurz vorher war schon der Film der Brüder Naudet gelaufen, die bei ihrer Reportage über New Yorker Feuerwehrleute die ersten Filmbilder vom explodierenden Flugzeug im WTC aufgezeichnet hatten. Durch die Katastrophe wurde aus der ursprünglich geplanten Alltagsgeschichte eine Heldengeschichte der New Yorker Feuerwehr. Der Film lief unter dem Titel „9/11“ (dt. Fassung: „11. September – Die letzten Stunden im World Trade Center“) bei CBS und erreichte ca. 40 Millionen Zuschauer. Aber auch dieser Film war nur einer von vielen weiteren, die zum Erinnerungsdiskurs beitrugen. Allein in Deutschland liefen zwischen dem 17.8.2002 und dem 13.9.2002 über 26 Erinnerungssendungen zu 9/11 im Fernsehen.
Kollektive Erinnerungen brauchen Erzählanlässe, die den Erinnerungsprozess in Gang halten. Sehr oft sind das Jahrestage, neben 9/11 zum Beispiel in den USA der 6. Juni (Landung der alliierten Truppen 1944 in der Normandie). In Deutschland sind heute der 8. Mai (Tag der Befreiung vom NS-Regime 1945), der 9. November (Tag des Mauerfalls 1989) oder der 3. Oktober (Tag der deutschen [20]Einheit 1990) nationale Erinnerungstage. Diesen Daten, die an erfreuliche Ereignisse erinnern, stehen Gedenktage gegenüber, die an NS-Verbrechen erinnern, zum Beispiel der 27. Januar (Tag der Befreiung von Auschwitz durch sowjetische Truppen 1945) oder der 9. November (Judenpogrom 1938). Alle Erinnerungstage liegen noch im Zeithorizont der älteren Generation, sind lebendige Erinnerung, die nicht nur Wissen beinhalten, sondern auch Emotionen. Und vor allem diese ‚gefühlte‘ Geschichte ist es, die die Erinnerungen so lange lebendig halten. Die ,großen‘ Erzählinstitutionen der kollektiven Erinnerung sind Film und Fernsehen, sie ,setzen‘ die meisten Erinnerungsthemen des öffentlichen Geschichtsdiskurses. Sie erzählen populär und damit massenwirksam und prägen die Geschichtsbilder aufgrund ihrer audiovisuellen Überzeugungskraft maßgeblich mit.