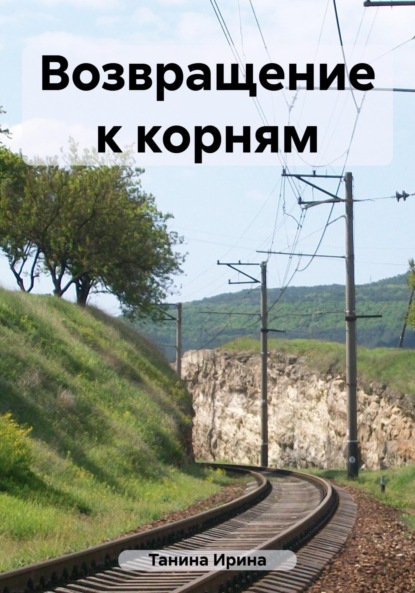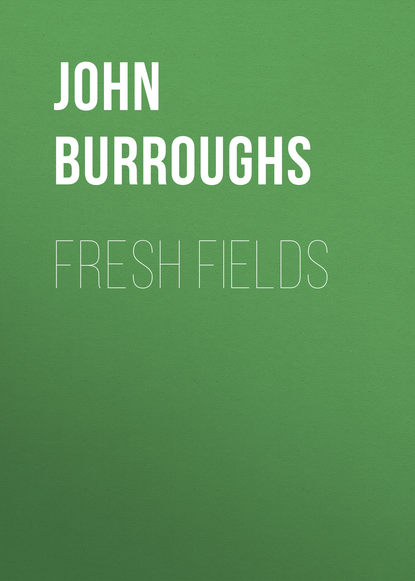- -
- 100%
- +
Die Frage, die mich immer wieder beschäftigte, während ich sowohl Oryx und Crake als auch Das Jahr der Flut las, war: Warum sind diese Bücher nicht in demselben Maße erfolgreich wie Der Report der Magd? Wenn es sich bei Der Report der Magd um eine exemplarische Dystopie handelt, dann weil der Roman das Imaginär-Reale des Neokonservatismus traf. Gilead war »Real« auf dem Level eines neokonservativen Begehrens, das die 1980er Jahre Reagans beherrschte; eine virtuelle Gegenwart, die die tatsächliche Gegenwart strukturierte. Desfred, die Mägde, die Marthas, die Mauer – diese Namen haben die nachhallende Konsistenz einer Welt. Doch den Neoliberalismus begreift Atwood nicht in derselben Weise wie den Neokonservatismus. Atwood scheint die billige Poesie der Markennamen deutlich zu unterschätzen, so banal wie sie ist; ihre Firmennamen sind hässlich und klobig, ohne Zweifel mit Absicht – vielleicht klingen die absurden Infantilismen der spätkapitalistischen Semiotik für sie genauso. AnuYu, HelthWyzer, Happicuppa, Rejuv, und – am unbeholfensten – See/H/Öhr-Lekker-Bits: diese Namen haben mir physische Schmerzen beim Lesen bereitet und es ist schwer, sich eine Welt vorzustellen, in der das führende Marken sind. Atwoods Fehler ist immer derselbe – die Namen sind unschöne Wortspiele mit den Funktionen oder Dienstleistungen, die die Firma anbietet, während die Topmarken des Kapitalismus – Coca-Cola, Google, Starbucks – zu Abstraktionen ohne Bedeutung geworden sind und der Hinweis auf die Taten der Firmen nur noch Beiwerk ist. Die kapitalistische Semiotik wiederholt die Tendenz des Kapitals zu immer größerer Abstraktion. (Für das Imaginär-Reale des Neoliberalismus tut man besser daran, Nick Lands Texte aus den 1990er Jahren zu lesen, die in Kürze wiederveröffentlicht werden.) Atwoods Namen für genetisch zusammengeschusterte Tiere – Bauchschwein, Spinnenziege, Löwamm – sind ebenfalls ein linguistisches Gemetzel; vielleicht hat sie versucht, in der Sprache eine Parallele zur denaturalisierenden Gewalt der Gentechnik zu finden. In jedem Fall sind diese Sprachmonster kaum woanders als in Atwoods Text zu finden (zumindest fehlt ihnen die düstere Glätte und beschwörende Kraft von Gibsons Neologismen).
Das größte Scheitern des Antikapitalismus in Das Jahr der Flut liegt jedoch in der Unfähigkeit, zu verstehen, in welchem Maße der Kapitalismus das Biologische und Grüne absorbiert hat. Die stärksten Passagen in Žižeks First as Tragedy, Then as Farce wiederholen diesen Punkt immer wieder. (Eine meiner Lieblingszeilen des Buches: »Wer glaubt denn wirklich daran, dass halb-vergammelte und überteuerte ›Bio‹-Äpfel gesünder sind als nicht-biologische Äpfel?«) Natürlich muss jede glaubwürdige linke Politik ökologische Belange zum Thema machen, aber es ist ein Fehler, nach einer »authentischen« Ökologie jenseits der simulierten Ökologie des Kapitalismus zu suchen. (Eine andere Lieblingszeile in First as Tragedy, Then as Farce: »Wenn es etwas Gutes am Kapitalismus gibt, dann dass Mutter Erde nicht mehr existiert.«) Organizismus ist das Problem und irgendeine Öko-Spiritualität wird die menschliche Umwelt nicht retten (wenn sie überhaupt gerettet werden kann), sondern neue Formen der Organisation und Verwaltung.
Sie ist nicht meine Mutter 60
»Interviewer: Wenn man diesen Film sieht, fällt es schwer, nicht daran zu denken, dass all unsere Erinnerungen Produkte sind.
Cronenberg: Das sind sie, das sind sie auf jeden Fall.«
Andrew O’Hehir
»The Baron of Blood does Bergman«61
»Watched from the wings as the scenes were replaying. We saw ourselves now as we never had seen. // Wir betrachteten das Schauspiel von der Seite. Wir sahen uns selbst wie noch niemals zuvor.«
Joy Division, »Decades«62
Cronenbergs Spider – eine Adaption von Patrick McGraths wunderbarem Roman – ist eine Studie über Schizophrenie, die meilenweit von den Klischees über »Wahnsinn« im Kino entfernt ist. Davon gibt es unzählige Beispiele, aber das, was mir sofort in den Sinn kommt (vielleicht, weil ich es zuletzt gesehen habe), ist Windom Earl in der zweiten Staffel von Twin Peaks: brabbelnd, theatralisch, megaloman. Man denke auch an Jack Nicholsons Darstellung des Jokers im ersten Batman-Film. Wahnsinn wird hier als eine Form des absurd übersteigerten Egos dargestellt; ein Selbst, das keine Grenzen kennt und sich unendlich ausdehnen möchte. In Cronenbergs Film hat Spider, gespielt von Ralph Fiennes, zwar auch ein aufmerksames Bewusstsein seiner eigenen Grenzen, doch anstatt sich in die Welt hinaus auszubreiten, möchte er sich vielmehr zum Verschwinden bringen. Alles an ihm – sein Gemurmel, seine ungelenken Bewegungen – schreit nach Rückzug, Flucht und Angst vor der Außenwelt. Und zwar deswegen, weil in Cronenbergs Schizoversum das Außen schon im Innen ist. Und umgekehrt.
McGraths Roman ist als eine Reihe von Tagebucheinträgen verfasst und spielt sich daher vollständig im Kopf des archetypisch unverlässlichen Erzählers Spider ab. Um das zu simulieren, hätte Cronenberg auf das Mittel des Voiceover zurückgreifen können, das im ursprünglichen Drehbuch vorgesehen war (obwohl alle, die Spike Jonzes Adaptation gesehen haben, sich an Robert McKees Tirade über diese Technik erinnern werden). Aber am Ende streicht Cronenberg Spiders Stimme vollständig, wodurch der Film merkwürdigerweise dem Roman eher gerecht wird als der Roman selbst. Im Buch erlaubt Spiders Artikuliertheit dem Protagonisten eine Art Selbstwahrnehmung und (wenngleich begrenzte) Distanz von seiner Manie. Im Film gibt es diese Distanz nicht, es gibt keine Stimme des Erzählers, nur eine endlos produktive Erzähl-Maschine, die verschiedene Permutationen auswirft. Anstelle einer transzendenten Offscreen-Stimme sehen wir Spider als Figur innerhalb seines eigenen Deliriums, wir sehen ihn als Erwachsenen, wie er beobachtet und schreibt, immer wieder schreibt, während sich die Erinnerungen an seine Kindheit abspielen. Wie Cronenberg es ausgedrückt hat, es ist, als ob Spider bei seinen Erinnerungen selbst Regie führt. »Ein Journalist sagte mir: ›Wenn wir Spider in seinen Erinnerungen sehen, wie er durchs Fenster schaut oder sich in der Ecke versteckt, ist das nicht wie ein Regisseur am Set?‹ So hatte ich noch nicht darüber nachgedacht, aber es stimmt, dass er seine Erinnerungen immer wieder steuert und choreographiert.«63 Wir werden daran erinnert, dass Spider jede Figur in seinen Erinnerungen selbst spielt.
Bei Spider handelt es sich also um einen naturalistischen Expressionismus oder expressionistischen Naturalismus. Das merkwürdig einsame London ist, so Cronenberg, ein expressionistisches London. Spider fängt präzise die Atmosphäre der Zeit der gekochten Kartoffeln in den fünfziger Jahren ein, noch bevor der Rock’n’Roll die Bühne betrat, und die gedämpften Farben des Films sind so trüb wie Kochwasser.
Am meisten ähnelt Spider dem Film Naked Lunch; nicht nur, weil er auch auf einem angeblich unadaptierbaren Buch beruht, sondern auch, weil es in beiden Filmen um Schreiben, Wahnsinn, Männlichkeit und den Tod einer Frau geht. Sowohl in Spider als auch in Naked Lunch ist das zentrale Ereignis der phantasmatisch immer wieder wiederholte Tod einer Frau, die Leerstelle, um die beide Filme kreisen. In Naked Lunch leugnet Lee zunächst den Mord an seiner Frau Joan und beruft sich auf die Kontrolle fremder Mächte. Erst als Lee am Ende des Films »gezwungen« ist, Joan erneut umzubringen, oder zumindest ihre Doppelgängerin, kann er ein Mindestmaß an Verantwortung übernehmen. Die Neuaufführung ihres Todes ist weniger ein Eingeständnis ethischer Verantwortung, sondern ein Versuch, die Tat selbst zu begreifen. Darin besteht die Logik des Traumas. (Was uns an eine Beschreibung des Motivs des Schizophrenen in Die Schreckensgalerie von Ballard erinnert: »Er wollte Kennedy erneut töten, aber diesmal so, dass es Sinn ergibt.«
In Spider glauben wir zunächst, dass sein Vater, Bill Cleg (Horace im Roman), Spiders Mutter getötet hat, nachdem er eine Affäre mit dem »fetten Flittchen« Yvonne begann (Hilda im Roman). Erst als Bill Yvonne bei sich einziehen lässt, ermordet er brutal und beiläufig seine Frau und rollt sie in ein hastig gegrabenes Loch im Garten (»Weg mit dem Alten« sagt Yvonne kaltschnäuzig). In diesem Moment erhärtet sich unser Verdacht, dass mit der Erzählung Spiders etwas nicht stimmt. Aber erst am Ende des Films erfahren wir, was wohl tatsächlich passiert ist: Spider hat seine Mutter umgebracht, er hat sie vergast, als er scheinbar einer Wahnvorstellung unterlag und sie für eine andere Person hielt. Die frühen Unterhaltungen zwischen Spider und seinem Vater nehmen jetzt eine andere Bedeutung an (Spider: »Sie ist nicht meine Mutter«. Bill: »Wer ist sie denn dann?«). In der Schlussszene sieht man Bill, wie er Spider aus dem Haus rettet und verzweifelt versucht, Yvonne wiederzubeleben, aus der im Moment ihres Todes wieder die dunkelhaarige Mrs. Cleg geworden ist.
Während es sich hierbei um die übliche Deutung der Geschichte handelt, schließt der Film doch keine der narrativen Möglichkeiten, die er eröffnet, aus:
1. Bill hat seine Frau getötet und lebte wirklich mit einer Prostituierten namens Yvonne zusammen.
2. Bill hat seine Frau getötet, es gibt eine Prostituierte namens Yvonne, aber sie ist nicht bei Bill eingezogen.
3. Bill hat seine Frau getötet, aber es gibt keine Yvonne.
4. Spider, nicht Bill, hat seine Mutter getötet, aber Bill ist mit Yvonne nach dem Tod in das Haus gezogen.
5. Spider hat seine Mutter getötet, es gibt eine Prostituierte namens Yvonne, aber sie ist niemals mit Bill zusammengezogen.
6. Spider hat seine Mutter getötet, aber es gibt keine Yvonne.
7. Weder Spider noch Bill haben die Mutter getötet, aber Bill ist nach ihrem Tod mit Yvonne zusammengezogen.
8. Weder Spider noch Bill haben Mrs. Cleg getötet, es gibt eine Yvonne, aber sie ist nicht bei Bill eingezogen.
9. Weder Spider noch Bill haben Mrs. Cleg getötet und es gibt keine Yvonne.
Anstatt die Ambiguitäten des Romans von McGrath aufzulösen, verstärkt Cronenbergs Film sie. Im Roman erfahren wir zumindest (scheinbar), dass Spider für den Mord an seiner Mutter eingesperrt wurde (auch wenn dieser daran festhält, dass sein Vater für den Tod der Mutter verantwortlich ist). Im Film bleiben die zwanzig Jahre zwischen dem Tod von Mrs. Cleg und Spiders Ankunft in der Pension eine Leerstelle. Wir wissen im Umkehrschluss, oder wir glauben zu wissen, dass Spider in einer psychiatrischen Anstalt war, aber mehr nicht.
Miranda Richardsons Performance ist von entscheidender Bedeutung für die Erhaltung der polysemen Ambiguität des Films. Sie ist in allen drei Rollen hervorragend: als die tugendhafte brünette Mrs. Cleg, die zügellose blonde Yvonne und auch als die plötzlich so unangemessen sexuell aggressive Besitzerin der Pension, Mrs. Wilkinson. Die Situation wird darüber hinaus dadurch erschwert, dass Yvonne zu Beginn von einer ganz anderen Schauspielerin gespielt wird (zumindest glaube ich das; es zeugt von dem mulmigen Delirium, das der Film inszeniert und von der Leistung Richardsons, dass ich mir nicht sicher bin), genauso wie Mrs. Wilkinson während des Großteils des Films von Lynne Redgrave gespielt wird.
Wie in Naked Lunch ist das Schreiben in Spider sowohl aktiv als auch passiv. Wie Bill Lee scheint auch Spider, wenn er irgendwelche idiolektischen Hieroglyphen in sein Notizbuch kritzelt, zunächst nur ein Signal von außen aufzuzeichnen. In anderer Hinsicht aber ist er der Schöpfer der ganzen Szene, er derealisiert sie.
In Gesprächen über den Film hat Cronenberg auf Nabokovs Theorie der Erinnerung und die Kunst als Mittel, das Unwiederbringliche zurückzuholen, verwiesen. Doch die Figur, die den Film dominiert, ist ein anderer Schriftsteller, den Brian McHale, wie Nabokov, als »Grenz-Modernisten« bezeichnet hat, nämlich Samuel Beckett. Cronenberg hat gesagt, dass der Look von Spider, mit seinen spitz aufgestellten Haaren, sehr von Fotografien Samuel Becketts beeinflusst war, doch die Affinitäten mit Beckett reichen noch tiefer. Wie Molloy oder Malone, wühlt Spider ständig in seinen Taschen nach Talisman-artigen Objekten. Solche bruchstückhaften Dinge markieren die Wegstrecke ihrer »intensiven Reise«. Wie McGrath verführt uns Cronenberg dazu, uns mit Spider zu identifizieren (Cronenberg: »Ich bin Spider«) und nimmt uns mit auf seinen schizophrenen Spaziergang, um uns dann im Delirium im Stich zu lassen …
Dieser Film bewegt mich nicht
Während ich gespannt auf den neuen Doctor Who warte (obwohl, nach McCoy, nach McGann, was kann man da noch fürchten?), lohnt es sich, noch einmal über die Anziehungskraft der Serie nachzudenken und überhaupt über die einzigartige Bedeutung dessen, was ich »unheimliche Literatur« nenne.
Ein Artikel von Rachel Cooke im Observer vor zwei Wochen macht deutlich, worum es geht.64 In dem Text geht es nicht einfach nur um die Serie, sondern darum, wie das Fernsehen, die Familie und das Unheimliche durch Doctor Who miteinander verwoben wurden. Cooke beschreibt eindrücklich, wie das gemeinsame Schauen der Serie in ihrer Familie gleichsam zum Ritual wurde: Sie musste mit gewaschenen Haaren auf dem Sofa sitzen, noch bevor die Serie überhaupt angesagt wurde. Cooke versteht, dass der Reiz der Serie zu ihren besten Zeiten in ihrer Aufladung durch das Unheimliche besteht – das merkwürdig Bekannte und das bekannte Merkwürdige: die Cybermen auf den Stufen der St Paul’s Cathedral, die Yeti in der Goodge Street (ein Ort, dessen Name für immer mit dem Throughton-Abenteuer »The Web of Fear« verbunden sein wird, für Scanshifts65, der die Folge gesehen hat, als er in Neuseeland lebte).
Allerdings endet ihr Text zwangsläufig auf einer melancholischen Note. Cooke besuchte eine Aufführung der ersten Folge der neuen Staffel. Ihr gefallen die hohen Produktionskosten, die »düsteren Momente« und wie das Millennium Wheel eingebaut wird. »Aber es ist nicht – wie soll ich sagen – Doctor Who.« Überwältigt von einem »Gefühl des Verlusts« greift sie zu einer DVD mit der Baker-Geschichte Robots of Death, um sich an das »echte Zeug« zu erinnern, die authentische Erfahrung, die die neue Staffel verwehrt. Das wiederum führt, wenn überhaupt, zu einer noch größeren Enttäuschung. »Wie langsam alles vor sich geht, wie lächerlich die Roboter in ihren grünen Jacken im Camilla-Parker-Bowles-Stil aussehen…oh weh.«
Lassen wir für einen Moment all die post-poststrukturalistischen Fragen über den ontologischen Status des Textes »an sich« beiseite und betrachten die Anekdote, mit der der Text endet:
»Vor Weihnachten, als klar wurde, dass der Krebs meines Vaters in die letzte Phase ging, ging mein Bruder los und kaufte eine DVD, die wir zusammen anschauen wollten. Papa war zu krank und die Box blieb ungeöffnet. Damals habe ich darüber Tränen vergossen; noch eine Ungerechtigkeit. Heute weiß ich es besser. Manche Dinge im Leben kann man nicht zurückholen – und die Freude über grüne Roboter in Pailletten und Pedal-Pusher-Jeans gehören dazu.«
Dieses Narrativ der Desillusionierung gehört zu einem inzwischen bekannten Genre: der postmodernen Parabel. Eine alte Folge von Doctor Who anzuschauen, ist nicht nur ein gescheiterter Versuch, einen verlorenen Moment wiederherzustellen; es ist die mit einem gedämpften, alltäglichen Schrecken einhergehende Erkenntnis, dass dieser Moment überhaupt nicht existiert hat. Eine Erfahrung der Ehrfurcht und Verzauberung löst sich in einen Haufen billige Kostüme und Spezialeffekte auf. Die Postmodernen haben dann zwei Möglichkeiten: eine Verleugnung der früheren Begeisterung, also das, was man »Erwachsenwerden« nennt, oder ihr die Treue halten, also »nicht Erwachsenwerden«. Auf das nicht mehr von den Medien verzauberte Kind warten zwei Schicksale: depressiver Realismus oder nerdiges Fantum.
Die Intensität, mit der sich Cooke Doctor Who nähert, ist typisch für viele von uns, die in den sechziger und siebziger Jahren aufgewachsen sind. Obwohl ich ein bisschen jünger bin, erinnere auch ich mich noch an eine Zeit, in der diese 25 Minuten die sakralsten der ganzen Woche waren. Scanshifts, der ein bisschen älter ist als ich, hatte als Kind eine Zeit lang keinen funktionierenden Fernseher, also schaute er die neuen Folgen in einem Kaufhaus in Christchurch, zuerst ohne Ton, bis er zu seiner großen Freude den Lautstärkeregler fand.
Ein Teil der Gründe für diese Begeisterung ist offensichtlich – kindliche Begeisterung und Naivität. Aber was waren die kulturellen und technologischen Bedingungen, die ihr zugrunde lagen? Freuds Analyse des Unheimlichen ist bekannt, doch es lohnt sich, sie mit dem Thema Fernsehen zu verbinden. Das Fernsehen war sowohl fremd als auch bekannt und eine Serie, bei der es gerade um das Fremde im Bekannten ging, hatte dadurch einen besonders leichten Zugang zum Unbewussten des Kindes. In einer Zeit der kulturellen Rationierung und des modernistischen Fernsehens, einer Zeit also, in der es keine ständigen Wiederholungen oder Videorekorder gab, haftete den Sendungen eine eigentümliche Vergänglichkeit an. In dem Moment, wo sie zuerst gesehen wurden, übersetzen sie sich sofort in Erinnerung und Traum. Das ist etwas völlig anderes als die sofortige – und oft vorauseilende – Monumentalisierung postmoderner Medienproduktionen durch »Making of«-Dokumentationen und begleitende Interviews. Viele dieser Produktionen teilen das merkwürdige Schicksal, im Zustand perfektiver Archivierung auf die Welt zu kommen, von der Kultur vergessen, während sie von der Technologie makellos einbalsamiert werden.
Aber waren die Gründe dafür, dass Doctor Who einen so großen Stellenwert im Unbewussten einer ganzen Generation einnehmen konnte, wirklich nur Mangel und die »Unschuld« einer »weniger anspruchsvollen« Zeit? Zerfällt die Magie der Serie wie ein Vampir im Sonnenlicht, wenn sie durch die nüchternen, unerbittlichen Augen eines Erwachsenen gesehen wird, wie Cooke nahelegt?
Wie Freud in Totem und Tabu das Unheimliche ausführt, wiederholt sich in der Moderne in der psychischen Entwicklung des Einzelnen der »Fortschritt« vom narzisstischen Animismus zum Realitätsprinzip der Gattung als Ganzer. Wie die sogenannten »Wilden« befinden sich Kinder auf der Stufe des narzisstischen Auto-Erotismus und hängen dem animistischen Irrglauben an, ihre Gedanken seien »allmächtig« und können unmittelbar die Wirklichkeit beeinflussen.
Doch stimmt es denn, dass Kinder »wirklich« an Doctor Who »geglaubt haben«? Žižek hat darauf hingewiesen, dass, wenn Menschen aus »primitiven« Gesellschaften nach ihren Mythen gefragt werden, ihre Antwort indirekt ist. Sie sagen »Manche Menschen glauben«. Glaube ist immer der Glaube der anderen. Was die Erwachsenen der Moderne jedenfalls verloren haben, ist nicht die Fähigkeit unkritisch zu glauben, sondern die Kunst, die Serie als Auslöser für bewohnbare, fiktionale Spielwiesen zu benutzen.
Das Vorbild für eine solche Praxis sind die Perky-Pat-Karten in Philip K. Dicks Die drei Stigmata des Palmer Eldritch. Heimwehkranke Kolonisten können sich selbst als Puppen im Stile Barbies und Kens imaginieren, die eine Attrappe der Erde bewohnen. Doch für diese Leistung benötigen sie eine Droge. Im Endeffekt erlaubt die Droge dem Erwachsenen, was dem Kind sehr leichtfällt: nicht die Fähigkeit zu glauben, sondern zu handeln, obwohl man nicht glaubt.
In gewisser Weise geht diese Deutung allerdings einen Schritt zu weit. Denn es wird impliziert, dass Erwachsene die narzisstische Phantasie wirklich aufgeben und sich an die harsche Banalität der entzauberten Empirischen gewöhnt haben. Tatsächlich haben sie die eine Phantasie nur durch die andere ersetzt. Im Konsumkapitalismus ein Erwachsener zu sein, bedeutet, in der Perky-Pat-Welt eintönig heller Seifenoper-Häuslichkeit zu leben. Was aus dem mittelmäßigen Melodram, das wir die Wirklichkeit der Erwachsenen nennen sollen, ausgestrichen wird, ist nicht die Phantasie, sondern das Unheimliche – das Gefühl, dass alles nicht ist, wie es sein sollte, dass der häusliche Alltag nur eine Kulisse für die Machenschaften von Parasiten und fremden Mächten ist, die uns entweder verfolgen, kontrollieren oder uns ihre Muster auferlegen. Mit anderen Worten, die unterdrückte Weisheit der unheimlichen Literatur ist, dass es DIESE Welt ist, die Welt des liberal-kapitalistischen Common Sense, die eine Bühne mit wackligen Wänden ist. Wie Scanshifts und ich in unserer nächsten Audiomentation auf Resonance FM zu zeigen hoffen, ist das Reale der Londoner U-Bahn besser durch Pulp und Modernismus zu beschreiben (die auf jeden Fall eine passend unheimliche Komplizenschaft unterhalten) als durch postmodernen Schrumpfrealismus (drearealism). Jeder weiß, dass, wenn die hauchdünne Schicht der »Personen« abgezogen wird, die Menschen in der U-Bahn sich als Zombies unter der Kontrolle außerirdischer Korporationen herausstellen.
Der Aufstieg des Fantasy-Genres in den letzten 25 Jahren steht in direktem Zusammenhang mit dem Zusammenbruch einer irgendwie anderen Wirklichkeit außerhalb des Kapitalismus in derselben Zeit. Bei einem Film wie Star Wars denkt man sofort an zwei Dinge. Seine fiktive Welt ist SOWOHL unendlich weit weg, viel zu weit entfernt, um sich darum zu kümmern, ALS AUCH unserer Welt viel zu ähnlich, als dass man von ihr fasziniert sein könnte. Zielt das Unheimliche auf die irreduzible Anomalie von allem, was irgendwie bekannt erscheint, geht es bei der Phantasie darum, eine lückenlose Welt herzustellen, in der alle Leerstellen von derselben Sache gefüllt werden. Es ist kein Zufall, dass der Aufstieg des Fantasy-Genres mit der Entwicklung digitaler Spezialeffekte korreliert. Die eigentümliche Leere und Tiefenlosigkeit von CGI kommt nicht von einem Mangel an Wirklichkeitstreue, sondern daher, dass es direkt aus dem Diskrepanten herauskopiert wurde.
Die Phantasiestruktur von Familie, Nation und Heroismus funktioniert daher nicht als wahre oder falsche Repräsentation, sondern als Modell, dem wir nacheifern sollen. Unser unweigerliches Scheitern am digitalen Ideal ist einer der Motoren der kapitalistischen Arbeiter-Konsumenten-Passivität, die gutmütige Jagd nach dem, was sich immer entziehen wird, eine Welt ohne Brüche und Diskontinuitäten. Man muss nur eine der schnöseligen, phallischen Fabeln von Mark Steyn lesen (die in dieselbe Liga gehören wie die Muttersöhnchengeschichten von Robert E. Howard), um zu sehen wie die lächerlich-idiotischen Gegenüberstellungen des Fantasy-Genres – Gut gegen Böse, Wir gegen (ein fremdes, ansteckendes) Sie – auf der größtmöglichen geopolitischen Bühne wirksam werden.
Angst und Elend im Dritten Reich’n’Roll 66
Mit etwas Verspätung habe ich vor ein paar Tagen, auf die Empfehlung von Karl Kraft hin, den traumatisch guten Film Der Untergang gesehen. Die Überbewertung von mittelmäßigem Schrott macht einen misstrauisch, wenn zeitgenössische Filme gelobt werden, aber dieser ist ein echtes Meisterwerk und zwar eines, das man nur im Kino richtig genießen, wo das unbarmherzige Hämmern der sowjetischen Artillerie und die klaustrophobische Enge von Hitlers Bunker eine erdrückend viszerale Wirkung haben.
Der Untergang ist der zweite Film in diesem Jahr [2005] (der erste war The Aviator), der mein ansonsten sehr verlässliches Motto widerlegte, dass Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen, zu vermeiden sind. Aber der Grund, warum beide Filme funktionieren, liegt darin, dass sie Situationen beschreiben, in denen die Realität selbst psychotisch geworden ist. Wie Ballard einmal schrieb, zeichnet sich das Delirium des Nationalsozialismus dadurch aus, dass die Unterscheidung zwischen Innen- und Außenwelt keinen Bestand mehr hatte: Die Hölle ist auf Erden ausgebrochen, es gibt keinen Ausweg, keine Zukunft und du weißt es ganz genau…