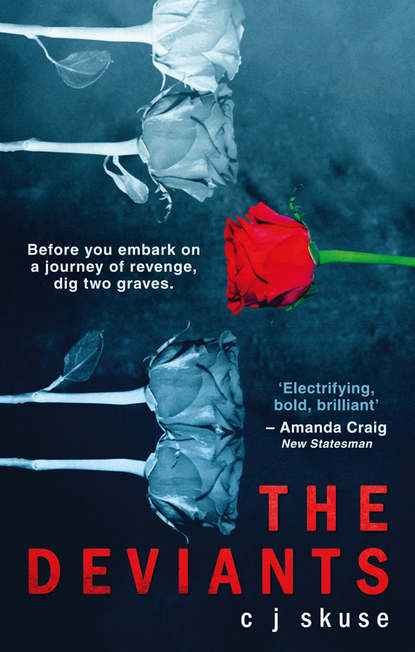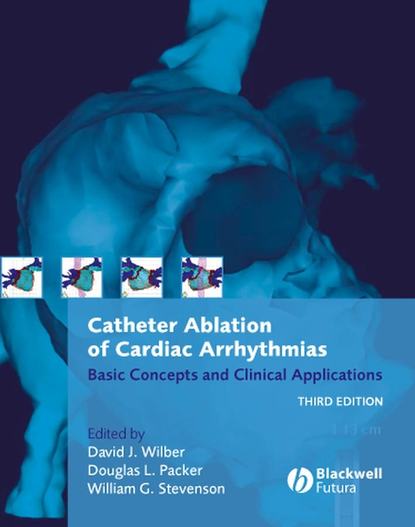- -
- 100%
- +
Der Untergang fasziniert, weil er aufmerksam und, wie ich annehme, akribisch die »Abschaffungslinie« dokumentiert, von der Deleuze und Guattari sagen, dass sie konstitutiv für den Nationalsozialismus ist. Deleuze und Guattari, die diese Idee von Virilio übernommen haben, galt die von den Nazis anvisierte Selbstzerstörung – »Wenn wir besiegt werden, soll auch die Nation untergehen« –, weniger als ein Zwangsprodukt kontingenter Umstände, sondern als die Verwirklichung, als der eigentliche Vollzug des nationalsozialistischen Projekts.67 Ihre Analyse mag empirisch fragwürdig sein, doch ihr Verdienst liegt weniger in der Diagnose, dass die Nazis suizidal waren, sondern in dem Gedanken, dass das Suizidale, das Selbstzerstörerische nationalsozialistisch ist.
Spätestens seit dem Tod Chattertons war die Versuchung der Populärkultur, die Selbstzerstörung zu verherrlichen, unwiderstehlich. Die Version des 20. Jahrhunderts dieser alten Romanze mit dem Tod boten die Nazis. Wie Ballard in seinem Essay über Hitlers Mein Kampf, »Alphabets of Unreason«, schreibt, handelt es sich bei den Nationalsozialisten um ein unheimliches Phänomen der Moderne, deren Technicolor-Glamour sich Welten weit weg von den pedantischen Figuren im Gehrock aus der englischen Elite zu Zeiten Eduards II. befand. Der Umgang der Nazis mit Radio und Fernsehen legte das Fundament für die Medienlandschaft, in der wir heute leben. War Hitler der erste Rockstar?
Der Untergang führt uns durch Szenen, in denen die Nazipartei zerfällt, damit das Dritte Reich’n’Roll beginnen kann. Der Tod des Frontmanns ist das rituelle Blutopfer, das eine scheußliche Unsterblichkeit garantieren wird. Hitler war der erste Mensch im 20. Jahrhundert, aus dessen historischer Besonderheit ein ewiges Archetyp-Artefakt im McLuhan-Ballard-Unbewussten der Medien geworden ist. Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King, Morrison, Hendrix wirkten nach ihm lokal, partikular, während Hitler für ein ganzes Prinzip stand, das moderne Böse schlechthin. Als Zuschauer von Der Untergang befinden wir uns die meiste Zeit im Führerbunker, gezwungen zu einer beunruhigenden Sympathie, weniger für die Elite des Dritten Reichs, sondern eher für die Sekretärinnen und Funktionäre, die Hitler und den Nationalsozialismus (keinesfalls fanatisch) bewunderten. Was wir von dem Berlin darüber sehen, gleicht einer Landschaft aus Brueghels Triumph des Todes, eine Stadt, die in totale Anomie zerfällt: Kindersoldaten, Lynchjustiz, berauschte Schwelgereien, karnevalesker, sexueller Exzess.
Während sich diese Szenen abspielten, hört man fast die Zeilen Johnny Rottens: »When there’s no future how can there be sin? // Ohne Zukunft, gibt es dann Sünde?« (Obwohl es für Deutschland eigentlich nichts anderes als die Zukunft gab: Nachkriegsdeutschland unterlag einer willfährigen Amnesie, einer Verleugnung der kulturellen Erinnerung.) Es ist kein Zufall, dass der Post-Punk in vielerlei Hinsicht hier ansetzt. Die Sex Pistols begannen ihre eigene Abschaffungslinie auf den Weg zum Nihilismus der verbrannten Erde mit »Belsen was a Gas« und »Holidays in the Sun« und kehrten immer wieder zu der von Stacheldraht überzogenen, wie von Hieronymus Bosch gezeichneten Landschaft des nationalsozialistischen Berlins und der Pynchon-Zone zurück, die nach dem Krieg existierte. Siouxsie war bekanntermaßen ein paar Mal mit einem Hakenkreuz zu sehen, und obwohl es bei dem Spiel mit Nazi-Symbolik vorgeblich um Schockeffekte ging, bestand die Verbindung zwischen Punk und Nationalsozialismus in mehr als der Lust an der Überschreitung. Die sehr englische Fixierung in den 1970er Jahren auf die Nazis warf ethische Fragen auf, die so beunruhigend waren, dass man sie kaum aussprechen konnte: Was sind die Grenzen liberaler Toleranz? Konnte sich England so sicher sein, dass es nichts mit dem Nazismus zu tun hatte (gerade in jener Zeit als die National Front eine bis dato unbekannte Unterstützung erhielt)? Und vor allem: Was unterscheidet das Böse der Nazis vom heroischen Guten?
Der Untergang stellt diese Fragen auf überzeugende Weise, vor allem in Hinblick auf Žižeks und Zupančičs Theorie vom unbedingten Akt als Bestimmung des Ethischen. Als ich die »monströseste« Tat des Filmes sah, die Szene, in der Frau Goebbels ihre Kinder betäubt und vergiftet – lieber diese »Erlösung«, so ihr Gedanke, als in einer Welt ohne den Nationalsozialismus zu leben –, war ich verblüfft von den Parallelen zu Sethe in Toni Morrisons Menschenkind, die eines ihrer Kinder umbringt, anstatt es in die Hände der Sklavenhalter geraten zu lassen. Was unterscheidet Frau Goebbels’ abscheuliche Tat des Bösen von Sethes heroischem Akt des Gutes? (Wer Das fragile Absolute gelesen hat, wird sich daran erinnern, dass Žižek Sethe als Beispiel für einen Akt des Guten anführt, der der liberalen Moral und ihrer Ethik des aufklärten Selbstinteresses vollkommen entgegensteht.)
Der Untergang scheint uns dazu anzuhalten, mit den »liberalen Nazis« zu sympathisieren, dem »vernünftigen Arzt« zum Beispiel, der die Krankenversorgung aufrechterhalten will und das »sinnlose, suizidale« Verhalten entsetzlich und abscheulich findet, das entsteht, wenn man seiner Pflicht bis zum Ende folgt; oder der General, der den Krieg beenden will, um das Leben von Zivilisten zu retten. Doch diese »pragmatischen Humanisten« sind am wenigsten zu verteidigen, da sie den Prinzipien ihrer Handlungen nicht bis zum Schluss folgen können. (Wenn sie wirklich auf den Nazismus schwören, warum nicht dann auch für ihn sterben? Und wenn sie es nicht tun, warum leisten sie keinen Widerstand?) Merkwürdigerweise scheint der Film nahezulegen, dass das untilgbar Böse des Nationalsozialismus in seinem Willen liegt, für die Sache zu sterben.
Ohne dass wir es wollen, erwischen wir uns plötzlich bei dem Gedanken, dass den bösen Nazis – also jene, die sich vollkommen mit dem nationalsozialistischen Projekt identifizieren, auch dann noch, als sie bemerken, dass es scheitert – eine Art tragischer Heroismus eigen ist, weil sie sich weigern, von ihren Überzeugungen abzulassen. All das führt uns wieder zu der Frage zurück: Legitimiert Kants unbedingte Pflicht das Böse des Nationalsozialismus?
Zupančič, die sich der kantischen Ethik aus der Perspektive der Theorie Lacans genähert hat, widmet sich dieser Frage in einem Interview mit der Zeitschrift Cabinet:
»Frage: Man denke daran, dass, nach Hannah Arendts berühmten Beispiel, Nazifunktionäre wie Eichmann sich selbst als Kantianer verstanden habe: Sie behaupten, aus Pflichterfüllung gehandelt zu haben, ohne an die Folgen ihrer Taten zu denken. Inwiefern ist das eine Verkehrung von Kant?
Antwort: Diese Haltung ist ›pervers‹ im strengen, klinischen Sinne: Das Subjekt übernimmt hier die Rolle eines bloßen Instruments für den Willen des Anderen. Mit Blick auf Kant würde ich folgendes Moment betonen, auf das schon Slavoj Žižek aufmerksam gemacht hat: In der kantischen Ethik sind wir verantwortlich für das, was wir als unsere Pflicht anerkennen. Das moralische Gesetz ist nichts, was uns aller Verantwortung enthebt; im Gegenteil, es macht uns nicht nur für unsere Handlungen verantwortlich, sondern auch – und vor allem – für die Prinzipien, nach denen wir handeln.«68
Reicht das, um Goebbels von Sethe zu unterscheiden? Stimmt es wirklich, dass sich Frau Goebbels zu einem »bloßen Instrument des Willen des Anderen« gemacht hat? Oder hat sie sich frei entschieden, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen und für die Prinzipien, nach denen sie gehandelt hat? Man denke daran, dass Freiheit bei Kant darin besteht, sich zu entscheiden, sich dem Gesetz zu unterwerfen. Von etwas anderem als »Pflichterfüllung« motiviert zu sein, heißt »pathologischen« Leidenschaften zu unterliegen und damit unfrei zu sein. Freilich gibt es keine offenkundig pathologischen Gründe für die Tat von Frau Goebbels. Sie hat nichts gewonnen durch diesen Akt der »Zerstörung dessen, was ihr am liebsten war« (und tatsächlich lässt sie sich kurz nach dem Mord an ihren Kindern von ihrem Ehemann erschießen).
Die einzige Antwort, die übrigbleibt, ist, dass der Nationalsozialismus selbst etwas Pathologisches ist. Per definitionem kann die nationalsozialistische Tat nicht universell sein, weil sie darauf beruht, die besonderen, pathologischen Eigenschaften eines »erwählten Volkes« zu erhalten – wenngleich am Ende auf der Ebene des Mythos –, und damit, etwas abstrakter gesagt, das Prinzip der »ethnischen Pathologie«. Sethes schreckliche Tat in Menschenkind ist ein tödliches Aussteigen aus einer gesellschaftlichen Situation, die von einem wiederum tödlichen und idiotischen Rassenwahn unrettbar korrumpiert wurde; Frau Goebbels mehrfacher Kindsmord hingegen, ist ein Versuch, sich selbst und ihre Kinder auf ewig mit einem ethnozidalen Wahn zu verbinden, der nur durch ihren Tod und den Tod von Millionen anderer Menschen am Leben bleiben kann.
Wir wollen alles 69
Welchen Nutzen könnte Nietzsche heute haben? Oder anders gesagt, welcher Nietzsche könnte heute nützlich sein?
Es dürfte kaum überraschen, dass ich den perspektivistischen Nietzsche – also den, der nicht nur die Möglichkeit, sondern auch den Wert der Wahrheit infrage stellt – als den Feind begreife. Noch weniger überraschend dürfte meine Ablehnung des dionysischen Nietzsche sein, den Zelebranten des transgressiven Begehrens. Dieser Nietzsche ist größtenteils ein retrospektives, post-Bataille’sches Konstrukt (selbst in der Geburt der Tragödie betrauert Nietzsche den Verlust der Spannung zwischen dem Dionysischen und Apollinischen; und in den späteren Schriften neigt er eher dazu, die Notwendigkeit von Grenzen und Einschränkungen zu loben, als dass er für eine zügellose Freisetzung der Libido argumentiert). Der perspektivistische und der dionysische Nietzsche sind beide viel zu zeitgemäß.
Der immer noch unzeitgemäße Nietzsche – und damit meine ich nicht veraltet, ganz im Gegenteil – ist Nietzsche, der Aristokrat. Nicht als politischen Theoretiker sollte man Nietzsche ernstnehmen, zumindest nicht auf der Ebene seiner positiven Aussagen. Es ist der Nietzsche, der die Geschmacklosigkeit und Mittelmäßigkeit denunziert, die aus den einebnenden Impulsen der Demokratie resultieren, der aktueller kaum sein könnte. In dieser Zeit der gruppenbezogenen Freundlichkeit und der »autonomen Herden« besticht Polemik um Polemik in Jenseits von Gut und Böse durch ihre unheimliche Triftigkeit. Nietzsches wahre Interessen lagen in der Kulturpolitik; Regierungen und gesellschaftliche Institutionen beschäftigten ihn nur insofern, als sie kulturelle Effekte hervorriefen. Seine ultimative Frage war: »Was sind die Bedingungen, unter denen großartige, kulturelle Artefakte entstehen?«
Als Chantelle Houghton vor einer Woche oder so Celebrity Big Brother gewann (es scheint schon viel länger her), musste ich an Nietzsches Warnungen denken, was passieren würde, wenn alle »Sonderforderungen und Privilegien« abgeschafft wären, wenn überhaupt die Idee der Überlegenheit verschwunden ist. Ich dachte auch an Nietzsches glühendes Plädoyer für die Kultivierung von »Härte« und »Grausamkeit«, wenn das menschliche Tier wirklich durch Hammerschläge und die Kraft des Willens in ein großes Kunstwerk verwandelt werden soll; vor allem als ein paar Beiträge auf Dissensus ernsthaft »Nettigkeit« – im Ernst, Nettigkeit – als erstrebenswerte Eigenschaft anpriesen.
Bei Chantelles Sieg ging es nicht nur um Beliebtheit: Wie Marcello in seinem ausgezeichneten Artikel über Big Brother schreibt, ging es um ein Prinzip, nämlich die Idee, dass Gewöhnlichkeit jede Form der Überlegenheit am Ende schlagen muss:
»›Man gewinnt weder Unterstützung noch Respekt, wenn man sich außerhalb des Gewöhnlichen stellt. Man muss zugänglich, aber auch authentisch sein. Das ist es, was die jungen Leute respektieren.‹ Diese Aussage kommt von einem Alex Folkes, dem Sprecher einer Lobbygruppe namens Votes at Sixteen und er bezieht sich auf George Galloway. Es ist diese anstrengende, alberne Antiphilosophie, wegen der ich überlege, ob ich eine Lobbygruppe mit dem Namen Votes at Thirty gründe. Allerdings passt die Aussage – leider – ziemlich gut in eine Zeit, in der es das Bedürfnis nach Göttlichkeit nicht mehr gibt. Während wir uns früher gemeinsam vor Fernsehern oder Bühnen versammelten, um in Ehrfurcht Menschen dabei zu zusehen, wie sie Dinge tun und erreichen, die wir uns niemals selbst zutrauen – und wie wir aber darin schwelgten und uns selbst emporschwangen, wenn wir davon träumten, es doch zu tun –, brauchen wir heute nicht mehr als einen demütigenden Spiegel. Deswegen kommen gefährliche Leute nicht an die Macht, aber aus demselben Grund wird auch alle Kunst unmöglich. Während wir uns früher gemeinsam vor Fernsehern oder Bühnen versammelten, um in Ehrfurcht Menschen dabei zu zusehen, wie sie Dinge tun und erreichen, die wir uns niemals selbst zutrauen […], brauchen wir heute nicht mehr als einen demütigenden Spiegel.«70
Darin besteht die Celebreality: der Star wird entsublimiert und zugleich auf das Level des »Gewöhnlichen« gehoben. Die Kommentare über Celebrity Big Brother nahmen es als gegeben hin, dass sich die Zuschauer mit den Medienfiguren, die ihnen ein bequemes und simples Spiegelbild in ihrer mittelmäßigsten, dümmsten und harmlosesten Form bieten, »identifizieren« wollen. Julie Burchills endlos wiederholtes Plädoyer für Big Brother – dass die Sendung der Arbeiterklasse erlaube, in Medienbereiche vorzudringen, die sonst nur den Privilegierten offenstehen – ist aus drei Gründen falsch. Erstens sind die echten Gewinner von Big Brother nicht die Teilnehmer, denn ihre »Karrieren« sind notorisch kurzlebig, sondern Endemol und ihre Clique von aalglatten Produzenten. Zweitens baut Big Brother auf einem paternalistischen und reduktionistischen Bild der Arbeiterklasse auf und braucht die Mittelmäßigen, die die Arbeiterklasse dazu bringen, sich in dieses Bild einzufügen und sich »damit zu identifizieren«. Und drittens haben Big Brother und das Reality-Fernsehen die Bereiche der Populärkultur verdrängt, in denen es der Arbeiterklasse um mehr ging als »Reichtum« und »Berühmtheit«. Der Aufstieg dieser Formate bedeutete die Niederlage für jenen umfassenden proletarischen Wunsch danach, mehr zu sein, (Ich bin nichts, aber ich sollte alles sein), ein Wunsch, der soziale Tatsachen negierte und klangliche Fiktionen dagegen setzte, der »Gewöhnlichkeit« verachtete und das Merkwürdige und Fremde vorzog. Bei Celebrity Big Brother war Pete Burns das Cartoon-hafte Symbol dieser verlorenen Ambitionen, mit seinen gelegentlichen Grausamkeiten, seiner wilden Ausdrucksweise und seinen Masoch-Pelzen, wie er schmollend an der Peripherie herumschlich, ein Glam-Prinz in einer Zeit der Post-Tony-Blair-Eierköpfe.
Wir alle wissen, dass die »Realität« des Reality TV eine raffinierte Konstruktion ist, ein Effekt nicht nur des Schnitts, sondern auch einer künstlichen Umgebung, die wie ein Experiment von Konrad Lorenz wirkt, in dem eine Ratte in einem Labor von lauter Spiegeln ausgesetzt wird, wodurch die Psychologie zu einer Reihe territorialer Zuckungen wird. Von Bedeutung ist an dieser »Realität«, was in ihr abwesend ist, nicht die positiven Eigenschaften, die sie vermeintlich hat. Und was abwesend ist, ist vor allem Phantasie. Oder besser gesagt, Phantasieobjekte.
Einst wandten wir uns der Populärkultur zu, weil sie Phantasieobjekte produzierte; heute sollen wir uns mit dem phantasierenden Subjekt selbst »identifizieren«. Es war geradezu folgerichtig, dass, eine Woche, nachdem Chantelle Celebrity Big Brother gewann, das Musikmagazin Smash Hits sein Ende bekanntgab.
Smash Hits entstand, als das Glam-Kontinuum gerade zu Ende ging. Das Magazin übernahm vom Punk den am wenigsten Nietzscheanischen Affekt, nämlich seine »Respektlosigkeit«. Bei Smash Hits schlug sich das in einer zwanghaften Trivialisierung nieder, verbunden mit der gutgelaunten Entmystifizierung des Starkultes. Hinter dem albernen Surrealismus von Smash Hits verbarg sich ein solider Common Sense sowie das widersprüchliche Begehren, seine Idole nicht nur besitzen, sondern auch töten zu wollen. Heat war der Nachfolger von Smash Hits und machte es überflüssig. Es brauchte keinen (Pop-) Vorwand mehr, nun konnte man sich einfach direkt mit Celebrities beschäftigen, ohne sich mit den peinlichen Träumen des Pop beschäftigen zu müssen. Chantelle ist die logische Schlussfolgerung dieses Prozesses: Anti-Pop und ein Anti-Idol.
Nietzsche ging davon aus, dass die Art von Nivellierung, für die Chantelle steht, unvermeidlich und notwendig zu jeder Form des Egalitarismus dazugehört. Die Popkultur war jedoch einmal der Bereich, in dem man sehen konnte, dass jeder echte Egalitarismus quer zu solcher Nivellierung steht. Über die Gothic-Kultur habe ich letztes Jahr [2005] geschrieben, dass es sich um eine »paradoxe egalitäre Aristokratie handelt, in der Mitgliedschaft nicht durch Geburt oder Schönheit garantiert wird, sondern durch die Dekoration des Selbst«. Ob wir von der Popkultur noch einmal lernen, dass Egalitarismus dem Willen zur Größe und einer bedingungslosen Forderung nach dem Ausgezeichneten nicht feindlich gegenübersteht, sondern auf ihnen beruht?
Gothic Ödipus:
Subjektivität und Kapitalismus in Christopher Nolans
Batman Begins 71
Batman hat mehr als genug zur »Dunkelheit« beigetragen, die wie ein pittoreskes Sargtuch über der gegenwärtigen Kultur liegt. »Dunkel« meint sowohl einen hervorragend zu vermarktenden ästhetischen Stil als auch einen ethischen, oder besser gesagt, anti-ethischen, Standpunkt, eine Art Hochglanz-Nihilismus, dessen theoretische Grundannahme die Verleugnung der Möglichkeit des Guten ist. Gotham, vor allem wie es Frank Miller in den 1980er Jahren neu erfunden hat, ist gemeinsam mit Gibsons Sprawl und Ridleys L.A. die wichtigste geomythische Quelle dieses Trends.72
Millers Einfluss auf die Comicwelt war höchstens ambivalent. Man bedenke, dass sein Aufstieg mit der absoluten Unfähigkeit der Superheldencomics, irgendwelche neuen Charaktere mit mythischer Resonanz hervorzubringen, zusammenfällt.73 Die »Reife«, für die Miller gefeiert wurde, korrespondiert der depressiven und introspektiven Adoleszenz seiner Comics, und die schlimmste Sünde ist für ihn, wie für alle Erwachsenen, das Übermaß. Daher sein charakteristischer wortkarger, deflationärer Stil: Man denke an all die bedeutungsschweren Seiten ohne Dialog, auf denen so gut wie nichts passiert und vergleiche sie mit der überschäumenden Spritzigkeit der typischen Marvel-Comics aus den 1960er Jahren. Millers Comics strahlen die brütende Stille eines launischen, fünfzehnjährigen Jungen aus. Es kann keinen Zweifel geben: die Stille bedeutet.
Miller bediente das unredliche, männlich-adoleszente Bedürfnis, sowohl Comics zu lesen als auch sich ihnen überlegen zu fühlen. Seine Entmythologisierung schuf aber unvermeidlich eine neue Mythologie, eine, die sich der verdrängten Mythologie überlegen wähnte, die aber in Wahrheit eine vollkommen vorhersehbare Welt der »moralischen Ambivalenz« darstellt, in der alles »Grau in Grau« ist. Es gibt Gründe, skeptisch gegenüber der von Miller eingebrachten, karikaturenhaften nihilistischen Leere zu sein, dem Noir light, der in Filmen und Büchern längst zum Klischee geworden ist. Die »Dunkelheit« seiner Perspektive ist hingegen eigentümlich beruhigend und ermutigend, und zwar nicht nur aufgrund der Sentimentalität, die sie nie los wird. (Millers »hartgesottene« Welt erinnert nicht so sehr an Noir, sondern an dessen Simulation in Dennis Potters Singing Detective, der Tagtraum-Phantasie eines erfolglosen Schriftstellers, voll von Misogynie und Misanthropie, durchzogen von extremen Selbsthass.)
Es ist kaum überraschend, dass Millers Art des Realismus in einer Zeit in den Comics auftauchte, da sich das Wirtschaftsmodell Reagans und Thatchers als die einzige Lösung für die Probleme der USA und Großbritanniens präsentierte. Beide behaupteten, uns von den »tödlichen Abstraktionen« der »Ideologien der Vergangenheit« erlöst zu haben.74 Sie weckten uns aus den angeblich falschen und gefährlich verblendeten Träumen der Gemeinschaft und machten uns wieder mit der »essenziellen Wahrheit« vertraut, dass der Mensch nur durch sein eigenes, animalisches Interesse motiviert werden kann.
Diese Versatzstücke gehören zu einem impliziten ideologischen Gerüst, das wir kapitalistischer Realismus nennen können. Auf der Grundlage einer Reihe von Annahmen – Menschen folgen ausschließlich dem Eigeninteresse, (soziale) Gerechtigkeit kann niemals erreicht werden – entwirft der kapitalistische Realismus ein Bild dessen, was »möglich« ist.
Für Alain Badiou indiziert der Aufstieg dieses beschränkten Möglichkeitssinns eine Phase der »Restauration«. Wie Badiou in einem Interview mit der Zeitschrift Cabinet erklärte, »meint ›Restauration‹ in Frankreich die Phase der Rückkehr des Königs 1815, nach der Revolution und nach Napoleon. Wir befinden uns in einer solchen Phase. Wir sehen den liberalen Kapitalismus und sein politisches System, den Parlamentarismus, als die einzig natürliche und annehmbare Lösung.«75 Laut Badiou tritt die Verteidigung dieser politischen Konstellation als ein Senken der Erwartungen auf:
»Wir leben in einem Widerspruch: Es herrschen brutale, zutiefst ungerechte Zustände – in denen jede Existenz allein in Geld gemessen wird – und diese Zustände werden uns als Ideal angeboten. Aber um ihren Konservatismus zu rechtfertigen, können die Parteigänger der herrschenden Ordnung diese Zustände nicht wirklich als ideal oder wunderbar bezeichnen. Also haben sie sich entschieden, einfach zu sagen, dass der ganze Rest schrecklich ist. Natürlich, so sagen sie, leben wir nicht in einer Welt des Guten. Doch zum Glück leben wir auch nicht in einer Welt des Bösen. Unsere Demokratie ist nicht perfekt. Aber sie ist immer noch besser als eine brutale Diktatur. Kapitalismus ist ungerecht. Aber er ist nicht so ein Verbrechen wie der Stalinismus. Wir lassen zwar Millionen Afrikaner an AIDS sterben, aber wir sind keine rassistischen Nationalisten wie Milošević. Wir töten Iraker mit unseren Flugzeugen, aber wir schneiden ihnen nicht mit Macheten die Kehlen auf wie in Ruanda, und so weiter.«76
Kapitalismus und die liberale Demokratie sind »ideal« genau in dem Sinne, als sie »das Beste« sind, »was zu erwarten ist«, will sagen, das am wenigsten Schlimme.77 Etwas davon hallt in Millers Darstellung des Helden in Die Rückkehr des dunklen Ritters und Batman – Das erste Jahr nach: Batman ist vielleicht autoritär, gewalttätig und sadistisch, aber in einer Welt endemischer Korruption ist er die am wenigsten schlimme Option. (Inmitten einer allgegenwärtigen Bestechlichkeit könnten solche Eigenschaften sogar notwendig sein.) Ganz im Sinne der Darstellung Badious ist es in Millers Gotham unmöglich geworden, die Existenz des Guten anzunehmen. Das Gute hat keine positive Präsenz – das einzige Gute, das es gibt, muss mit Verweis auf ein selbsterklärendes Böses bestimmt werden. Das Gute, mit anderen Worten, ist die Abwesenheit eines Bösen, dessen Existenz offen auf der Hand liegt.
Das Faszinierende der jüngsten Batman-Verfilmung, Batman Begins (unter der Regie von Christopher Nolan), liegt in der zaghaften Rückkehr zur Frage nach dem Guten. Der Film gehört immer noch zur »Restauration«, insofern als er sich nichts jenseits des Kapitalismus vorstellen kann: Wie wir sehen werden, dämonisiert Batman Begins eine bestimmte Form des Kapitalismus – das postfordistische Finanzkapital – und nicht den Kapitalismus an sich. Und dennoch lässt der Film die Möglichkeit eines Handelns offen, das der kapitalistische Realismus verneint.
Nolans Auseinandersetzung mit Batman ist keine Neuerfindung, sondern eine Aneignung des Mythos, eine große Synkrisis, die die ganze Geschichte der Figur einbezieht.78 Erfreulicherweise ist in Batman Begins nichts »Grau in Grau«, sondern es gibt vielmehr konkurrierende Versionen des Guten. In Batman Begins wird der von Christian Bale dargestellte Bruce Wayne von einer ganzen Reihe Vaterfiguren verfolgt (oder der fast vollständigen Abwesenheit von Müttern: Seine Mutter sagt fast kein einziges Wort), jede mit ihrer eigenen Version des Guten. Zunächst gibt es den biologischen Vater, Thomas Wayne, ein rosig weichgezeichnetes, moralisches Vorbild, die reinste Personifizierung des philanthropischen Kapitals, der »Mann, der Gotham erbaut hat«. Gemäß des schon in den Detective Comics der 1930er formulierten Batman-Mythos, wird Wayne bei einem willkürlichen Überfall getötet und überlebt lediglich als moralisches Gespenst, das das Gewissen des Waisenkindes belastet. Dann ist da R’as Al Ghul, der in Nolans Film als eine Art hypergläubischer (hyperstitious)79 Mentor-Guru figuriert, ein terroristischer Charakter, der den gnadenlosen, ethischen Code repräsentiert, der das komplette Gegenteil von Thomas Waynes wohlmeinenden Paternalismus ist. Unterstützt wird Bruce in seinem Kampf zwischen zwei Vaterfiguren (ein Kampf, den er in seiner eigenen Psyche austrägt) von einer dritten, den von Michael Caine gespielten Alfred, den »mütterlichen« Fürsorger, der dem jungen Bruce bedingungslose Liebe schenkt.