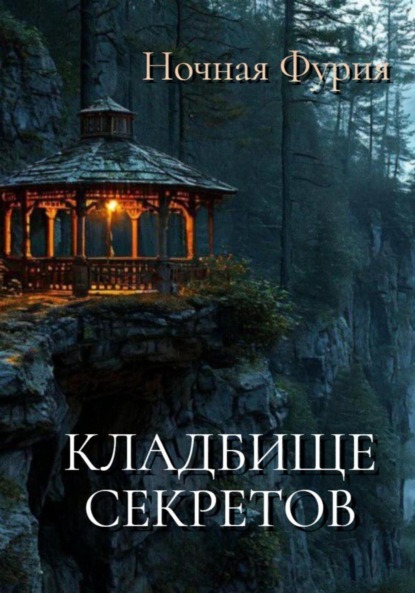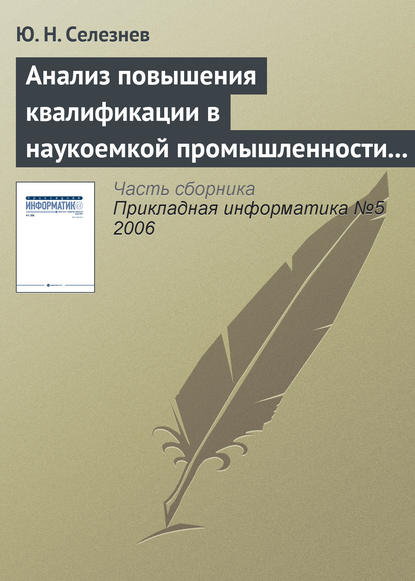- -
- 100%
- +
18
Ich war aus meiner Unbemerktheit gefallen, aus meinem Gehäuse. Aber das stimmt so nicht. Sein Blick und die Anerkennung, die mir daraus entgegengeleuchtet war, hatten lediglich den Raum um mich herum ein wenig gelichtet. Morgens nickte er mir zu. Ich nickte zurück. Abends hob er die Hand, wenn er ging. Ich hob die meine. Ein stummes Einverständnis. Du bist da. Ich bin da. Wir haben beide das Recht, einfach nur da zu sein.
Was sich zwischen uns verändert hatte, war bloß eines. Ich ahnte es. Dass ich jetzt, da er mich bemerkt hatte, ein Bild in ihm geworden war. Er hatte jetzt eine Vorstellung von mir, und seine tägliche Begrüßung galt dem Bild, das er sich von mir gemacht hatte. Er besah es sich. Ruhig. Sein Schauen war nicht aufdringlich. Ich wurde aufgenommen in seine Erinnerungen. Er erinnerte sich an einen Tag am Meer, feinkörniger Sand, struppiges Dünengras, er erinnerte sich an den Bart seines Vaters, harte Stoppel am Kinn, an ein bestimmtes Licht, wie es an einem Morgen im Spätherbst über den Rücken seiner Frau hinfiel, an ein Lächeln im Schaufenster, zufällig, das warme Fell einer Katze, die sich an ihn schmiegte. Er hatte tausend Erinnerungen, tausend Bilder, und ich war jetzt, da er mich bemerkt hatte, eines davon.
Ich ließ es zu. Ich bot ihm mein Profil, hielt still, damit er es in sich aufnehmen konnte. Schaute selbst auch zu ihm hin. Nahm ihn weiter in mich auf. So wurde aus unserer minimalsten Bekanntschaft eine minimale Freundschaft.
19
Miteinander zu sprechen wäre zu diesem Zeitpunkt noch eine Übertretung gewesen. Da war eine Grenze, der Kiesweg. Hier meine, dort seine Bank. Dazwischen Grashalme, ein rollender Ball, ein Kind, das hinterherpurzelte.
Zwei Jahre lang hatte ich mich darin geübt, das Sprechen zu verlernen. Zugegeben, es war mir nicht gelungen. Die Sprache, die ich gelernt hatte, durchdrang mich, und sogar, wenn ich schwieg, war mein Schweigen beredt. Ich sprach innere Monologe, sprach unentwegt in die Sprachlosigkeit hinein. Der Klang meiner Stimme jedoch hatte sich in mir verfremdet. Nachts wachte ich zuweilen schweißgebadet aus einem Albtraum auf, nur um ihn fortgesetzt zu finden in dem rohen Aaah, das aus meinem Bauch, meinen Lungen, meiner Kehle drang. Wer ist das, der da schreit, fragte ich mich und schlief wieder ein. Wanderte durch eine Landschaft, in der jeder Laut im Moment seines Entstehens verhallte. Der letzte Satz, den ich ausgesprochen hatte, war gewesen: Ich kann nicht mehr. Punkt. Ein vibrierender Punkt. Danach war etwas zugeschnappt. Die Anstrengung, die es kosten würde, dort weiterzusprechen, wo ich aufgehört hatte, stand gegen die Sinnlosigkeit, in Worte zu fassen, was sich nicht ausdrücken ließ.
Mein Zimmer glich nach wie vor einer Höhle. Hier war ich groß geworden. Hier hatte ich im eigentlichsten Sinne meine Unschuld verloren. Ich meine, groß zu werden bedeutet einen Verlust. Man glaubt zu gewinnen. In Wahrheit verliert man sich. Ich trauerte um das Kind, das ich einmal gewesen war und das ich in raren Momenten in meinem Herzen wild um sich schlagen hörte. Mit dreizehn war es zu spät gewesen. Mit vierzehn. Mit fünfzehn. Die Pubertät ein Kampf, an dessen Ende ich mich verloren hatte. Ich hasste mein Antlitz im Spiegel, das Sprießende, Treibende darin. Die Narben an meiner Hand stammen alle von dem Versuch, es wiedergutzumachen. Unzählige Spiegel, zerschlagen. Ich wollte kein Mann sein, der glaubt, er gewinnt. In keinen Anzug hineinwachsen. Kein Vater sein, der seinem Sohn sagt: Man muss funktionieren. Vaters Stimme. Mechanisch. Er funktionierte. Wenn ich ihn ansah, sah ich eine Zukunft, in der ich langsam, zu langsam ums Leben kommen würde. Nichts funktioniert, hatte ich zurückgegeben. Und dann: Ich kann nicht mehr. Dieser letzte Satz war mein Leitspruch. Das Motto, das mich überschrieb.
20
Derart überschrieben saß ich auf meiner Bank, als er wieder einmal, Punkt neun, plötzlich aufgetaucht war. Es war ein Donnerstag, ich erinnere mich: Er kam, gebeugt wie unter einer schweren Last. Ich bildete mir ein, er sei über Nacht gealtert. Die Falten an seinem Hals, als er mir zunickte. Da bist du ja. Ich nickte zurück. Und mehr noch als das: Ich nickte eine Einladung. Mir selber unbegreiflich, nickte ich ihm, der gealtert war, zu und nickte selbst dann noch, als er mir entgegenkam, zögernd, über die Grenze hinweg, und mir eine Zigarette anbot.
Ōhara Tetsu. Er verbeugte sich leicht. Hajimemashite.* Du rauchst nicht? Ist gut. Fang besser gar nicht damit an. Es ist eine Abhängigkeit. Siehst du, ich brauche das. Er setzte sich neben mich, zwischen uns seine Aktentasche. Das Klicken des Feuerzeugs, er paffte. Eins dieser Dinge, sagte er, die ich nicht lassen kann. Wieder nickte ich. Ich habe alles probiert. Umsonst. Ich komme nicht los davon. Mir fehlt der Wille. Sicher kennst du das. Belegte Stimme, er hüstelte. In der Firma, sagte er weiter, rauchen alle. Es ist der Stress, der nie aufhört. In der Firma. Er bückte sich, drückte die Zigarette aus. Den Rest des Morgens verbrachten wir schweigend auf unserer Bank. Mit einem Nicken war sie zu unserer geworden.
Hin und wieder kam jemand vorbei. Eine Mutter, die einen Kinderwagen schob. Ein hinkender Mann. Ein Grüppchen Schulschwänzer in zerknitterten Uniformen. Die Erde drehte sich. Auffliegende Vögel. Ein Schmetterling, der sich für Sekunden auf der Bank gegenüber niederließ. Nebeneinander sitzend, schauten wir ihm nach, wie er davonschwebte. Leise Ahnung, dass es von nun an kein Zurück mehr gäbe.
21
Von Kyōko, sagte er, als er zu Mittag sein Bentō auspackte. Karaage* mit Kartoffelsalat. Von meiner Frau. Sie ist eine wunderbare Köchin. Magst du? Nein? Er lächelte verlegen. Du musst wissen, sie steht jeden Morgen um sechs Uhr auf, um mir mein Bentō zuzubereiten. Dreiunddreißig Jahre lang. Jeden Morgen um sechs. Und das Beste daran: Es schmeckt! Er rieb sich den Bauch. Fast zu gut, stockend, für einen wie mich. Aber, nicht wahr, ich habe Glück! Mit diesen Worten wandte er sich seinem Essen zu.
Vor meinem inneren Auge sah ich Kyōko, seine Frau, im Nachthemd in der Küche stehen. Zischendes Öl. Ein Klecks Marinade an ihrem Ärmel. Sie hackt und rührt. Schält. Schneidet. Salzt. Das ganze Haus ist erfüllt von den Geräuschen des Hackens und Rührens. Des Schälens. Schneidens. Salzens. Er wacht auf. Noch halb im Schlaf, denkt er: Ich habe Glück. Er denkt es mit einer in ihrer Unermesslichkeit kaum erträglichen Traurigkeit: Ich habe verdammt großes Glück. Er steht auf. Geht ins Badezimmer. Beugt sich über das Waschbecken und dreht kaltes, sehr kaltes Wasser auf. Hält das Gesicht hinein, die Haare, den Nacken. Dreht weiter. Taucht auf. Und wieder unter. Bleibt untergetaucht. Dreht zu. Bleibt unten. Hört das Glucksen im Abfluss. Dreht auf. Zu. Auf. Zu. Sieht, wie das Wasser sich in Tropfen, die Tropfen sich in Tröpfchen teilen. Ein Klecks Zahnpasta am Beckenrand. Weiß auf Weiß. Er greift mit dem Finger hinein und –
– Kyōko weiß es nicht. Ein leichtes Aufstoßen. Er sprach wie zu sich selbst: Kyōko weiß nicht, dass ich hierher komme. Ich habe es ihr nicht gesagt. Gedehnte Silben: Ich ha-be ihr nicht ge-sagt, dass ich mei-ne Ar-beit ver-lo-ren ha-be.
22
Die Pause danach. Ich war zum Mitwisser geworden. Eben erst ausgesprochen, hatte uns sein Geheimnis zu Verbündeten gemacht. Es war das Gewicht in meinen Füßen, die Unmöglichkeit, endgültig, auf und davonzugehen. Er hatte sich mir anvertraut, allein mir. Ich schaute auf die Schuhe, die mich drückten. Ausgebeult und abgegangen. Einen halben Meter vor sich stellte er die Fersen auf. Schwarzes Leder, glattpoliert. Vaters Schuhe, schoss es mir durch den Kopf. Ob wohl auch er manchmal Sehnsucht danach hat, sich jemandem anzuvertrauen? Mit einiger Bitterkeit bemerkte ich: Ich wusste weniger über ihn als über den, dessen Namen ich vor knapp drei Stunden erst erfahren hatte. Ein Grund mehr, neben ihm sitzen zu bleiben und ihm erneut, über seine Aktentasche hinweg, zuzunicken.
Schon komisch. Er nahm den Faden wieder auf. Es ist nicht so, dass ich es Kyōko nicht sagen wollte. Nein, ich wollte es. Aber dann. Ich brachte es nicht übers Herz. Irgendetwas hielt mich zurück. Vielleicht die Gewohnheit. Grauer Rauch aus seinem Mund. Die Gewohnheit, in der Früh aufzustehen und mir das Gesicht zu waschen. Sie bindet mir die Krawatte. Im Hinausgehen rufe ich: Einen schönen Tag. Sie ruft: Dir auch. Sie winkt mir nach. Bei der ersten Wegbiegung drehe ich mich noch einmal nach ihr um. Ihre Gestalt vor dem Haus. Wie eine wehende Fahne. Ich könnte zurücklaufen. Aber da kommt schon der Bus. Ich steige ein. Es geht zum Bahnhof. In den Schnellzug. Nach A. In die U-Bahn. Nach O. Auf eine Art, er lachte, geht es. Nicht ich. Er lachte noch immer. Es geht.
23
Und du? Was treibt dich her? Ich zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung? Hm, du bist ja noch jung. Achtzehn? Ich fror ein. Neunzehn? Zwanzig? Unglaublich, so jung. Alles vor sich zu haben. Nichts hinter sich. Er seufzte. Unglaublich, selbst einmal so jung gewesen zu sein. Dabei. Was heißt das schon? Ich meine, es gibt für jeden nur ein Alter. Ich war und bin, werde immer achtundfünfzig sein. Du aber. Pass auf, welches Alter du dir aussuchst. Es klebt an einem. Es klebt einen zu. Das Alter, das du dir aussuchst, ist wie Klebstoff, der sich um dich herum verhärtet. Diese Weisheit stammt allerdings nicht von mir. Ich habe sie aus einem Buch. Einem Film. Ich weiß es nicht mehr. Man merkt sich Sachen. Unglaublich. Man merkt sich ein Leben lang Sachen.
Während er in der Zeitung las, dachte ich darüber nach, was er gesagt hatte. Doch je mehr ich darüber nachdachte, entglitt mir das Was und stattdessen war es das Wie, das mich gefangen nahm. Der verbrauchte Tonfall, mit dem er den Wörtern einen herben Geschmack beigegeben hatte. Ob jung oder unglaublich, beides hatte so, wie er es gesagt hatte, eine würzig schwere Note bekommen und beides war so, wie ich es gehört hatte, ein und dasselbe Wort gewesen. So spricht man, dachte ich, wenn man sehr lange geschwiegen hat. Alle Wörter sind einem dann gleich und man kann kaum verstehen, was das eine vom anderen trennt. Ob Klebstoff oder Leben, es machte keinen allzu großen Unterschied.
24
Sein Schlaf kam jäh. Auf Seite zwei des Sportteils hatte er ihn erwischt. Die Lehne im Rücken war er mit gesenktem Kopf eingedöst. Seine Handflächen offen über dem Mannschaftsbild der Giants. Ein Netz aus Linien. Die des Herzens durchkreuzt. Schmierige Druckerschwärze am rechten Zeigefinger. Wieder glich er einem Kind. Harmlos. In seiner Harmlosigkeit unbeschützt. Und wieder spürte ich den Wunsch, ihn zuzudecken, diesen natürlichen Wunsch, ihn, wie auch immer, vor einem Unheil zu bewahren.
Als er erwachte, war es schon halb sechs vorbei. Gähnend streckte er sich und wischte sich den Sand aus den Augen. Ein paar Minuten noch, sagte er zwinkernd, dann geht der Tag zu Ende. Keine Überstunden heute. Er faltete die Zeitung zusammen. Das Schönste am Arbeiten ist das Nachhausekommen. Mein erster Satz, wenn ich, durch die Tür herein, im Eingang stehe. Es riecht nach Knoblauch und Ingwer. Frisch gedünstetem Gemüse. Ich stehe im Eingang, sauge diesen Geruch in mich ein und sage: Das Schönste am Arbeiten ist das Nachhausekommen. Kyōko schimpft mich einen Dummkopf dafür. Aus ihrem Mund klingt es wie das zärtlichste Du. Ganz ohne Beleidigung. Verstehst du? Sie könnte mich weitaus Schlimmeres nennen. Einen Lügner, einen Betrüger. Und trotzdem wäre darin, ich hoffe es inständig, dieselbe Zärtlichkeit, mit der sie mich einen Dummkopf schimpft. Obwohl. Ich will es lieber nicht wissen. Solange noch Hoffnung ist, will ich nicht wissen, wie es wäre, wenn ich ihr die Wahrheit sagte. Und wozu überhaupt? Sie hat Besseres, sehr viel Besseres als die Wahrheit verdient.
25
Fünf vor sechs. Er zupfte sich die Krawatte zurecht. Nicht zu hastig. Eher, als ob er sich zurückhalten müsste. Ein gezäumtes Pferd, das sich selbst am Riemen reißt. Immer wieder schüttelte er seinen Arm in die Höhe, schob den Hemdsärmel beiseite, schaute auf die Uhr. Ich gehe jetzt. Drei vor sechs. Nein, ein bisschen noch. Zwei vor sechs. Nun aber wirklich. Eins vor sechs. Also dann. Bis morgen? Ich nickte. Er sagte leise, fast nicht hörbar: Ich danke dir. Ein letzter Blick auf das Handgelenk. Punkt sechs. Mit einem Ruck hatte er sich erhoben. Ich tat es ihm nach. Wir standen Aug in Aug, gleich groß. Auf Wiedersehen. Meine Stimme. Nach zwei Jahren des Schweigens war sie von gläserner Durchsichtigkeit. Auf Wiedersehen. Das war es. Ein krispes Aufeinandertreffen von Konsonanten und Vokalen. Noch einmal verstummte ich. Danach brach es aus mir heraus: Mein Name ist Taguchi Hiro. Ich bin zwanzig Jahre alt. Zwanzig ist das Alter, das ich mir ausgesucht habe. Ich verbeugte mich, linkisch, blieb in der Verbeugung, bis er gegangen war. Sonderbare Genugtuung: Ich kann das noch. Mich jemandem vorstellen. Ich habe es nicht verlernt. Auch wenn mir mein Name auf der Zunge zerkrümeln mag.
26
Während ich nach Hause ging, spann ich seine Geschichte weiter. Vielleicht hatte es gereicht, dass er sich mir anvertraut hatte, und er würde an diesem Abend noch heimkehren und sich aussprechen. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht würde er es so lange hinausschieben, bis die letzten Ersparnisse aufgebraucht wären. Und vielleicht war es gerade das, worauf er wartete: Dass Kyōko dahinterkäme. Dass sie eines Tages aufwachte, mit dem mulmigen Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Sie würde Nachforschungen anstellen, ihm auf die Schliche kommen, ihn zur Rede stellen. Und vielleicht waren wir uns eben darin ähnlich. Wir sahen beide dabei zu, wie uns alles entglitt, und fühlten beide eine heimliche Erleichterung darüber, nicht in der Lage zu sein, die Dinge geradezubiegen. Vielleicht war das der Grund, warum wir aufeinandergetroffen waren. Um gleichzeitig und unabweisbar festzustellen: Dass es uns nicht möglich ist, nicht von hier, nicht von jetzt aus, das, was geschehen ist, rückgängig zu machen. Und vielleicht war deshalb seine Geschichte auch die meine. Sie handelte von dem, was er unterlassen hatte und was demnach nicht rückgängig zu machen war.
So viele Menschen, die nach Hause gingen. So viele Schuhe im Gleichschritt, ich kam aus dem Takt. Dort vorne, unter der Straßenlaterne, sah ich Vater, wie er an einem blühenden Strauch vorbei, den Blick stur zu Boden, von der Arbeit kam. Er sah mich nicht. Ich hatte mich rechtzeitig hinter einem Getränkeautomaten versteckt. Ich wollte uns, ihm und mir, die Peinlichkeit ersparen, uns auf offener Straße zu begegnen und nichts zu sagen zu wissen. Erst als er um die Ecke gebogen war, tat es mir leid, ihm nicht wenigstens einen Guten Abend gewünscht zu haben.
27
Ein herrlicher Tag, was? Wenn der Himmel so blau ist, würde man am liebsten ans Meer hinausfahren. Schade eigentlich. Er sah kopfschüttelnd an sich herunter. Da habe ich frei und bin es doch nicht. Aber morgen ist auch noch ein Tag. Er setzte sich. Seufzte. Taguchi Hiro also. Ich dachte ja schon, du seist stumm und irgendwie, ich gebe es zu, wäre mir das sogar recht gewesen. Natürlich nicht wirklich, wenn du verstehst. Er kratzte sich am Kinn. Vor dem Grün der Bäume hinter ihm warf eine Läuferin die Arme in die Luft. Sie trabte weiter, rotes Stirnband. Von der Straße kam leises Gehupe. Das Geräusch von Autos, an- und abschwellend. Es verfing sich in den Büschen ringsherum, blieb außerhalb des innersten Kreises, der uns umschloss.
Er fuhr unvermittelt fort. Irgendwie wäre es mir recht, wenn Kyōko wüsste, dass ich hierher komme. Sie tröstet mich, die Vorstellung, sie wüsste, instinktiv, aus ihrem Bauch heraus, wäre, weil sie es wüsste, meine Komplizin, machte mir zuliebe mit. Erbärmlich, nicht wahr? Die Vorstellung, sie würde aus freien Stücken mitmachen. Heute früh, als sie mir die Krawatte band, sagte sie, und sie sagte es ernst: Wenn man nur verrückt genug wäre, alles anders zu machen. Einmal auszubrechen, sagte sie und holte kurz Luft. Das wäre der Moment gewesen, ihr zu gestehen, dass ich längst draußen bin. Aber da hatte sie die Krawatte schon fertiggebunden und was blieb, war alleine die Scham. Ich schäme mich meiner Scham. Wie viel Kraft ich dafür aufwende, sie vor mir selbst und Kyōko zu verbergen. Denn es ist doch so: Ich habe nicht nur meine Arbeit verloren. Der Verlust, der am schwersten wiegt, ist der der Selbstachtung. Mit ihm fängt aller Niedergang erst an. Wenn man am Ende eines überfüllten Bahnsteigs steht, die Lichter des herannahenden Zuges sieht und sich dabei ertappt, den einen Augenblick zu berechnen, in dem ein Sprung auf die Gleise den sicheren Tod bedeuten würde. Man tritt einen Schritt nach vorn. Man spürt jetzt! jetzt! jetzt! und dann: Nichts! So ein dunkles Nichts! Nicht einmal dafür taugt man noch. Der Zug fährt ein. Er ist voller Menschen. Man spiegelt sich in den Fenstern, die an einem vorübergleiten, und erkennt sein eigenes Gesicht nicht mehr.
28
So! Er straffte sich. Nun aber Schluss. Ich rede und rede. Du musst denken, ich könne keinen Punkt setzen. Genug von mir. Jetzt bist du dran. Erzähl mir was.
Was?
Ganz egal. Das erste, was dir einfällt. Ich höre zu.
Und damit lehnte er sich zurück und schien tatsächlich nichts anderes vorzuhaben, als zuzuhören.
Wo anfangen? Ich suchte nach einem Wort, das seinem letzten gerecht werden würde. Es ist schwierig, sagte ich. Das erste, was mir einfällt, ist, dass es schwierig ist, etwas zu erzählen. Jeder Mensch ist eine Ansammlung von Geschichten. Ich aber. Ich zögerte. Ich habe Angst davor, Geschichten anzusammeln. Ich wäre gerne nur eine, in der nichts passiert. Angenommen, Sie werfen sich morgen früh vor den Zug. Was gälte dann das, was ich Ihnen heute erzähle? Und ist es überhaupt von Gültigkeit? Wie gesagt. Es ist schwierig. Das erste, was mir einfällt, ist: Wir treiben auf schmelzendem Eis.
Ein hübscher Satz. Er wiederholte ihn. Wir treiben auf schmelzendem Eis. Von dir?
Nein, nicht von mir. Von Kumamoto. Ich schluckte. Von Kumamoto Akira.
Das Sprechen überschwemmte mich. Ich war ein ausgetrocknetes Flussbett, in das nach Jahren der Dürre ein starker Regen fällt. Der Boden saugt sich schnell voll und danach gibt es kein Halten mehr. Das Wasser steigt und steigt, über die Ufer hinweg, reißt Bäume und Sträucher nieder, leckt über das Land. Eine Befreiung, mit jedem Wort, das ich sprach.
29
Kumamoto schrieb Gedichte. Seine Schulhefte waren voll davon. Stets auf der Suche nach dem perfekten Gedicht, seine fixe Idee, saß er, einen Bleistift hinter das Ohr geklemmt, vollkommen abgezogen von der Welt, ein Poet durch und durch, selbst ein Gedicht.
Wir waren beide in derselben Abschlussklasse. Beide unter demselben Druck, sie zu bestehen. Er nahm es leichter als ich. Oder besser, er tat so. Wofür lernen, witzelte er, wenn mein Weg ein vorgezeichneter ist. Unübersehbar. Die Fußstapfen derer, die ihn vor mir gegangen sind. Mein Urgroßvater, mein Großvater, mein Vater. Alles Juristen, die ihn für mich geebnet haben. Ich muss nichts lernen. Sie haben es bereits für mich getan. Ich muss es bloß wiederkäuen und hernach ausspucken. Das ist, was ich ihnen schuldig bin. Schau her! Er zeigte mir eins seiner Hefte. Zerrissen. Vater meint, die Gesellschaft brauche keine Sonderlinge. Nun, er hat Recht. Ich kann nur einfach nichts dafür. Ich habe Stunden darauf verwendet, es wieder zusammenzukleben.
Unter einem der Klebestreifen las ich: Die Hölle ist kalt. Die perfekteste Zeile, sagte er, die er bislang zustande gebracht habe.
Das Feuer der Hölle ist kein wärmendes Feuer.
Ich erfriere daran.
Kein Ort ist so kalt wie diese brennende Wüste.
Dicke Bleistiftstriche. Ins dünne Papier gepresst. An einigen Stellen fehlte ein Schnipsel. Es macht nichts. Kumamoto klopfte sich dreimal gegen die Brust. Es ist alles da drinnen. Mein Jisei no ku*.
30
Zuerst verstand ich ihn nicht. Ich verstand ihn genausowenig wie die Gedichte, die er schrieb. Ich las sie und verstand die Wörter, die sie formten. Ich verstand Hölle und Feuer und Eis. Aber den Abgrund, den sie bezeichneten, den zu verstehen hätte es einer Art zu lesen bedurft, die sich tief nach unten begab, und ich scheute davor zurück, wohl weil ich ahnte, dass ich ebendort war und es dennoch nicht wahrhaben wollte. Dabei. Wenn ich ihn damals verstanden hätte, es wäre vielleicht manches anders gekommen, doch wer weiß das schon? Wer weiß, wofür etwas gut, und ob es zählt, dass es gut ist? Soweit ich mich erinnere, ist gut keine Vokabel, die Kumamoto jemals gebrauchte.
Wir wurden trotzdem Freunde. Gute Freunde. Ich bewunderte seine Unbeirrbarkeit. Von ihm ging das Licht eines Menschen aus, der genau wusste, wohin er ging und dass es dort, wohin er ging, schrecklich einsam sein würde. Er hielt nichts von Meinungen. Er lachte mit denen, die über ihn lachten. Wie über seinen Vater sagte er dann: Sie haben ja Recht. Ich kann nur einfach nichts dafür. Er sagte es mit einem Zwinkern. Es war ein dahingezwinkerter Spruch.
Was er an mir bewunderte?
Ich weiß es nicht. Vielleicht, dass ich ihm ganz und gar anhing. Ich vertraute ihm und seiner Heiterkeit. Ich vertraute darauf, dass da jemand war, der immer jung bleiben würde, und der, wenn ich tot wäre, immer noch, mit schneeweißen Haaren, von dem perfekten Gedicht träumen würde.
31
Wir trafen uns meistens am Abend. Er liebte die Dämmerung. Das Licht, sagte er, sei dann traurig und freudig zugleich. Es trauere um den Tag, der vergangen, es freue sich auf die Nacht, die angebrochen sei. Wir gingen ziellos in den Straßen spazieren. Kumamoto, mich hinterherziehend, um ihn herum der Geruch einer fremden Landschaft. Er roch nach Böden, die zentimeterdick zugefroren waren, nach seltsamen Pflanzen, die sich darunter verdeckt hielten. Wenn sie aufgingen, fragte ich mich, was würde dann an die Oberfläche kommen?
Die Antwort war eine Kreuzung.
Kumamoto machte halt. Über ihm flutete in Neonbuchstaben eine Werbung für Haarshampoo. Männer und Frauen liefen in großen Bögen an uns vorbei. Wir waren eine Insel inmitten wogender Wellen. Eine Umklammerung, plötzlich, Kumamoto hielt mich fest. Mit beiden Händen hatte er meine Arme umfasst. Ich hab’s, rief er, es gibt kein perfektes Gedicht! Seine Vollkommenheit muss gerade darin bestehen, dass es unvollkommen ist. Begreifst du es? Ich wollte es nicht begreifen. Er, in mein Ohr hinein: Ich habe ein Bild im Kopf. Ich sehe es deutlich vor mir. Seine Farben sind in ihrer Schärfe blendend grell. Sobald ich es jedoch restlos erfasst habe, explodiert es, und was ich niederschreibe, sind einzelne Teile, die kein Ganzes ergeben. Begreifst du es jetzt? Es ist, als ob ich versuchte, eine Vase, die kaputtgegangen ist, Stück für Stück zusammenzuleimen. Doch die Splitter sind so zerbröselt, dass ich nicht weiß, welcher zu welchem gehört, und wie ich sie auch aneinanderfüge, es gibt immer einen Splitter, der übrigbleibt. Dieser Splitter aber! Er macht das Gedicht. Durch ihn allein bekommt es Sinn. In seiner Stimme war ein Fieber: Mein Sterbegedicht soll eine Vase sein, durch deren gekittete Sprünge das Wasser dringt.
Er ließ mich los. Ich schwankte. An meinen Armen spürte ich den Abdruck seiner Finger.
Du bist ja krank, flüsterte ich.
Er gab zurück: Du auch.
Es war eine Warnung. Ich hörte und überhörte sie.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.