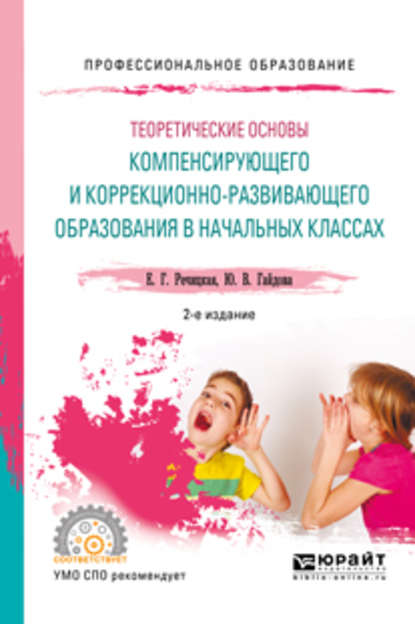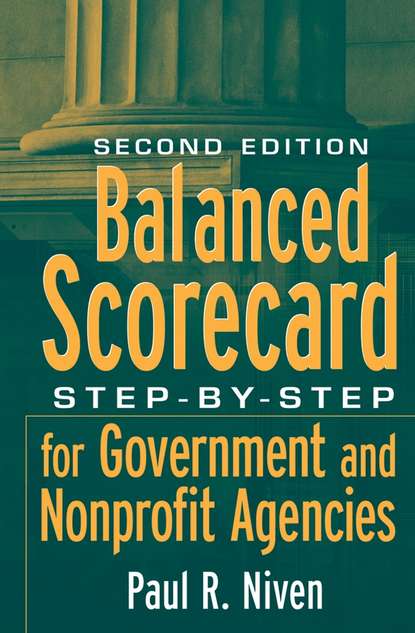- -
- 100%
- +
Bärbel, während Opitz noch so sprach, klopfte mit dem Knöchel an die Wand, was das Zeichen für Christine war, und zündete gleich danach einen Fidibus an, woran Opitz, der sonst in solchen Dingen für das Neue war, eigensinnig festhielt. Er hatte nur zufällig einen Haß gegen Schwefel- und Phosphorhölzer.
Und nun brachte Christine den Kaffee.
»Nu, Christine, laß sehen! Ich hoffe, du hast nicht zuviel Bohnen aus der Mühle springen lassen. Oder hat die Frau gemahlen? Na, na, nur still... Spaß muß sein... In Querseiffen ist heute Tanz. Was meinst du, willst du hin? Die Frau wird es schon erlauben; nicht wahr, Bärbel?«
Die Frau nickte.
»Nun siehst du. Der Lehnert wird auch wohl dasein, und das ist doch die Hauptsache. He? Na, tu nur nich, als ob's anders wär... Und daß ihn Siebenhaar heute angepredigt und ihm den Kopf a bissel gewaschen und seinen Standpunkt klargemacht hat, na, das wird ihn dir beim Schottschen nicht verleiden und noch weniger draußen in der Laube. Tanz ist Tanz, und Kuß ist Kuß. Und ich gönne ihn dir auch, und heute lieber als morgen. Denn du bist eine verständige Person und wirst ihn schon zurechtrücken, besser als Siebenhaar. Und ist er erst aus dem Dünkel heraus und sitzt an der Wiege, vielleicht sind es Zwillinge, was meinst du, Christine? Ja, was ich sagen wollte, sitzt er erst an der Wiege, statt zu paschen und zu wildern, dann werd ich auch gute Nachbarschaft mit ihm halten. Ich bin für Frieden, aber zu gutem Frieden gehören zwei.«
Christine hatte, während Opitz so redete, den linken Schürzenzipfel in die Hand genommen und strich an dem Saum entlang. Als er jetzt schwieg, sagte sie: »Nichts für ungut, Herr Förster, aber wenn sie besser mit ihm wären...«
»... da wär er besser mit mir«, lachte Opitz. »Ja, das glaub ich. Ich soll anfangen und jeden Morgen, wenn ich ihn drüben hantieren seh, meine Kapp abnehmen und über die Brück hinübergrüßen: ›Guten Morgen, Herr Lehnert Menz. Herr Lehnert Menz geruhten wohl zu ruhen. Ach, sehr erfreut. Empfehle mich zu Gnaden...‹ Nein, nein, Christine, Unterschiede müssen sein, Unterschiede sind Gottes Ordnungen. Und nun geh und komme nicht zu spät. All Ding will Maß haben.«
Christine ging. Frau Bärbel aber hatte mittlerweile nach ihrem Strickstrumpf gegriffen und sah verstimmt vor sich hin, weil es ihr gegen die Hausfrauenehre war, daß Opitz sich in ihre Sache gemischt und der Christine, so mir nichts, dir nichts, einen Ausgehetag angeboten hatte. Sie schwieg aber, und erst als Opitz, der heute den Galanten und Rücksichtsvollen spielte, sie mit freundlicher Miene bat, das Licht und den Fidibusbecher vor ihn hinzustellen, weil er sie nicht immer wieder inkommodieren wolle, hielt sie mit ihrer neben allem Ärger herlaufenden Neugier nicht länger zurück und sagte: »Angepredigt hat er ihn? Bist du denn auch sicher? Er wird ihn doch nicht beim Namen genannt haben?«
»Nein«, sagte Opitz, dessen gute Laune durch seiner Frau Neugier eher gesteigert als gemindert wurde, »nein, er nannte keinen Namen. Aber es war so gut, als ob er ihn genannt hätte, denn alles sah nach der Ecke hin, wo die Menzens saßen. Und die Alte nickte mit dem Kopf, als ob sie jedes Wort unterschreiben wolle. Freilich weiß ich, daß es nichts zu bedeuten hat, ihr steckt noch so was Polnisches im Blut, kriecht und scherwenzelt immer hin und her und kann keinem ins Gesicht sehen, und von alldem, wovon der Lehnert zuviel hat, hat sie zuwenig. Alte Hexe, verschlagen und heimtückisch und feige dazu.«
»Sie taugt nicht viel. Aber du wirst doch dem Sohne die Mutter nicht anrechnen wollen?«
»Nein«, lachte Opitz. »Das nicht, und ist auch nicht nötig, denn er trägt an seinem eignen Bündel gerade schwer genug. Er trotzt mir, und weil er, außer der Denkmünze, auch noch das Ding, die Schwimmedaille, hat, ich sage die Schwimmmedaille, denn von Retten war keine Rede, und weil es, Gott sei's geklagt, nahe dran war, daß er das Kreuz kriegte, spielt er sich mir gegenüber auf den Ebenbürtigen und den Überlegenen aus. Ich wette, er wildert bloß, um mir einen Tort anzutun; er könnte die Dummheit sehr gut lassen, bei der ohnehin nicht viel rauskommt, aber es macht ihm Spaß, mir so unter der Nase hin ein Wild wegzuknallen. Das ist es. Aber ich denke, die zwei Monat in Jauer werden ihm gezeigt haben...«
»Du bist zu streng, Opitz.«
»Unsinn! Streng! Was heißt streng? Ich tu meine Pflicht.«
»Zu sehr. Du müßtest auch mal ein Auge zudrücken.«
»Bah, Bärbel, du redest, wie du's verstehst. Auge zudrücken. Dazu bin ich nicht da, dazu bin ich nicht in Dienst und Lohn. Ich sage ›Lohn‹, ein gutes, altes Wort, das die dummen Neumod'schen nicht mehr hören wollen. Ich bin dazu da, die Augen aufzumachen. Und tu meine Pflicht zu sehr, sagst du! Als ob man jemalen seine Pflicht zu sehr tun könnte. Man kann sie falsch tun, am unrechten Fleck, soviel geb ich zu; tut man sie aber am rechten Fleck, so ist von ›zu sehr‹ keine Rede mehr. Die Gesetze sind nicht dazu da, daß Hinz und Kunz mit ihnen umspringen. Das verloddert bloß. Ich bin nicht so dumm, daß ich mir einbildete, wenn der Rehbock geschossen wird, geht die Welt unter. Nein, die Welt geht nicht unter. Aber Ordre parieren geht unter, Ordre parieren, ohne das die Welt nicht gut sein kann. Und heut am wenigsten, wo jeder denkt, er sei Graf oder Herr und könne tun, was ihm beliebt, und sei kein Unterschied mehr. Das ist die verdammte neue Zeit, die das Maulhelden – und Schreibervolk gemacht hat, Kerle, die keinen Fuchs von einem Hasen unterscheiden können, trotzdem sie beides sind. Geh mir damit. Ich weiß, was ich zu tun hab. Und dieser Bengel, dieser Herr Lehnert Menz, gehört auch mit dazu, hat die Glocken läuten hören, schwatzt und quatscht von Freiheit, will nach Amerika gehen und hat keine Ahnung davon, daß sie da drüben noch ganz anders heran müssen als hier, sonst holt sie der Teufel erst recht und lacht sie mit ihrer ganzen Freiheit aus. Ich sage dir, hier ist es am besten, hier, weil wir Ordnung haben und einen König und eine Armee und Bismarcken. Ich sage dir, was die Richtigen sind da drüben, die lachen, wenn sie von Freiheit hören; denn die wissen am besten, daß nichts dahinter ist. Ich bin ein Mann in Amt und Dienst, und meinen Dienst tu ich, und wenn es mir ans Leben geht.«
»Sprich nicht so! Beruf es nicht!«
»Unsinn! Unsere Stunden sind gezählt, und wir können uns keine zulegen und keine wegnehmen.«
»Doch, doch«, sagte die Frau.
Fünftes Kapitel
Der Förster war unter diesem Gespräch ans Fenster getreten und sah auf die hart an seinem Vorgarten vorüberführende Fahrstraße. Jenseits derselben, dem Blick entzogen, floß die tief eingebettete Lomnitz, und man hörte nur ihr Hinschäumen über das Steingeröll. Opitz öffnete das Fenster, um frische Luft zu schöpfen, nahm ein Kissen und wollte sich's eben bequem machen, als er, Lehnerts gewahr werdend, unwillkürlich zurücktrat, aber doch nur so, daß er, von der Straße her, immer noch deutlich gesehen werden konnte. Lehnert sah ihn auch wirklich und hob seinen Zeigefinger nachlässig und wie zu halbem Gruß bis an den Schirm seiner Mütze.
»Wie der Kerl nur wieder grüßt«, rief Opitz seiner Frau zu. »Hast du gesehen, Bärbel? Und das soll ich für einen Gruß nehmen. So grüßt man einen Rekruten, aber nicht einen Vorgesetzten. Und das Gesicht dazu...«
»Du bist nicht sein Vorgesetzter.«
»Ach was. Was weißt du davon. Ich sage dir, ich bin's. Und wenn ich es nicht wär, ein Mann in Amt und Würden ist allemal eine Respektsperson. Der Gernegroß da drüben kann seinen Gruß lassen und sagen, er habe mich nicht gesehen, aber wenn er mich grüßt, muß er mich grüßen, wie sich's gehört, Mütze runter oder den Finger fest an den Streifen, und nicht so wie von ungefähr und wie bloß zum Spaß. Das ist Unordnung und Unmanier.«
Opitz hatte sich unter diesen Worten ausgewettert, und als ihm gleich danach eine behaglichere Stimmung wiederkehrte, trat er auch wieder ans Fenster und lehnte sich hinaus, um sich an den Narzissen und Aurikeln zu freuen, die spärlich in seinem Vorgarten blühten. Dabei blies er Wolken aus seinem Meerschaum in die stille Luft und ließ, unter behaglichen Träumen, alles an sich vorüberziehen, was der Tag gebracht hatte, darunter auch den Diskurs in der Exnerschen Laube mit Grenzaufseher Kraatz und dem alten Förster von der Annakapelle. Was er dann später noch, und schon auf dem Heimwege, zu Lehrer Wonneberger gesagt hatte, darüber unterhielt er nur unklare Vorstellungen und entsann sich bloß, daß es allerhand krauses Zeug über Frauen gewesen sei, Frauen im allgemeinen und Kunstreiterinnen im besonderen. »Ach das verteufelte Bier! Aber Wonneberger war auch schon etwas fißlig und wird nichts gemerkt haben. Und wenn auch, morgen ist alles in den Wind.«
Lehnert, als er an Opitz vorbei war, war auf sein Haus zugegangen, das unmittelbar jenseits der Lomnitz lag, der Försterei so nahe, daß man sich gegenseitig so gut wie in die Fenster sehen konnte. Nichts als Fluß und Fahrstraße trennte beide Gehöfte, deren gesamtes Acker- und Heideland in alten Zeiten ausschließlich Stellmacher Menzsches Eigentum gewesen war, bis man, auf dem diesseits der Lomnitz gelegenen Kusselstreifen, eine Försterei gebaut und nur alles jenseits des Flusses Gelegene bei den Menzes belassen hatte. Das war jetzt runde dreißig Jahr, und fast ebensolange hatte man hüben und drüben ohne Neid und Eifersucht gelebt, trotzdem dazu, wie nun mal die Menschen sind, vielleicht Grund gewesen wäre. Denn wenn einerseits die neue Försterei, mit ihrer Sauberkeit und ihrem roten Dach, die drüben gelegene, hier und da sehr baufällige Stellmacherei weit in den Schatten stellte, so hatte diese dafür die »fette Seite« behalten, während sich die Förstersleute, den kleinen Vorgarten abgerechnet, mit einem Streifen Heideland und einem noch schmaleren Lupinenstreifen begnügen mußten. Aber das alles hatte die ganze Zeit über keinen Ärger geschaffen und noch weniger der zufällige Umstand, daß das auf einer Stein- und Geröllinsel, inmitten zweier Lomnitzarme, gelegene Menzsche Wohnhaus, sowenig gepflegt es war, doch kastellartig auf alles unmittelbar Umhergelegene herabsah, und natürlich auch auf die Försterei. Zu keiner Zeit, um es zu wiederholen, war an diesem und ähnlichem Anstoß genommen worden, bis Opitz ans Regiment kam, von dem, ohne daß er es zugab, die Hochlage der Stellmacherei drüben einfach als ein Tort empfunden wurde.
Selbstverständlich unterhielt diese malerische Kastellinsel auch ihre Verbindungen mit dem Festland, und zwar mit Hilfe zweier Brückenstege, von denen der eine beinah unmittelbar nach der Försterei, der andere, nach der entgegengesetzten Seite hin, erst nach dem Menzschen Ackerland und gleich dahinter nach dem schräg ansteigenden gräflichen Forst hinüberführte. Der Ackerstreifen war mit Roggen und Kartoffeln bestellt, von denen der Roggen in diesem Jahre ganz wundervoll stand, auf dem Inselchen selbst aber befand sich, in geringer Entfernung vom Wohnhaus, noch ein Arbeitsschuppen, drin Lehnert die schon von Vater und Großvater her ererbte Stellmacherei betrieb, ein Geschäft, das im Frühjahr und Herbst meist gut ging, im Sommer aber beinah ruhte.
So war es auch heut. Alles ruhte. Freilich sah man einen Pflug und ein paar alte Karren und Wagenachsen unter dem Schuppen stehen, aber all diese Dinge konnten ebensogut zur eignen Wirtschaft gehören wie zur Reparatur abgeliefert sein. In dem abgeschrägten Vorgarten von nur geringer Tiefe, durch den eine Feldsteintreppe zu dem Häuschen hinaufführte, blühten Georginen und Reseda, während ein alter Rosenstrauch von beträchtlicher Stärke neben der Haustür aufwuchs und sein mit gelben Rosen überdecktes Gezweig unter dem Strohdach hin ausspannte. Nachmittagssonne lag auf Haus und Gehöft, und nichts war hörbar als die doppelarmig vorüberschießende Lomnitz und das Meckern einer Ziege vom Stall her. Ein Hahn, ein schönes Tier mit Silberhals, stolzierte den Schuppen entlang, aber er krähte nicht und hatte wenig Aufmerksamkeit für die Hühner, die sich Erdlöcher gemacht hatten, um sich zu kühlen.
Nicht voll so still war es drinnen im Hause, darauf Lehnert, von der Försterei her, eben zuschritt.
Er hatte sich unterwegs nicht beeilt, ebensowenig wie Opitz. Vom Pastorhause war er zunächst nach dem Kretscham hinübergegangen und hatte hier von dem ihn begrüßenden Wirt erfahren, daß Frau Menz, seine Mutter, eben dagewesen sei und gerad an demselben Tisch erst einen »Grünen« und dann einen Ingwer getrunken habe. Das hörte Lehnert nicht gern. Er gönnte der alten Frau die kleine Herzstärkung, denn er liebte sie trotz all ihrer Schwächen, aber er ärgerte sich wieder über die Heimlichkeit, und dieser Ärger war noch nicht voll überwunden, als er, über die Schwelle seines Hauses tretend, der am Herde hantierenden Alten ansichtig wurde.
»Guten Tag, Mutter. Pohl läßt grüßen.«
»Welcher?«
»Nu, der aus dem Kretscham unten.«
»So, der. Warst du da?«
»Ja, Mutter. Und kannst du dir denken, ich habe mich just da hingesetzt, wo du gesessen hattest. Und dir zu Ehren hab ich meinen Ingwer aus deinem Glase getrunken. Es stand noch da.«
Die Alte sah verlegen vor sich hin und sagte dann: »Aber nur einen, Lehnert. Mir war so schwach«.
Lehnert lachte. Dann ging er auf sie zu und sagte, während er ihr das graue Haar streichelte: »Gott, Mutter, wie du so bist! Wenn das einer hört', so müßt er denken, der Lehnert ist ein Filz und schlechter Kerl und gönnt seiner alten Mutter nicht einmal einen Tropfen Stärkung. Aber wie liegt es denn? Ich gönne dir nicht einen Ingwer, ich gönne dir zwei, und wenn dir's nicht zuviel wird, Alte, dann können es auch drei und vier werden. Ich habe dich auch noch eigens gefragt, und da hast du ›nein‹ gesagt, aber freilich, als du nein sagtest, da sagtest du schon ja, und als ich die Klingeltür bei Siebenhaar noch kaum aus der Hand hatte, da bist du schon hinübergegangen. Immer versteckt; du kannst nichts offen tun, auch nicht mal das, was die Sonne gar nicht zu scheuen braucht. Alles muß heimlich sein. Und sieh, Mutter, so hast du mich auch erzogen und angelernt. Das muß ich dir immer wieder sagen. Gott sei's geklagt, daß ich's muß. Es ist immer ein und dasselbe, was du so bei dir denkst: es sieht es ja keiner; bei Nacht sind alle Katzen grau, und es darf bloß nich rauskommen. Und wenn es nicht rauskommt, dann ist alles gleich. So denkst du bei dir, und denkst auch wohl: ach, der liebe Gott, der is nicht so, der ist gut und freut sich, wenn man einem Förster oder Grenzaufseher ein Schnippchen schlägt.«
»Ach, Lehnert, rede doch nicht so! Du weißt ja doch...«
»Und wenn es dann schiefgeht, ja, dann ist es wieder anders. Dann geht es in die Predigt, und Siebenhaar... na, du weißt schon, ich hab es dir heute schon mal gesagt..., der muß dann wieder einen Heiligen aus mir machen. Aber nicht zu lang; Gott bewahre, denn ein Heiliger paßt auch nicht, und wenn uns dann die Not wieder an der Kehle sitzt, und braucht auch noch gar nicht mal eine rechte Not zu sein, dann ist es mit Siebenhaar auch wieder vorbei, und dann heißt es wieder: ›Es wird es ja wohl keiner sehen‹, oder: ›Man muß es nur klug anfangen, und die Menschen müssen es einem bloß nicht auf den Kopf zusagen können.‹ Ach, Mutter, du meinst es mit keinem bös, und mit mir erst recht nicht, aber du hast das Ehrlichsein nicht gelernt, und davon ist alles gekommen... Und nun will auch Siebenhaar noch mit ihm sprechen, mit Opitz, als ob das was helfen könnte, will mich mit ihm versöhnen, und ich hab's auch versprechen müssen. Aber ich mag nicht. Ich hasse ihn, und Haß ist überhaupt das Beste, was man hat.«
»Überlege dir's, Lehnert. Er ist ein gräflicher Förster und is nun doch mal der Herr.«
»Ach was, der Herr! Ein Diener is er. Ich bin ein Herr, wenigstens eher als er, und kann machen, was ich will.«
»Er hat das Ansehen vor den Leuten, und ich weiß es von Christinen, er ist nicht so schlimm, wie du glaubst und ihn immer machen willst. Er kann auch durch die Finger sehen. Aber er verlangt, daß man ihm gute Worte gibt und ihn für was Besonderes ansieht. Und das tust du nicht. Er kann bloß deinen Trotz nicht leiden. Und darum hab ich Siebenhaar gebeten.«
»Aha«, lachte Lehnert. »Also du. Nun meinetwegen.«
»Und darum«, so wiederholte die Alte, »hab ich Siebenhaar gebeten, als ich nun doch mal mit ihm sprach, daß er ihn gut für uns stimme. Soviel weiß ich, er gibt was auf Siebenhaar, und wenn der ihn rumkriegt und Opitz dir dann die Hand gibt, dann nimm sie, dann stoße sie nicht weg und vergiß all das Alte. Sieh, Lehnert, es hat ja doch alles seine zwei Seiten, und vielleicht hat er nicht so ganz unrecht gehabt, und du hast aus der Sache mit dem Kreuz mehr gemacht, als du hättest machen sollen. Gib nach, Lehnert! Trotz macht Feind. Und wir brauchen Freunde, weil wir arm sind und das Geschäft schlecht geht, und gerade jetzt im Sommer. Und unser Nachbar ist er auch. Es is doch sonst mit den Försters gut gegangen. Gib nach und versöhne dich mit ihm! Dann haben wir gute Zeit, und wenn dann mal was vorkommt, na, du weißt schon, was ich meine, so verpufft und verknallt es. Kennst ja doch unser altes Sprichwort: Der Wald ist groß, und der Himmel ist weit.«
Lehnert, die Hände auf dem Rücken, ging auf und ab. Er hatte das alles schon oft gehört, nur eines nicht: daß er das mit dem Kreuz doch vielleicht schlimmer genommen als nötig. Und so hochmütig er war, so bescheiden war er auch.
»Wenn es so wäre? Wenn ich mehr daraus gemacht hätte als nötig?« so gingen seine Gedanken.
Und er nahm der Mutter Hand und sagte: »Gut, Alte. Ich will es mir überlegen.«
Sechstes Kapitel
Was hüben die Mutter ihrem Sohn und drüben die Frau ihrem Mann gesagt hatte, blieb doch nicht ganz ohne Einfluß, weil beide Parteien klug genug waren, das Wahre darin herauszufühlen; Opitz war strenger als nötig, Lehnert war aufsässiger als nötig, und der schlichte Ton, worin das einem jeden gesagt wurde, tat seine Wirkung. So machte sich's, daß beide stillschweigend übereinkamen, sich wenigstens nicht mehr zum Tort leben zu wollen, und weil sie dabei fühlen mochten, daß das bei steten persönlichen Begegnungen sehr schwer sein würde, so faßten sie den Entschluß, sich nach Möglichkeit aus dem Wege zu gehen. In der Tat, man vermied es, sich zu sehen, und gab es unter anderm auf, zu gleicher Zeit, wie sonst wohl, im Vorgarten zu sitzen und sich über die Straße hin mit den Augen zu messen. Ja, Lehnert seinerseits ging noch weiter und machte, wenn er ins Dorf mußte, nur um die Försterei zu vermeiden, lieber den Umweg am Waldsaume hin. Auch die Hühner, die durch ihre Besuche drüben im Garten der Försterei beständig Anlaß zu Klagen und bitteren Worten gegeben hatten, hielt er besser in Ordnung, und das Steinsprengen, das mit seinem Knall und seiner aufsteigenden Rauchwolke seinen reizbaren Nachbar durch Jahr und Tag hin mehr als alles andere verdrossen hatte, gab er ganz auf. An einen völligen Ausgleich der alten Gegensätze war freilich nicht zu denken, dazu war zuviel vorgefallen, aber wenn Friede nicht sein konnte, so doch wenigstens Waffenstillstand.
Und unter solchem Waffenstillstande verging eine Woche.
Nun war wieder Sonntag, und die Glocken der Arnsdorfer Kirche klangen wie gewöhnlich vom Tal zu den Bergen herauf. Aber diesem Rufe folgten heute nur wenig, weil oben in Kirche Wang ein Brückenberger Paar getraut werden sollte. Das veranlaßte denn alle die, die sich mehr von der Trauung einer jungen hübschen Braut als von der Predigt des alten Siebenhaar versprachen, lieber bergauf nach Wang zu steigen, und das um so mehr, als über das wundervolle Brautkleid, das aus Hirschberg und nach andern sogar aus Breslau stammen sollte, schon die ganze Woche lang gesprochen worden war. In der Tat, Schaulust und Neugier gaben heute den Ausschlag. Aber einige stiegen doch nicht bloß als Neugierige, sondern als recht eigentliche Trauzeugen und Hochzeitsgäste hinauf, unter ihnen auch Opitz in Gala, dem sich, gleich nach Passierung des am Ausgange von Krummhübel gelegenen Rummlerschen Gasthauses, auch noch Grenzaufseher Kraatz und der alte Laborant Zölfel angeschlossen hatten.
Zu diesen zur Hochzeit Geladenen hatte, wegen alter guter Beziehungen zum Bräutigam, anfangs auch Lehnert gehört; als er aber durch Christine von Opitz' wahrscheinlicher Anwesenheit erfuhr, war er sofort zum Fernbleiben entschlossen gewesen. Wußt er doch, daß mit Opitz, wenn dieser ein Glas über den Durst getrunken hatte, doppelt schwer zu verkehren war, und auf diese Gefahr hin wollt er eine Begegnung mit ihm nicht wagen. So zog er es denn vor, zu Hause zu bleiben und in einem von Amerika handelnden Buche zu lesen, das ihm ein alter Kriegskamerad neuerdings geliehen und das durchzusehen er sich schon ein paar Tage lang gefreut hatte. Daneben war es ihm durchaus recht, daß seine Mutter, ohne gerade zu den Geladenen zu zählen, an dem Kirchgange, nach Wang hinauf, teilnehmen und sich hinterher in dem ihr aus beßren Tagen wohlbekannten Hochzeitshause nach Möglichkeit nützlich machen wollte.
So war der Plan. Und gemäß dem Plan verlief auch der Tag, der freilich unserem Lehnert, ganz gegen Erwarten, lang und schwer genug wurde. Denn bald nach Opitz waren auch Frau Bärbel und Christine nach Wang hinaufgestiegen, und so kam es, daß der auf seinem Inselchen Zurückgebliebene zwölf Stunden lang nichts als das Vorüberschießen der Lomnitz hörte, wenn nicht gerade drüben der Opitzsche Hofhund anschlug. Bis gegen Abend saß er so draußen im Freien und las von Urwald und Prärie, von großen Seen und Einsamkeit. Er schwelgte darin und vergaß die Zeit, aber mit einem Mal ergriff ihn doch ein Grauen. »Einsamkeit! Nein, nein, nicht Einsamkeit. Nicht einsam leben, nicht einsam sterben.« Und er wiederholte sich das Wort, und in seiner überreizten Einbildungskraft sah er sich auf einem Bergkegel, ein Tal zu seinen Füßen und den Sternenhimmel über sich. Ein Frösteln überkam ihn zuletzt, und so ging er denn wieder hinein und warf Kienäpfel in die Glut und starrte darauf hin. Aber das Hineinstarren in die Flamme war ihm bald nicht weniger unheimlich als das Bild, das eben draußen vor seiner Seele gestanden hatte. Dabei war es ihm beständig, als ob er Stimmen höre, Stimmen von weit, weit her. Und er sprang auf und trällerte vor sich hin, um sich alles, was ihn ängstigte, fortzusingen. Aber es wollte nicht recht glücken, und er war froh, als er, um die zehnte Stunde, seine Mutter schon von fernher des Weges kommen und gleich danach, an der Försterei vorüber, auf den Brückensteg zuschreiten sah.
»Singst ja so, Lehnert. Was is es denn? Christine war wohl da... Ja, sie ging schon, als der Tanz eben anfing.«
»Ach, laß doch die Christine!«
»Du nimmst sie doch noch.« Und während die Alte das sagte, stellte sie ein Bündel, das sie bis dahin vorsichtig in Händen gehalten, auf den Tisch und löste den Knoten eines buntgeblümten Taschentuchs, in das alles eingeschlagen, was sie vom Hochzeitshause her mitgebracht hatte: große Stücke Streuselkuchen, eine halbe Wurst, ein Schinkenknochen und ein Napfkuchen.
»Wollen wir uns noch einen Kaffee machen, Lehnert?«
Er schwieg.
»Du hast ja noch Feuer im Ofen. Und das ist recht. Oben auf Wang in der Kirche war es wieder so kalt, und auf dem Kirchhof pfiff es, daß es einem bis auf die Seele ging. Ich glaub, ich habe mir wieder was geholt, hier links unterm Schulterblatt. Aber wenn wir uns noch einen Kaffee machen und ein Glas Rum eintun, ich habe noch welchen... ja, Lehnert, ein paar Tropfen muß man doch immer haben... dann vergeht es wieder. Und ein Katzenfell ist auch gut.«
Während sie noch so sprach, hatte sie vom Schapp her ein Messer geholt und begann den Napfkuchen in große Scheiben zu schneiden. »Iß, Lehnert; frisch schmeckt er doch am besten!« Und dabei griff sie nach dem größten Stücke. »Begräbniskuchen mag ich nicht. Aber Hochzeitskuchen, den mag ich; der schmeckt und bekommt einem alten Menschen. Und warum bekommt er einem? Weil man nicht an Tod und Sterben zu denken braucht und alles mit Appetit ißt. Un auf den Appetit kommt es an und auf den Hunger. Das heißt, wenn er nicht zu groß ist und nicht weh tut und wenn man was hat, daß er aufhört.«
Lehnert schwieg noch immer.
»Iß doch, Jung!«
»Ich mag nicht, Mutter... Und wie das alles wieder aussieht, wie 'n Bettelsack. Haben sie dir's denn gegeben?«
»Gewiß. Ich werde mir doch nichts wegstibitzen und abziehn wie die Katze vom Taubenschlag.«