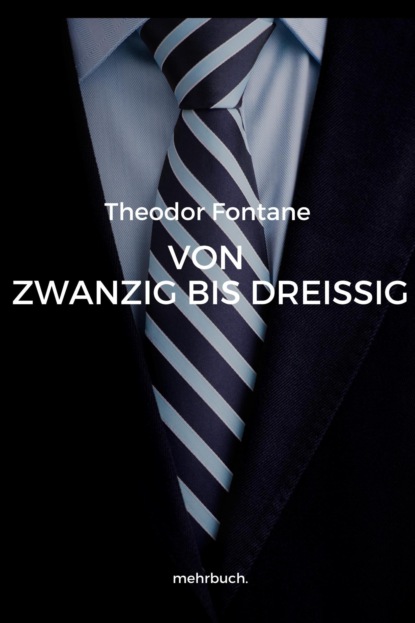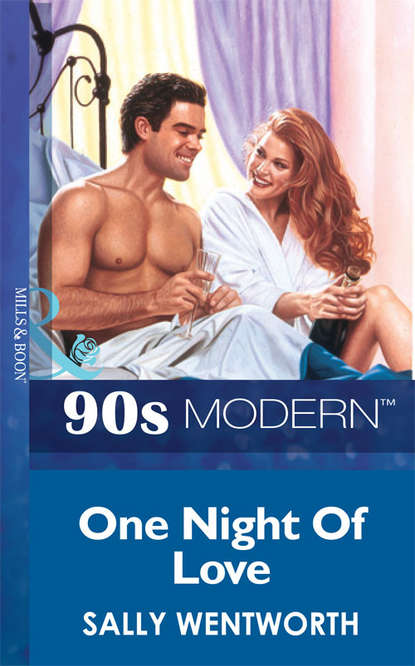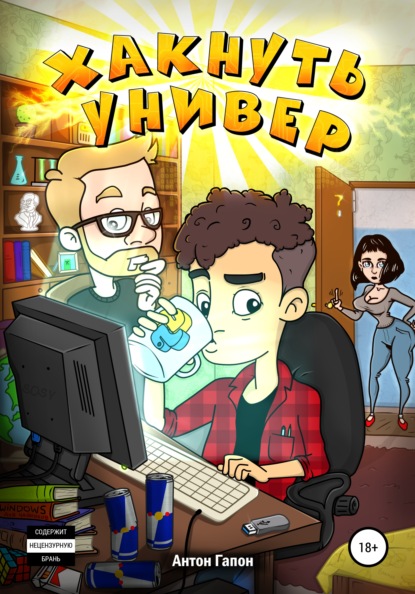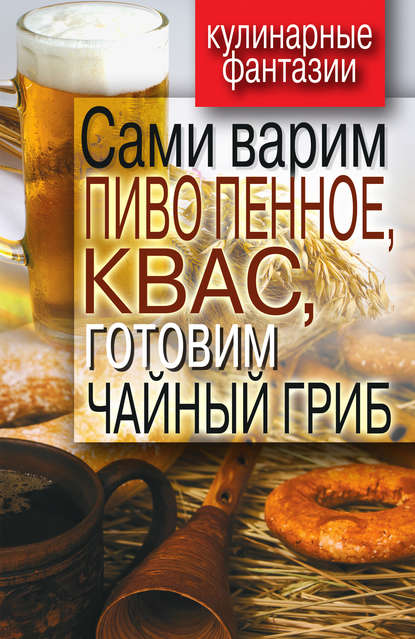- -
- 100%
- +
Das zweitemal, wo sich Fritz Esselbach, und zwar unter Assistenz einer ringellöckigen Dame, meiner bemächtigte, stand wieder ein Polterabend in Sicht, aber diesmal in einem ganz andern Kreise. Der bis vor kurzem noch unter uns lebende, längst zu einer Zelebrität gewordene Professor Kummer verheiratete sich mit einer Mendelssohnschen Tochter, und der Polterabend wurde Neue Kommandantenstraße gefeiert, im Hause der Brauteltern. Ich traf etwas verspätet ein, als man eben schon die Plätze vor der im Saal aufgeschlagenen Bühne verlassen wollte. Voll großer Güte gegen mich aber machte man kehrt, nahm die Plätze wieder ein und ließ sich eine Gärtnerburschenrolle, will also sagen das denkbar Trivialste, ruhig und selbst unter Beifallsbezeigungen gefallen. Trotzdem war es, gemessen an meinem als Gipsfigurenhändler eingeheimsten Erfolge, kaum ein Succès d'estime, worüber mich auch die große Liebenswürdigkeit der Wirte wie der Gäste nicht täuschen konnte. Vorn, im Zuschauerraum, stand ein Militär, Stabsoffizier, der sich, als ich von der Bühne herab in den Saal trat und da umherirrte, mit mir armen verlegenen Jungen entgegenkommend unterhielt. Anderthalb Jahrzehnte später verging kaum ein Gesellschaftsabend im Franz Kuglerschen Hause, wo mir nicht Gelegenheit gegeben worden wäre, die Bekanntschaft von damals zu erneuern. Er, der sich meiner an jenem Polterabende so freundlich angenommen hatte, war ein Schwager Franz Kuglers, der Major – spätere General – Baeyer, der berühmte Geodätiker, Schöpfer seiner Wissenschaft.
Fritz Esselbach, überall mein Introdukteur, führte mich auch, wie schon eingangs hervorgehoben, in den Lenau-Klub ein. Den Anstoß dazu gab aber nicht meine Dichterei, sondern eine ganz zufällige Begegnung, ohne welche meine Bekanntschaft mit diesem Dichterverein vielleicht nie stattgefunden hätte. Von dieser Begegnung zunächst ein Wort.
Wir, Fritz Esselbach und ich, kamen vom Tiergarten her und schlenderten über den Karlsplatz fort, auf die Oranienburger Straße zu, an deren entgegengesetztem, also ganz in der Nähe des Haakschen Marktes gelegenen Ende Fritz Esselbach wohnte. Als wir bis an die Ecke der Auguststraße gekommen waren, sah ich, daß hier, eine Treppe hoch, gerad über der Tür eines Materialwarenladens, ein junger Mann im Fenster lag und seine Pfeife rauchte. Fritz Esselbach grüßte hinauf. Der junge Mann, dem dieser Gruß galt – ein Mädchenkopf, mit einer in die Stirn gezogenen gelben Studentenkappe – , wirkte stark renommistisch; noch viel renommistischer aber wirkte seine Pfeife. Diese hatte die Länge eines Pendels an einer Turm- oder Kirchenuhr und hing, über die Ladentür fort, fast bis auf das Straßenpflaster nieder. Vor der Ladentür, weil gerade »Ölstunde« war, war ein reger Verkehr, so daß die Pfeife beständig Pendelbewegungen nach links oder rechts machen mußte, um den Eingang für die Kunden, die kamen, freizugeben. Natürlich wär' es für den Ladeninhaber, der zugleich Hausbesitzer war, ein kleines gewesen, sich dies zu verbitten, er ließ den Studenten da oben aber gern gewähren, weil dieser seltsame Schlagbaum ein Gegenstand stärkster Anziehung, eine Freude für die Dienstmädchen der ganzen Umgegend war; alle wollten an der Studentenpfeife vorbei.
»Wer ist denn das?« fragte ich. »Du grüßtest ja hinauf.«
»Das ist Hermann Maron.«
»Kenn' ihn nicht.«
»Dann mußt du ihn kennenlernen. Er macht auch Verse, ja, ich glaube, bessere als du. Nächsten Sonnabend ist Sitzung unsres Lenau-Vereins. Ich bin selber erst seit kurzem Mitglied, aber das tut nichts; ich werde dich einführen.«
Und so geschah es. Zu festgesetzter Stunde stieg ich mit meinem Freunde die schmale stockdunkle Stiege hinauf und wurde, nachdem wir uns ins Helle durchgetappt hatten, einem in einem kleinen und niedrigen Zimmer versammelten Kreise junger Männer vorgestellt. Es waren ihrer nicht viele, sechs oder acht, und nur zwei davon haben später von sich reden gemacht. Der eine war der von jener flüchtigen Begegnung her mir schon bekannte Hermann Maron selbst, der andre war Julius Faucher. Beide vollkommene Typen jener Tage.
Hermann Maron, unser Herbergsvater, gab den Ton an. Er war aus einem sehr guten Hause, Sohn eines Oberforstmeisters in Posen, und hatte sich, von Jugend an maßlos verwöhnt, in völlige Prinzenmanieren eingelebt. Selbst der skeptische und an Klugheit ihm unendlich überlegene Faucher unterwarf sich ihm, vielleicht weil er, wie wir alle, in den bildhübschen Jungen verliebt war. Dazu kam Marons offenbare dichterische Überlegenheit. Eins seiner Gedichte führte den Titel: »Ich mach' ein schwarzes Kreuz dabei«, Worte, die zugleich den viermal wiederkehrenden Refrain des vierstrophigen Liedes bildeten. Mutter, Freund, Geliebte sind vor ihm hingestorben, und die Frage tritt jetzt an ihn heran, was seiner wohl noch harre in Leben, Liebe, Glück. Und: »Ich mach' ein schwarzes Kreuz dabei« lautet auch hier wieder, vorahnend, die Antwort. Sein Leben war ein verfehltes, und jäh schloß es ab.
Meine Bekanntschaft mit ihm war damals, Sommer 1840, nur von kurzer Dauer, auch kamen wir uns nicht recht näher, weil ich, trotz des glatten Gesichts, ja, ich möchte fast sagen, um desselben willen, etwas Unheimliches an ihm herausfühlte. Vier, fünf Jahre später sah ich ihn flüchtig wieder. Er war in manchem verändert, nur nicht darin, daß er durchaus Sensation machen mußte. Sonderbarerweise verfuhr er dabei ganz nach seinen früheren Inszenierungsprinzipien. Er wohnte zu jener Zeit zwei Treppen hoch in der Kronenstraße und gefiel sich, ganz ähnlich wie früher, darin, sich zur Erbauung der Vorübergehenden derart ins offne Fenster zu setzen, daß seine Beine links und rechts neben dem Fensterkreuz herunterhingen. So saß er da, lesend, rauchend, während drüben das Abendrot über den Dächern hing.
Dann – aber erst geraume Zeit später – ersah ich aus den Zeitungen, daß er sich einer nach Ostasien (Japan) bestimmten staatlichen Expedition angeschlossen habe, deren Chef Graf Fritz Eulenburg, der spätere Minister des Innern, war. Marons Stellung zu Graf Fritz Eulenburg, der wohl eine Vorliebe für derartig aparte Persönlichkeiten haben mochte, war die denkbar beste, so daß sich ihm, dem sichtlich Bevorzugten, eine glänzende Zukunft zu bieten schien. Er gab auch ein Buch über Japan heraus, das sehr gerühmt wurde. Trotzdem wollte es nichts Rechtes mit ihm werden, so daß er es schließlich als ein großes Glück ansehen mußte, daß sich eine reiche, nicht mehr junge schlesische Dame in ihn verliebte. Die Vermählung fand statt, und es folgten halbwegs glückliche Jahre, wenn das Gefühl, aus den Schulden und Verlegenheiten heraus zu sein, ausreicht, einen Menschen glücklich zu machen. In diesen Jahren sah ich ihn wieder, als einen Sechziger oder doch nicht viel jünger. Es war in einem großen Zirkel bei Wilhelm Gentz, dem Afrikamaler, Hildebrandstraße 5.
»Alle Wetter, Fontane, daß ich Sie hier wiedersehe. Wie geht es Ihnen?«
»La la.«
»Ja, la la. Gott, wenn ich an die Auguststraße zurückdenke und unsre Verse. Viel ist nicht dabei 'rausgekommen. Ich müßte Sie denn ausnehmen.«
Das Verbindliche, das in der Schlußwendung zu liegen schien, bedeutete nicht viel, denn der Spott überwog.
Ich versuchte nun von Japan und Graf Eulenburg zu sprechen. Aber er unterbrach mich und sagte: »Ach, lassen wir doch das. Ich will Sie lieber mit meiner Frau bekannt machen. Ich bin nämlich verheiratet.« Und dabei wies er, während er übermütig lachte, auf eine ein paar Schritt zurückstehende Dame.
Die alte Dame selbst hatte ein unbedeutendes, aber sehr gutes und freundliches Gesicht, und man sah deutlich, daß sie, trotzdem seine Haltung nur Überheblichkeit und keine Spur von Respekt ausdrückte, doch nur für ihn lebte. Wir tauschten unsre Karten aus und wollten uns besuchen und von alten Zeiten sprechen.
Es kam aber nicht dazu, denn nicht sehr viel später schied er aus dem Leben. Es verlief so. Das Vermögen der Frau war aufgezehrt, und er bezog eine Wohnung, wenn ich nicht irre, ganz in Nähe des Oranienburger Tores, nur wenig hundert Schritt von jener Auguststraßenecke entfernt, wo ich ihn vierzig Jahre früher kennengelernt hatte. Die Verlegenheiten wurden immer größer, und er beschloß seinen Tod. Sein Verfahren dabei war Maron vom Wirbel bis zur Zeh. Er zeigte sich übrigens, als die Stunde da war, nicht ohne eine gewisse, wenn auch nur von Dankbarkeit und vielleicht mehr noch von Charakterkenntnis diktierte Liebe zu seiner Frau, und so kam es denn, daß er sich die Frage stellte: »Ja, wenn du nun fort bist, was wird alsdann aus dieser Armen, die nie für sich denken und handeln konnte? Das beste ist, sie stirbt mit.« Und so saßen sie denn auf dem Sofa der immer öder gewordenen Wohnung und nahmen ein allereinfachstes Frühstück ein. Die Frau, ahnungslos, ließ es sich schmecken, und noch den Bissen im Munde, traf sie die tödliche Kugel. Im nächsten Augenblick schoß er sich selbst durch die Schläfe.
Charakteristisch war auch der an den Hauswirt gerichtete Brief, der sich auf seinem Schreibtisch vorfand. Er entschuldigte sich darin, daß er nicht bloß die Miete nicht gezahlt, sondern durch sein Tun auch das Weitervermieten erschwert habe. Das war sein Letztes. »Ich mach' ein schwarzes Kreuz dabei.«
Viel bedeutender als Maron und überhaupt der weitaus Bedeutendste des ganzen Kreises war Julius Faucher. Nur sehr wenige sind mir in meinem langen Leben begegnet, die reicher beanlagt gewesen wären, und keinen habe ich kennengelernt, an dem man das, was man damals ein »Genie« nannte, so wundervoll hätte demonstrieren können wie an ihm. Ich sage mit Vorbedacht »damals«; jetzt denkt man Gott sei Dank anders darüber. Man weiß jetzt, daß ein Philister ersten Ranges ein großes Genie sein kann, ja, erst recht, während man sich ein solches, in den dreißiger und vierziger Jahren, ohne bestimmte moralische Defekte nicht gut vorstellen konnte. Jedes richtige Genie war auch zugleich ein Pump- und Bummelgenie. Von dieser Regel gab es nur wenig Ausnahmen.
Faucher erschien in den Sonnabendsitzungen, die, wie schon kurz erwähnt, bei Maron stattfanden, mit großer Pünktlichkeit, sprach aber wenig, weil ihn unser lyrisches Treiben eigentlich langweilte, nicht aus Mangel an literarischem Verständnis, sondern umgekehrt, weil er von künstlerischem Sinn mehr besaß als wir. Er hatte die feinere Zunge und zeigte sich vor allem als der kritisch Überlegene. Die Hauptsache waren ihm die Kneipereien, die sich an die »Sitzungen« anschlossen. An mir nahm er ein gewisses Interesse, was halb schmeichelhaft, halb unschmeichelhaft war. Er sah mich aus seinen klugen Augen an und schien dabei sagen zu wollen: »Es ist doch unglaublich, was noch für Menschen vorkommen.« Einmal lud er mich ein, ihn zu besuchen. Seine Wohnung war Unter den Linden, die Nachbarecke von Kranzler. Wenn ich nicht irre, führten breite Außentreppen, wie man sie in Schweizer Häusern sieht, zu seinem in einem Hofflügel gelegenen Zimmer hinauf. Man sah, wenn man eintrat, sofort, daß er aus einem guten Hause stammte; von der herkömmlichen Ödheit einer Berliner Chambre garnie zeigte sich nichts, alles war eigentümlich und anheimelnd zugleich, und statt der »Philöse« erschien ein hübsches Mädchen, das den Tee brachte.
»Nun, lieber Fontane, es ist nett, daß Sie gekommen sind. Ich habe Sie gebeten, um Sie heute abend mit einem Dichter bekannt zu machen.«
Er sah wohl an meinen Augen, daß ich, nach diesen seinen Einleitungsworten, einen zweiten Besucher erwartete.
»Nein«, lachte er, »nicht so. Der Dichter, mit dem ich Sie bekannt machen will, liegt hier schon auf dem Tisch. Und es ist niemand anders als unser Schutzpatron Lenau. Sie kennen ihn nicht, das haben Sie mir letzten Sonnabend freimütig gestanden; aber die andern, die sich alle für Lenau-Enthusiasten halten, kennen ihn eigentlich auch nicht. Maron kennt die ›Schilflieder‹, damit schließt so ziemlich seine ganze Weisheit ab.«
»Die ›Schilflieder‹?«
»Ja. Und ich freue mich, daß Sie sie noch nicht kennen, denn ich komme dadurch zu dem Vergnügen, Ihnen diese wundervollen Sachen vorlesen zu können.«
Und nun begann er. Ich war hingerissen, was ihn sichtlich freute. »Ja, Freund«, nahm er wieder das Wort, »da kommt nun freilich unser Maron nicht gegen an, trotzdem er sich's beinah einbildet. Aber diese ›Schilflieder‹, das ist doch gar nichts; hören Sie weiter.«
Und nun las er mir aus der ersten Abteilung – nur etwa dreißig Seiten, die aber das Beste enthalten, was Lenau geschrieben hat – noch etliche Sachen vor: »Nach Süden«, »Dein Bild«, »Das Mondlicht«, »Nächtliche Wandrung«, »Bitte«, »Das Posthorn«.
Der Eindruck auf mich war ein großer, überwältigender. Drei Tage später hatte ich die Gedichte. Das damals erstandene Exemplar hat mich durchs Leben hin begleitet, und ich lese noch darin. Ich würde das noch öfter tun, wenn ich die vorgenannten Stücke nicht auswendig wüßte. Sie sind meine Lieblinge geblieben. Der Mehrzahl haftet etwas Schmerzrenommistisches an, aber trotzdem finde ich sie schön bis diesen Tag.
Im Herbst 1840 verließ ich Berlin und kam, wie von dem ganzen Kreise, so auch von Faucher ab. Erst fünf Jahre später sah ich ihn wieder. Ich war damals in der Schachtschen Apotheke, Ecke der Friedrichs- und Mittelstraße. Eines Abends, auf dem Heimwege, sah ich mich, keine dreißig Schritt mehr von meiner Wohnung entfernt, von sechs, acht Strolchen, die sofort einen Kreis um mich schlossen, angebettelt. Alle hatten die Rockkragen in die Höhe geklappt und die Mützen und Hüte tief 'runtergezogen; ein paar humpelten, einer schien bucklig oder wenigstens mit sehr hoher Schulter. Dieser trat an mich heran, streckte mit gemachter Ängstlichkeit seine hohle Hand gegen mich aus und sagte: »Herr Jraf, bloß Zweigroschen.« Es war Faucher. Ich hätte nun sagen können: »Faucher, seien Sie nicht verrückt.« Aber das wäre Spielverderberei gewesen und hätte vielleicht auch zu sonderbaren Auseinandersetzungen geführt. Ich suchte also nach dem geforderten Geldstück, und weil ich ein solches leider nicht finden konnte, mußte ich mich mit einem Viergroschenstück loslösen, wofür ich unter devoten Bücklingen und heitrem Gejohle im Hintergrunde belobt wurde. Bald darauf erfuhr ich, daß die Raubzüge dieser Bande mit einer Art Regelmäßigkeit unternommen würden, immer in nächster Nähe der Linden, und daß sie's dabei bis auf mehrere Taler brächten, die dann sofort im Kap-Keller – zweites Haus in der Friedrichsstraße – verkneipt wurden.
Aus welchen Elementen sich die Bande zusammensetzte, hab' ich nie sicher in Erfahrung gebracht. Wahrscheinlich fanden sie sich zufällig zusammen, vielleicht aber waren es auch einige der berühmten »Sieben Weisen aus dem Hippelschen Keller«, die den damaligen eigentlichen Umgang Fauchers bildeten. Alle Sieben haben eine Rolle gespielt. Es waren, wenn ich recht berichtet bin, die folgenden: Bruno Bauer, Edgar Bauer, Ludwig Buhl, Max Stirner, Leutnant St. Paul und Leutnant Techow. Der siebente war eben Faucher selbst.
Zu diesen hier Genannten, mit Ausnahme von Buhl und Stirner, bin ich zu verschiedenen Zeiten in wenigstens lose Beziehungen getreten. Bruno Bauer sah ich, zwanzig Jahre später, als er das Wagenersche Konversationslexikon schrieb, allwöchentlich einmal auf der Kreuzzeitungs-Druckerei, wenn er in seinen Schmierstiefeln, mit Knotenstock und Schirmmütze, von Rixdorf nach Berlin hereinkam. In einem späteren Kapitel erzähl' ich davon. Seine Bedeutung steht fest; mein Geschmack aber war er offen gestanden nicht. Mit seinem Bruder Edgar war ich in den fünfziger Jahren in England oft zusammen. Er stand wohl, in der Hauptsache, dem älteren Bruder um ein erhebliches nach, war ihm aber an Witz und glücklichen Einfällen überlegen. Nur ein Beispiel stehe hier für viele. Gleich nach dem Regierungsantritt König Wilhelms war auch Edgar Bauer, wie so viele Flüchtlinge, von London nach Berlin zurückgekehrt, sah sich aber hier alsbald in Preßprozesse verwickelt und wurde durch den Landgerichtsrat Pielchen verurteilt. Er verkündete dies seinen Lesern in einem Leitartikel, der, wie folgt, anhob: »Wie den Individuen, so werden auch den Völkern alle Gnadengeschenke nach einer besonderen Skala zugemessen – England hatte vor dem seinen Peel, Preußen hat jetzt sein Pielchen.« Über meine Begegnung mit Saint Paul habe ich in meinem Scherenberg-Buche ziemlich ausführlich berichtet, und Leutnant Techow lernte ich im Herbst achtundvierzig kennen, als er als Festungsgefangener oder vielleicht auch erst in Untersuchungshaft in den Kasematten von Spandau saß. Der Tag ist mir unvergeßlich. Ein Verwandter von mir, ein in der Pépinière lebender Bataillonsarzt, forderte mich zu dieser Techow-Expedition auf, deren eigentlicher Unternehmer Du Bois-Reymond war. Dieser hat sich auch späterhin, als er längst eine Weltberühmtheit geworden, in einer schönen und mich erschütternden Weise als Freund Techows bekannt und seinen Fürsprecher gemacht. Leider ohne Erfolg. Ich sage »leider«, aber nur aus menschlicher Mitempfindung heraus, während ich im übrigen der kriegsministeriellen Entscheidung, die Techow für immer vom vaterländischen Boden ausschloß, zustimme. Es gibt eben Dinge, Gott sei Dank nicht oft, bei denen nicht gespaßt werden darf und wo der ausnahmsweise wirkliche Ernst der Sache – das meiste ist bloß Larifari – das Gemütlichsein verbietet... Wir trafen also nachmittag bei Techow ein. Die Kasematte, drin er saß, glich einem in einen Eisenbahndamm eingeschnittenen Kellerraum, hatte aber nichts sonderlich Bedrückliches. Techow war lebhaft, quick, elastisch. Was gesprochen wurde, weiß ich nicht mehr, trotzdem ich sonst immer bei unalltäglichen Gelegenheiten gut aufzupassen verstand. Über Techows weitres Leben zu berichten, über seine Flucht, seinen Aufenthalt erst in London und dann in Melbourne – wo er Droschkenkutscher war – und endlich über seine Rückkehr an die Heimatstür, um an dieser abgewiesen zu werden – dazu ist hier nicht der Ort. Ich erzähle deshalb lieber ein paar Einzelnheiten aus dem Leben, das die »Sieben Weisen des Hippelschen Kellers« damals führten, gleich hinzusetzend: relata refero.
Einige Mitglieder des Kreises verheirateten sich. Der erste, der es wagte, war der seitdem so berühmt gewordene Stirner. Seine Frau hatte etwas Geld, das, der Weisheit der »Sieben Weisen« entsprechend, sofort in einem großen Gesamtunternehmen angelegt werden sollte. Man beschloß, eine »Milchwirtschaft« einzurichten, und zwar nach demselben Prinzip, das viele Jahre später von dem praktisch klugen Bolle zu seinem und der ganzen Stadt Segen glorreich durchgeführt wurde. Die »Sieben« unternahmen Reisen auf die umliegenden Dörfer – ich hätte dabeisein mögen, wenn zum Beispiel St. Paul mit einer jungen Melkerin im Kuhstall verhandelte – und schlossen mit zahllosen Pächtern und Bauerngutsbesitzern Kontrakte über Milchzufuhr ab. Von einem bestimmten Tage an hatte jeder soundso viele Quart zu liefern. Das Bureau und die Kellerräume, alles ganz großartig, befanden sich in der Bernburger Straße. Die Milch kam denn auch, aber die Käufer blieben aus, und nachdem schließlich mehrere Tage lang ein gewisser saurer Milchton die ganze Bernburger-Straßen-Luft durchzogen hatte, sah man sich genötigt, eines Nachts den ganzen Vorrat in die damals noch in Blüte stehenden Berliner Rinnen ablaufen zu lassen.
Das Vermögen der Frau Stirner war hin.
Aber die »Sieben« waren nicht die Leute, sich solche Bagatellen zu Gemüte zu nehmen. Ihre gute Laune blieb dieselbe, vor allem ihr Übermut, der nur in Form und Gegenstand beständig wechselte. Sie trieben dergleichen sportsmäßig, und Schraubereien standen ihnen obenan. In Stehelys Konditorei hatten sich damals ein paar Korrespondenten eingenistet, die mehrere süddeutsche Blätter von Klang und Namen mit politischen Neuigkeiten aus der ministeriellen Obersphäre zu versorgen hatten. Über einen dieser Korrespondenten hatten sich die »Sieben« aus einem vielleicht stichhaltigen, aber noch wahrscheinlicher nicht stichhaltigen Grunde geärgert und beschlossen deshalb, ihn »hineinzulegen«. Jeden Tag, solange diese Verschwörung anhielt, erschienen Faucher, Saint Paul und Edgar Bauer an einem bestimmten Tische der Stehelyschen Konditorei, vorgeblich um zu lesen, in Wahrheit aber, um eine gefälschte politische Debatte zu führen und grotesk erfundene Nachrichten in Kurs zu setzen. »Heinrich Arnim ist seit kurzem fest entschlossen...«, und nun kam etwas so Stupendes, daß der am Nachbartisch sitzende Korrespondent notwendig die Ohren spitzen mußte. Drei Tage später hatten die Verschworenen den Hochgenuß, den ganzen Galimathias in der einen oder andern Zeitung wiederzufinden.
Ein andres Opfer der »Sieben Hippelschen« war der Schriftsteller Saß, der sogenannte »lange Saß«. Er maß sechs Fuß und befleißigte sich einer dieser Größe fast gleichkommenden Feierlichkeit, woraufhin er sich natürlich als komische Figur behandelt sah. Immer neue Späße variierten das alte Thema vom Gulliver, das aber erst Anfang der fünfziger Jahre, wo die Hippelschen schon nicht mehr existierten oder doch nach allen Seiten hin zerstoben und verflogen waren, in einem illustrierten Witzblatte seinen glorreichen Abschluß fand. Der lange Saß war damals politischer Korrespondent in Paris, und das Blatt, ich glaube der Kladderadatsch, das sich mit ihm beschäftigte, zeigte zunächst, hochaufragend, die beiden Türme von Notre-Dame. Auf einem dieser Türme aber stand niemand Geringeres als Louis Napoleon selbst, unwirsch und halb verlegen, weil ihm die Zigarre ausgegangen war. Indessen Hülfe war nah. Der mit seinem Kopf gerade bis an die Balustrade reichende Saß kam rauchend vorüber und wurde denn auch von Louis Napoleon herangerufen und kameradschaftlich um Feuer angesprochen.
In diesem Bilde, das bei Saß' Popularität sein Publikum fand, lebte – sozusagen von der »milderen Observanz« – ganz schon jene moderne Form des Witzes, wie sie im wesentlichen noch jetzt in Gültigkeit ist; der vormärzliche Witz aber war viel, viel boshafter, persönlich beleidigender, vor allem unendlich überheblicher. Er lief darauf hinaus, alle Welt außer der eigenen werten Person als dumm hinzustellen und Freund und Feind zu düpieren. Die Lust daran beherrschte die damalige höher potenzierte Menschheit oder doch die, die sich dafür hielten, mit einer geradezu diabolischen Gewalt. Es war eine Geisteskrankheit der höheren Stände, letzter Rest jener schrecklichen Ironie, die zur Tieck-Schlegel-Zeit den ganzen Ton bestimmt hatte. Mir persönlich fehlt jedes Organ dafür. Ich find' es einfach albern. Es ist nichts, als Personen in den April schicken, Leute, die meist klüger sind als die, die sich über sie erheben möchten.
In diesem Düpierungsfanatismus waren die »Sieben« groß, wobei sie sich übrigens selber beständig beschummelten und ihre Niederlage, wenn sie sich ertappt sahen, mit Falstaff-Humor ertrugen. Einmal war Faucher sechs Wochen lang fortgewesen. Als er wiederkam, erzählte er von seinen Reiseabenteuern in Spanien und Südfrankreich und gab die glänzendsten Schilderungen. Das ging so eine ganze Weile. Dann aber unterbrach ihn Ludwig Buhl und sagte: »Du Vater der Lüge! Ich habe das Buch, draus du das alles genommen hast, zufällig auch gelesen. Du warst in Ahlbeck, aber nicht in Pau. Such dir ein dummres Publikum.«[Alle diese vorstehend erzählten Geschichten der »Sieben Hippelschen« aus der Mitte der vierziger Jahre Verdanke ich meinem seit nun fast zwanzig Jahren verstorbenen Freunde Heinrich Beta, auf den ich noch in Kürze zurückkomme. Wenn einzelnes nicht ganz stimmen sollte – ich persönlich glaube, daß im wesentlichen alles wahr ist –, so findet sich vielleicht wer, der die Fehler richtigstellt. Allerdings existiert wohl nur einer noch, der dazu fähig ist: Ludwig Pietsch. Und diesen einen möcht' ich bei der Gelegenheit nicht bloß zu Richtigstellungen, sondern vor allem auch zu Mitteilungen über die »Sieben« überhaupt dringendst aufgefordert haben. Denn Berlin hat kaum jemals – natürlich den einen Großen abgerechnet, der um jene Zeit noch die Elbe-Deiche revidierte – interessantere Leute gesehn als diese »Sieben«.]
Bald nach den Märztagen oder vielleicht auch schon vorher verlor ich Faucher auf lange Zeit aus dem Gesicht und sah ihn erst ungefähr zehn Jahre später in London wieder. Aber auch da nicht gleich. Ich war schon Jahr und Tag da, als ich ihn eines Tages bei dem eben erwähnten Heinrich Beta – vergleiche die Anmerkung – traf, der im Norden der Stadt, in Pratt-Street wohnte. Betas Haus war ein Rendezvous für alles, was damals von deutschen Politikern und Schriftstellern in London lebte. Seine Mittel waren nicht groß, aber seine Herzensgüte desto größer; er wurde nicht müde zu geben, und was er mit seinen gichtischen Fingern sich schwer verdiente, das gab er leichter Hand wieder fort. Er war auch in diesem Punkt, wie in allem, kritiklos. Aber eine gute, treue Seele, was niemand besser wußte als Faucher. Daraus wolle man aber nicht schließen, daß Faucher diese Güte mißbraucht hätte. Das konnte nicht gut sein. Faucher sah sich seine Leute sehr scharf an und modelte danach sein Benehmen; so gewiß er, aufs Ganze hin angesehn, ein Pumpgenie war, so war er doch voll Respekt vor dem Scherflein der Witwe. Dies Scherflein nahm er nicht. Vielleicht auch bloß deshalb nicht, weil es ihm zu wenig war. Er hatte, wie mancher andre, das Prinzip, sich nicht mit Kleinigkeiten abzugeben. Was ihn trotz dieses Prinzips immer wieder zu Beta führte, war einfach Anhänglichkeit aus gemeinschaftlich verlebten Berliner Tagen her und mehr noch ein Respekt vor dem eigenartigen Betaschen Talent. »O, diese Gartenlaube!« pflegte er auszurufen. »Wenn dieser Ernst Keil, dieser Barbarossa von Leipzig, nur einen Schimmer von Dankbarkeit hätte, so hätte er den Beta längst in Gold gefaßt. Alles, was er ist, ist er durch diesen. Das einzige, was man lesen kann, stammt aus Betas Feder. Und was tut er? Ich glaube er zahlt ihm ein Jahrgehalt. Aber was heißt das? Was ist das? Es ist ein Hungerpfennig.« So ging es weiter. Beta saß dabei und freute sich natürlich, denn welcher Schriftsteller freute sich nicht, wenn in diesem Stil auf Redakteur und Verleger gewettert wird – er hielt es aber doch jedesmal für angebracht, den »Barbarossa von Leipzig« zu verteidigen. Dies war auch nur in der Ordnung. Keil, was sonst immer ihm fehlen mochte, war alles in allem sehr splendid gegen Beta, und was Faucher zu des letztren Verherrlichung sagte, steckte stark in Übertreibung. Betas Verdienste um die Gartenlaube waren nicht gering, jegliches, was er schrieb, las sich gut und entbehrte nicht eines gewissen, ja mitunter großen Interesses. Aber es war doch meistens entlehnt, und seine Gabe bestand lediglich darin, alles, was er in den englischen Blättern fand, in eine Betasche Form umzugießen. Durch diese Form gewann es mitunter, aber doch nur sehr ausnahmsweise, und Fauchers Fehler war, daß er diese Ausnahmen zur Regel erhob.