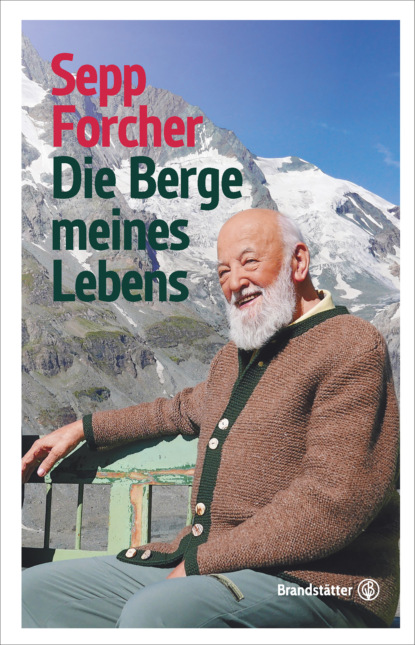- -
- 100%
- +

Unter Mitarbeit
von Mario Trantura

Aus dem Inhalt …
Edelweiß
Drei Mal Glockner
Mont Blanc
Hund und Katz
Watzmann-Ostwand
Die Hohe Tatra
La Meije
Tagesgipfel
Piz Bernina
108 Quellen

Inhalt
Edelweiß
Tauernkogel
Die Höhlenwelt
Nachsuche
Die Eiswand
Drei Mal Glockner
Dolomiten
Bergkristalle
Mont Blanc
Mons Claudianus
Hüttengespräche
Hund und Katz
Watzmann-Ostwand
Merci
Matterhorn
Die Langsamkeit
Die Hohe Tatra
Die Pyrenäen
Adamello – Presanella
Monte Disgrazia
Die Feuerspeier
La Meije
Mont Aiguille
Der Zahn des Riesen
Der Große Belchen
Tagesgipfel
Horizonte
Der Hochschwab
Die Hausberge
Piz Bernina
Triglav – Fermeda
Alpenverein
Großvenediger
108 Quellen
Die letzte Klettertour

Edelweiß
Meine ersten Berggefühle entwickelten sich recht langsam. Obwohl Hüttenwirt, Bergführer und Schilehrer, erachtete es mein Vater als nicht unbedingt notwendig, mich im Klettern und Schifahren zu unterweisen. Auf diese Art erzeugten die Alten früherer Zeit Abhängigkeit und das Gefühl der Minderwertigkeit. Die Folge war, dass ich lange Zeit ein schlecht ausgerüsteter, miserabler Schifahrer gewesen bin und für das Klettern überhaupt kein Interesse aufbrachte.
Hie und da wurde mir die Ehre zuteil, dass mich ältere Hüttengäste als Begleiter duldeten, wenn sie einen der vielen Gipfel des Tennengebirges ersteigen wollten. Tiefere Spuren hinterließen diese Unternehmungen bei mir Zehn- bis Zwölfjährigem jedoch nicht.
Stattdessen befasste ich mich intensiv mit der Welt der Bergblumen. Ein Geschenk der Natur, das nur mäßiger Anstrengung und wenig Wagemut bedarf. „Es ist zum Niederknien“ – dieser Ausspruch muss heutzutage für alles herhalten, ist zu einem sinnentleerten Sager geworden. Für mich war es schlichte Notwendigkeit, mich hinzuknien, wenn ich im Frühling die ersten Schneerosen und Soldanellen, die Eisglöckchen oder auch Troddelblümchen bewundern wollte. Dann kamen der Seidelbast, das unvergleichliche Blau der Enzianblüten, der herbe Duft der Alpenrosen und in den schwerer zugänglichen Schrofen die Goldprimel oder, wie wir dazu sagen, das Gamsbleaml oder Petergstamm.
Als Krönung erschien im steilen Felsgelände das alpine Löwenpfötchen, im Latein der Botaniker Leontopodium nivale subsp. alpinum genannt und Innbegriff der Bergromantik: das Edelweiß. Für unsere Nachbarn, die Bauern, die Almleute, die Sennerinnen, das einzige Symbol, das sie im Zusammenhang mit dem in ihren Augen nutzlosen Bergsteigen gelten ließen. Folglich wurde das Suchen, Finden und Pflücken schöner Edelweißsterne zu einer frühen Leidenschaft für mich, die sich allmählich steigernd in Freude am Klettern verwandelte.
Meine erste Klettertour am Seil eines guten Freundes war die Nordkante des Knallsteins im Tennengebirge. Ich besaß nur Kletterschuhe minderer Qualität und nach der ersten Seillänge waren sie schon unbrauchbar. Den Rest der Tour ging ich barfuß. Das Gipfelgefühl war überschattet von dem Gedanken an den Abstieg über grobes Geröll. Der Freund erbarmte sich und holte vom Einstieg meine festen Schuhe. Damit bewies er mir, dass Bergkameradschaft kein leerer Begriff sein muss.
Was Gipfelglück sein kann, erlebte ich als junger Spund, der einen alten Herrn auf die Bischofsmütze führte. Am Vortag hatten die Filzmooser Kriegsheimkehrer ein großes hölzernes Gipfelkreuz aufgestellt. Der alte Herr und ich waren die ersten Touristen oben beim Kreuz. Die Tränen, die seine alten Wangen benetzten, haben mich tief berührt.
Heute weiß ich, warum es mir immer wichtig war, meinen Seilgefährten das Gipfelglück zu vermitteln.
Tauernkogel
Auf dem Gipfel des Tauernkogels gedeiht der Blaue Eisenhut. Die schönblättrige Pflanze ist hochgiftig. Ihre blauen Blüten erinnern an die Form eines Eisenhelms, wie ihn vor Jahrhunderten die Ritter trugen. Ihr bevorzugter Nährstofflieferant ist Schafmist. Und solchen gibt es auf dem etwas über 2000 Meter hohen Gipfel genug. Ein sicheres Zeichen dafür, dass es Schafe waren, die den Kogel als Erste bestiegen. Für mich, damals kaum zehn Jahre alt, war es nicht allzu schwer, es den Schafen gleichzutun, und so wurde der Tauernkogel mein erster 2000er, den ich aus eigenem Antrieb und ohne Führung bestieg.
Sechs Jahre später stand ich wieder einmal oben. Im Winter. Mit meinem Begleiter Othmar Stradner, der mir als ehemaliger Fallschirmjäger ein Vorbild für Kühnheit und Wagemut war. Beides Eigenschaften, die für unser Vorhaben notwendig waren. Denn wir wollten die Ersten sein, die mit Schiern vom Gipfel über die teils sehr steilen Südosthänge zu Tal fuhren. Ein Unternehmen, das nicht ungefährlich und wahrscheinlich aus diesem Grund auch von niemandem vorher versucht worden war. Das leichtfertige Vorhaben gelang wohl auch deshalb, weil sich der Spruch vom Dummen, der das Glück hat, wieder einmal als richtig erwies. Verglichen mit den tollkühnen Steilwandfahrern unserer Tage ist unsere Tat als Kindergartenspiel zu betrachten, weil wir – gleich Kindern – kein Gefühl für die Gefahr aufbrachten.
In der Zeitung konnte man dann von den schneidigen Erstbefahrern lesen, was zu einer kurzzeitigen, sich schnell verflüchtigenden Berühmtheit führte. Geblieben ist die lebenslange Freundschaft mit Othmar.
In den folgenden Jahren ist mir das Tennengebirge mit seinen Gipfeln, Höhlen und dem karstigen Plateau, das in den kurzen Sommern von unzähligen Schafen beweidet wird, so vertraut geworden, dass ich von meiner Bergheimat sprechen kann. Jahrelang war die von meinen Eltern bewirtschaftete Söldenhütte des Österreichischen Alpenvereins mein Daheim. Von meiner Schlafkammer aus konnte ich die ganze Kette der Hohen Tauern überblicken. Dazu noch das mächtige Massiv des Hochkönigs. Diese ganze Pracht zu sehen, wirkte für mich wie eine ständige Herausforderung, eine ewige Wunschliste.

Auf dem Weg zur Söldenhütte im Tennengebirge
Und so nach und nach ging ein Wunsch nach dem anderen in Erfüllung. Hochalmspitze, Ankogel, Schareck, Sonnblick, Glockner, Wiesbachhorn, Hochtenn und Hochkönig. Sie alle konnte ich von meiner Liste streichen und sie alle füllten meinen Erinnerungsrucksack mit schönen, ernsthaften und markanten Erlebnissen.
Meine Schlafkammer gibt es nicht mehr. Die Söldenhütte ist um- und ausgebaut und in Heinrich- Hackel-Hütte umbenannt worden. Aber unausrottbar wie der Blaue Eisenhut ist meine Zuneigung zur alten Bergheimat geblieben.

Die Höhlenwelt
Der Lichtbildvortrag, den der Salzburger Höhlenforscher Gustav Abel im Jahr 1942 in meiner Klasse in der Volksschule Mülln hielt, haftet heute noch in meinem Gedächtnis. In leuchtenden Farben und im Großformat wurde uns Kindern der Zauber der Eisriesenwelt nahegebracht. Kurz darauf glückte Abel die Entdeckung der Eiskogelhöhle im Tennengebirge.
Beide Geschehnisse prägten meine Entwicklung über Jahre hinweg, weil sie meine Neugier auf die finstere, lichtlose Welt im Inneren der großen Kalkberge lenkten. Für die Erforschung und Vermessung der Eiskogelhöhle bot sich als idealer Stützpunkt die Söldenhütte an. Vom Bahnhof im damaligen Dorf Werfen, in drei Gehstunden bequem erreichbar, ging man von der Hütte in nur eineinhalb Stunden zum Höhleneingang. Die Arbeit der Forscher war nur an den Wochenenden möglich, und trotz der großen Strapazen trugen alle mit Begeisterung zum Erfolg bei. Riesige Hallen und Gänge, prächtige Eis- und Tropfsteinfiguren und schließlich eine Gesamtlänge von über 6000 Metern lohnten ihr Tun.
Mich berührte das alles nur am Rande, weil ich außer in den Ferien im Schülerheim in Salzburg meine Unterkunft hatte. Die Erzählungen der Forscher und meiner Eltern hielten jedoch meine Neugier wach. In den Ferien war es auch, dass ich die gewaltige Eisriesenwelt besuchen konnte. Der Geruch vom Acetylengas aus der Karbidlampe ist mir seither vertraut. Dann, 1947, wagte ich auf eigene Faust den ersten Erkundungsvorstoß in die Eiskogelhöhle. Karbidlampe und Steigeisen entlieh ich mir aus dem Depot der Forscher in der Söldenhütte, und so machte ich die ersten Schritte auf dem blanken, harten Höhleneis.
Das Gefühl, welches ich dabei empfand, war überwältigend. Wie immer dem des Kenners, des Wissenden, weit überlegen. Neugier, Naivität und grenzenloses Staunen sind die Waffen der Laien. Dass auch ein Quäntchen Dummheit dazugehört, versteht sich von selbst und wurde mir nach stundenlanger Suche peinlich bewusst. In einer kleinen Eishalle fand ich keine Fortsetzung mehr. Also – blamable Umkehr. Aber das Feuer war entfacht.
Gustav Abel nahm mich unter seine Fittiche. 1949 wurde ich Mitglied des Salzburger Höhlenvereins, ein Jahr danach legte ich die Prüfung zum „provisorischen“ Höhlenführer ab, zum „Echten“ fehlte mir die Volljährigkeit. Vielen Menschen konnte ich die Schönheit der Eiskogelhöhle nahebringen, und meine Freude an der Unterwelt führte mich im Lauf der Jahre in unzählige Höhlen in ganz Europa. Mein Vater, der Dolomitenbergführer, konnte das nicht verstehen und sprach gern und oft von den Höhlenwürmern. Vielleicht war das auch ein Zeichen des Respekts …
Heute sind aus den Höhlenforschern Spezialisten geworden. Wissenschaftler, die in bisher unvorstellbare Tiefen vordringen, Experten, die sich mit den Bewegungen des Wassers dort unten befassen, Menschen, deren Abenteuerlust dem Wissen um die Unergründbarkeit vieler Dinge gewichen ist und deren Tun für die Allgemeinheit immens wichtig ist, aber oft wenig geschätzt wird.
Ich bewundere sie alle. Obwohl ich immer noch gerne an den Geruch von Acetylengas, das Fauchen aus dem Brenner der Karbidlampe und ihr helles, weißes Licht denke.
Nachsuche
Nachsuche ist ein Wort, das Jäger ungern hören. Wenn ein Wild durch einen Fehlschuss nicht getötet, sondern nur verletzt wird, und daher flüchtig werden kann oder sich versteckt, verkriecht, beginnt die Suche nach ihm.
In meiner Jugendzeit war ich für meine Kenntnisse der alten, vergessenen Jägersteige und vieler Gamswechsel bekannt. Und wenn die Jäger mein Herumstreunen in ihren Revieren auch mit Misstrauen betrachteten, bei einer Nachsuche war ich für sie sehr oft hilfreich. Mein Antrieb war ein verletztes, leidendes Tier so aufzubringen, dass es der Jäger mit einem gezielten Schuss von seinem Leiden erlösen konnte. Dazu muss gesagt werden, dass Fehlschüsse in der Regel Sache der Jagdgäste und ganz selten der Jäger sind.
Meine erste Nachsuche galt einem von der Jagdherrin angeschossenen Gamsbock, der trotz einer schrecklichen Verletzung seines Hinterlaufs dreibeinig flüchtig geworden war. Die Verfolgung des armen Tieres gestaltete sich schwierig. Ich wurde seiner kaum ansichtig, nur wenige Blutstropfen (in der Jägersprache Schweiß) in dem felsigen Gelände hielten mich gleich einem Hund auf seiner Fährte. Stellen, die ich nur kletternd und daher zeitraubend überwinden konnte, der Gamsbock übersprang sie mit einem Satz. Nach vielen Stunden der Verfolgung konnte er endlich erlegt werden. Es ist ein seltsames Gefühl, das einen beschleicht, wenn man sich über ein totes Tier bückt, dessen schwere Schussverletzung nach menschlichem Ermessen eine Flucht, noch dazu im schwierigen Felsgelände, unmöglich erscheinen lässt. Da werden einem die eigene Schwäche und Plumpheit deutlich bewusst.
Im Herbst, wenn die vielen Schafe von den Höhen in das Tal getrieben werden, kann es vorkommen, dass sich einige Tiere oder kleine Gruppen absondern, sich gewissermaßen dem Herdentrieb verweigern. Sie beginnen allmählich zu verwildern, widerstehen den Lockrufen der Hirten und dem für sie notwendigen Salz. Mit Sicherheit werden sie den Winter nicht überleben. Also heißt es für den Hirten oder den Bauern, der seine Tiere vermisst, nachsuchen! Oft wurde ich gebeten, mitzuhelfen, weil es selten gelingt, sie einzufangen oder überhaupt zu finden.
Eines dieser verwilderten Schafe wurde von einer kleinen Schneelawine mitgerissen, blieb aber unverletzt auf einem kleinen Felsvorsprung in einer senkrechten Wand liegen. Der Schafhirt sah für sich keine Möglichkeit, dem Tier helfen zu können. Aber er wusste von meinen Kletterfähigkeiten und er hoffte auf eine rettende Lösung mit meiner Unterstützung. Die leider nicht gelang. Ich seilte mich etwa 30 Meter zu dem Felsvorsprung, auf dem das Schaf sich befand, ab, und als ich spürte, wie es unruhig wurde, versuchte ich, am Seil ein paar Meter über ihm hängend, es mit leisen Lockrufen zu besänftigen. Anfangs schien es auch so, als ob das Schaf ruhiger würde. Langsam, in kleinen Rucken verkürzte ich den Abstand. Bis sich, von einer Bewegung des Seils verursacht, ein Stein löste. Das Schaf erschrak und sprang in die Tiefe. 60 Meter weiter unten zerplatzte ein Tierleben auf einer Felsplatte.
Der Jäger beobachtete, wie ein Steinadler versuchte, ein junges Reh zu fassen. Das Reh entkam, offenbar verletzt, und verkroch sich in einer Felsspalte. Die Nachsuche war nicht aufwendig. Nur der eine Zeitlang über mir kreisende Adler brachte einige Spannung in das Geschehen. Beim Felsspalt, in dem sich das Reh verkrochen hatte, kamen mir Zweifel. Ich dachte, der Jäger hätte sich getäuscht. So eng, wie der Felsspalt war, schien es unmöglich, dass ein Reh sich darin verschliefen konnte. Doch der Jäger hatte schon richtig gesehen und ich war es, der sich getäuscht hatte. Denn als ich an dem mittlerweile verendeten Wild zu ziehen begann, kam nach und nach der ganze Körper hervor. Wie groß muss die Angst gewesen sein, um sich so klein wie nur möglich zu machen? Der Jäger schenkte mir das Reh und als ich es zerwirkte, sah ich, dass der Adler mit seinen zupackenden Fängen fünf Rippen gebrochen hatte. Mit meiner Nachsuche brachte ich ihn um seine sichere Beute.
Wird in den Bergen jedoch ein Mensch vermisst, bekommt die Nachsuche eine vollkommen andere Bedeutung. Da gesellen sich dem Suchenden Hoffnung und Sorge zu. Hoffnung, den Gesuchten lebend zu finden, Sorge, ihn nicht mehr retten zu können und bergen zu müssen, was einst voll des Lebens und der Freude war. An einem total verregneten Pfingstwochenende besuchte uns auf der Söldenhütte ein einziger Gast. Ich freundete mich schnell mit ihm an. Er war 19 Jahre alt, Schustergeselle, und er war stolz auf sein Gesellenstück. Ein Paar solide Bergschuhe mit Goiserer Nägeln. Anderntags wollte er am Bleikogel vorbei zur Laufener Hütte und dann hinunter nach Abtenau. Er kam nie dort an.
Mit seinem Bruder unternahm ich dann die traurigste Nachsuche meines Lebens. Nach einigen Stunden entdeckte ich den zerschmetterten Körper meines Freundes. Sein Bruder weinte lautlos. Um ihm den Anblick des Toten zu ersparen, schickte ich ihn zurück nach Werfenweng, um dort vom einzigen Telefon die Gendarmerie und die Bergrettung zu verständigen. Ich stieg zum Abgestürzten ab und wartete stundenlang auf das Eintreffen des Bergungstrupps.
Mein Freund wurde ohne seine selbstgemachten Bergschuhe begraben. Sein Vater schenkte sie mir, und ich trug sie, so lange die Goiserer Nägel sie zusammenhielten.

Werfenweng 1950
Die Eiswand
Ein Eispickel, ein alter Eishaken mit Lederschlaufe und zwölfzackige Steigeisen. Mit dieser Ausrüstung wollte ich sie bezwingen: die 500 Meter hohe Nordwestwand des Wiesbachhorns in der Glocknerguppe, die wohl berühmteste Eiswand der Ostalpen.
Steil wie ein Kirchendach, und mittendrin als Zugabe ein fast senkrechter Eiswulst. Ihre Durchsteigung hatte in Bergsteigerkreisen den Wert einer Meisterprüfung. Welche Kraft trieb mich dazu an, allein da hinaufzusteigen? Als damals 19-Jähriger verdiente ich im Monat 500 Schilling und als Draufgabe ein paar handgenähte Bergschuhe. Ich hatte nur sechseinhalb Klassen Volksschule und keine Berufsausbildung. Für einen Träger, der jeden Tag mit 50 Kilo auf dem Buckel die 800 Höhenmeter vom Mooserboden zum Schwaigerhaus hinaufstieg, war das Ausbildung genug.
Kraft und Ausdauer bedürfen keiner Lehre oder Schule. Die Arbeiter beim Kapruner Kraftwerksbau beachteten den jungen Burschen mit seiner Kraxe nur, wenn die Last sichtbar über der Norm lag. In so einem Umfeld wächst natürlich der Wunsch nach Anerkennung. Als Träger wirst du kein Held. Und wenn du in dieser alpinen Umgebung einen der vielen Gipfel besteigst, auch nicht.
Blieb also die Eiswand. Die erste Hürde, den Bergschrund, jene trennende Spalte zwischen Gletscher und Wand, überwand ich mühelos. Dann, wissend, dass an einen Rückzug nicht zu denken war, hieß es, kleiner Mensch gegen große Wand. Außer einigen Standplätzen für ein kurzes Atemholen schlug ich keine Stufen. Die Zwölfzacker an den Füßen bissen sich gut in das Eis und mit dem alten Eishaken in der Linken und dem Pickel verwandelte ich mich vom Homo erectus in einen auf allen Vieren bergwärts kriechenden Käfer.
Um den Eiswulst in der Wandmitte zu überwinden, schlug ich Löcher in das Eis. Damit konnte ich den Schwerpunkt verändern und ein Übergewicht verhindern. Nach eineinhalb Stunden stand ich im Sonnenschein auf dem Gipfel. Einige Bergsteiger hatten mich beobachtet und gratulierten mir: Der Wunsch nach Anerkennung hatte sich zumindest für diesen Augenblick erfüllt.
Heute, mehr als 70 Jahre später, ist das Eis der Nordwestwand schon lange weggeschmolzen. Alles, was einst kalt und abweisend war, ist einem reizlosen Graubraun gewichen. Ein berühmtes Gesicht hat seine Schminke verloren. Der kleine Mensch ist deswegen nicht traurig. In seiner Erinnerung glänzt immer noch das steile Eis.

Drei Mal Glockner
Anfang Oktober 1950 stand ich zum ersten Mal auf dem Gipfel des Großglockners. Ich war allein und hatte im Winterraum der Adlersruhe unter feuchten Decken eine kalte Nacht verbracht. Er schneite leicht, der Wind blies stark, die Felsen waren von einer Schnee- und Eisschicht bedeckt, Nebel raubte die Sicht. Alle Misslichkeiten ließen den Gedanken an einen Aufstieg zum Gipfel verrückt erscheinen.
Als Träger war ich es gewohnt, bei jedem Wetter unterwegs zu sein und jetzt, im lastenfreien Zustand, sollte ich meinen Traum aufgeben und auf den Gipfel verzichten? Der Aufstieg vom Pasterzengletscher zum Hofmannskees und die kalte Nacht sollten umsonst gewesen sein? Und weil Nachgeben nie zu meinen Stärken gezählt hat, stand ich also an einem kalten, stürmischen Oktobertag allein auf dem Gipfel des Großglockners.
Meine Tat wurde durch nichts belohnt. Das Wetter ließ keine hehren Gefühle aufkommen. Über Sinn oder Unsinn meines Tuns machte ich mir keine Gedanken. Ich hatte mein Ziel erreicht und das war genug. Der Abstieg über den verschneiten Gletscher, das Überqueren der Pasterze, das Alleinsein inmitten der großen Berge, das alles wären genug Gründe gewesen, lieber einem Kegelclub beizutreten als einem alpinen Verein. Die vielzitierte Liebe zu den Bergen blieb mir fremd. Aber die Bergleidenschaft steckte schon in mir. Wie eine Krankheit, auf deren Verschwinden man ein Leben lang hofft, auch wenn der Verstand einem sagt, dass man gar keine Heilung will. In einem Sonderbus der Post – die Saison war zu Ende – fuhr ich von der Franz-Josefs-Höhe nach Zell am See. Ich war der einzige Fahrgast.
Ein strahlender, makelloser Sommertag Ende Juli 1951 ließ den frischverschneiten Glockner, wenn man ihn von der Oberwalderhütte am Großen Burgstall aus ansah, wirklich wie einen Bergkönig erscheinen. Daher auch sein Beiname „König der Norischen Alpen“. Um 4 Uhr früh war ich vom Mooserboden weggegangen. Im dortigen Barackenlager durfte ich das Bett eines Arbeitskollegen, der Schichtdienst hatte, benützen und ein paar Stunden schlafen. Um 7 Uhr trank ich auf der Oberwalderhütte meinen Frühstückstee. Anschließend genoss ich ausgiebig den wunderbaren Anblick des „Königs“.
Die Nordwand mit der berühmten Pallavicinirinne ließ meine Sinne nicht los. Um 8 Uhr verließ ich die Hütte, nachdem ich der Hüttenwirtin erklärt hatte, dass ich den Glockner über die Pallavicinirinne ersteigen wolle. Der Wiener Markgraf, dessen Namen die steile Eisrinne trägt, hat sie mit drei Heiligenbluter Bergführern 1876 erstmals bestiegen. Sie brauchten elf Stunden und schlugen 2500 Stufen ins Eis. Meines Wissens war ich erst der dritte Bergsteiger, der sie im Alleingang bezwingen wollte. Der Zustieg über den spaltenreichen oberen Pasterzenboden und in das innere Glocknerkar war gefährlich und schwierig. Aus der Nähe sah die Rinne noch steiler aus und in mir kamen leise Zweifel auf. Das Wetter blieb stabil und kühl, es war daher mit nur geringer Steinschlaggefahr zu rechnen. Wenn es mir gelingt, die schwierige Eisspalte des Bergschrunds zu überwinden, überwinde ich auch meine Zweifel, dachte ich. Und so stand ich zwei Stunden später zum zweiten Mal in meinem Leben auf dem Glocknergipfel. Glücklich und mit dem triumphalen Gefühl, nicht nur die Rinne, sondern mich selbst bezwungen zu haben.
Er ließ mich nicht los, der große Glockner. Um ihm nahe zu sein, verdingte ich mich im Sommer 1952 als Träger für die Oberwalderhütte. Trägerlohn war 1,20 Schilling pro Kilo. Mit einem Durchschnittsgewicht von 60 Kilo stieg ich Tag für Tag die drei Stunden vom Freiwandeck zur Hütte hinauf. Oft auch zwei bis drei Mal am Tag. In der Hochsaison half mir ein Wiener Student aus. Otto war ein durchtrainierter Sportler und ein guter Kletterer. Beim Tragen hielten wir es so, dass er immer 20 Kilo weniger als meine Last zu laden hatte. Für einen Wiener Studenten waren 40 Kilo mehr als genug. Und unsere Regelung bewährte sich gut.
Bei jeder Rast hatten wir die Nordwand des Glockners vor Augen. Unser Wunsch, sie auf der schwierigsten Route zu durchsteigen, wurde immer stärker. Endlich hatten wir es geschafft und uns einen freien Tag herausgeschunden. Im Eiltempo erreichten wir das Innere Glocknerkar. Der Bergschrund sah schreckenerregend aus, war für uns mit unseren bescheidenen Hilfsmitteln unüberwindbar. Dazu kam plötzlich einsetzender, schwerer Steinschlag, ausgelöst durch einen Föhneinbruch, der die dünnen Eisschichten im höheren Wandbereich schmelzen ließ. Also Rückzug und neuer Plan, denn auf den Gipfel wollten wir nicht so leicht verzichten.

Helli und ich auf dem Gipfel des Großglockner 1952