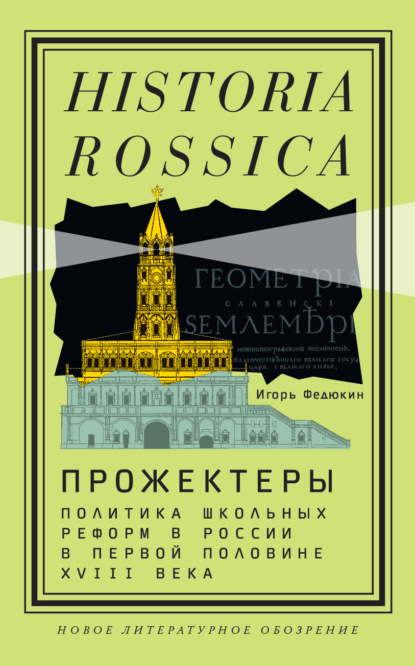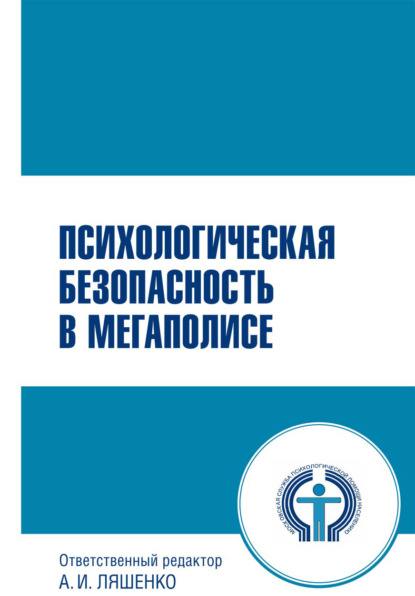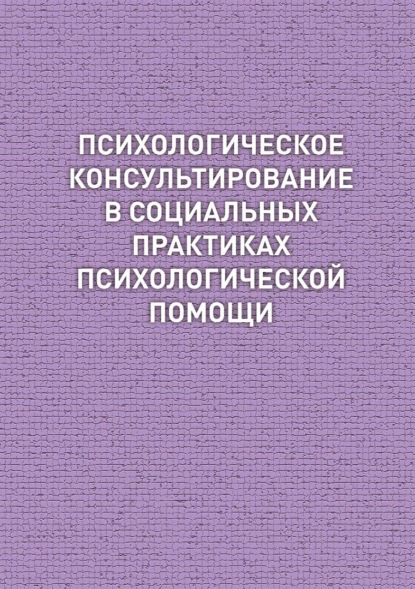Seewölfe Paket 11

- -
- 100%
- +
„Und Sie der Gouverneur, nicht wahr?“
„Natürlich.“
„Na, das ist aber fein“, meinte Hasard gelassen. „Nur taugt die ‚Isabella‘ zur Zeit nicht zum Kriegspielen – wegen des Ruderschadens. Sie muß aufgedockt werden, weil sie ein neues Ruder braucht. Für Gefechte ist sie mit dem Notruder ungeeignet, es sei denn, Sie haben die Absicht, dieses schöne Schiff – wie Sie vorhin selbst sagten – sinnlos zum Wrack werden zu lassen.“
„Aber nicht doch, mein Lieber. Beheben Sie den Schaden, und dann schlagen wir gemeinsam gegen die Portugiesen los.“
„Und was hab ich davon?“ fragte Hasard freundlich.
Brutal sagte de Jonge: „Ich bewahre Sie vorm Galgen.“
Hasard verbeugte sich leicht. „Zu gütig. Ich werde Ihnen ewig zu Dank verpflichtet sein, Kapitän de Jonge.“ Die Ironie in Hasards Stimme war kaum bemerkbar.
Aber de Jonge hatte sie wohl doch herausgehört. Mit der Arroganz, die er bereits Matt Davies gegenüber gezeigt hatte, sagte er: „Ich warne Sie, Killigrew! Wenn Sie Zicken versuchen, erfährt der Portugiese in der nächsten Stunde, wer Sie sind. Glauben Sie ja nicht, Ihr Schiff bliebe unbeobachtet. Jeder Ihrer Schritte wird überwacht. Meine Spitzel – auch unter diesen Inselkanaken – sind überall.“
„Gut, daß ich das weiß“, sagte Hasard ungerührt. „Im übrigen müssen Sie erst mal beweisen, daß ich kein Ire bin. Wie wär’s denn, wenn ich den Spieß umdrehe? Ich brauche nur zur portugiesischen Faktorei zu gehen und den lieben Leuten dort zu erzählen, daß Sie die Absicht haben, Bantam für sich zu vereinnahmen. Wird mir dann der Ire geglaubt oder nicht?“
„Das werden Sie nicht tun!“ fauchte der Kapitän.
„Und warum nicht?“
„Weil ich es verhindern werde.“
Hasard lachte. „Sie sind ein Idiot, de Jonge! Ich muß zu den Portugiesen gehen, um sie sehr höflich darum zu bitten, ihr Dock benutzen zu dürfen. Ohne Dock keine Reparatur, ohne neues Ruder kein Gefecht auf Ihrer Seite. Und noch etwas: Falls Sie mich daran hindern sollten, die Faktorei aufzusuchen, garantiere ich Ihnen eine Schlacht hier auf der Pier, daß sich die Portugiesen die Hände reiben werden. Weder ich noch die Männer dieses Schiffes sind erpreßbar. Merken Sie sich das! Und jetzt hauen Sie ab, Sie Gouverneur, oder ich lasse Sie als gemeingefährlichen Verrückten hier an Ort und Stelle in Ketten legen!“
Der niederländische Kapitän duckte sich, als habe er die Absicht, Hasard anzuspringen. Nur war da Matt Davies, der immer noch vor ihm stand und die Stelling versperrte. Und Matt Davies begann, liebevoll seinen Prothesenhaken zu streicheln. Ganz sachte fuhr seine linke Hand über den Haken hin und her.
Und er sagte: „Verschwinde, du Käsefurz, oder ich raspele mir von dir ein paar Scheiben ab. Bestell das auch deiner Käse-Crew. Uns Iren droht man nicht. Wer es dennoch tut, muß lebensmüde sein.“
Der Kapitän Pieter de Jonge marschierte ab – wutschnaubend, explosiv geladen. Niemand konnte es verhindern, daß er stolperte. Das war Arwenacks Werk.
Der war nämlich über die Achterleinen aufs Achterdeck geturnt, hatte irgendwo seine geklauten Kokosnüsse deponiert, eine aber behalten. Hinter der Steuerbordgalerie hatte er sich hingehockt und dem Wortwechsel gelauscht. Zwischendurch hatte er mit einem Nagel zwei Augen oben in der Nuß ausgestochen und die Milch getrunken.
Vielleicht paßte ihm die Stimme des niederländischen Kapitäns nicht, vielleicht auch spürte er, daß von diesem Mann etwas Bedrohliches ausging.
Jedenfalls verzichtete er auf das Fleisch der Kokosnuß und warf sie dem Kapitän geschickt zwischen die Füße, als der achtern vorbeimarschierte.
Pieter de Jonge stolperte und schlug der Länge nach hin. Die Kokosnuß rollte über die Pier und klatschte zwischen Kai und Schiff ins Wasser.
Und Arwenack hüpfte keckernd auf der Galerie auf und ab und betrommelte seinen Bauch. Sir John fehlte auch nicht. Der turnte auf der Achterleine herum und verriet, daß er die englischen Kraftausdrücke bestens beherrschte – von der irischen Sprache hatte er noch nichts mitgekriegt. Von wem auch!
Dem Kapitän de Jonge wurde von Sir John mitgeteilt, daß er eine algerische Wanderhure sei.
Zu diesem Zeitpunkt mußte der niederländische Kapitän gedacht haben, daß diese „Isabella“ Verrückte beherbergte. Als er sich wieder aufgerappelt hatte und zu seinem Schiff eilte, sah es wie eine Flucht aus.
3.
Als das Grinsen an Bord der „Isabella“ vorbei war, fragte Ed Carberry: „Trotzdem – Landgang, Sir?“
„In Ordnung, Ed. Und wenn ihr den Niederländern begegnet, vergeßt nicht, daß ihr echte Iren seid.“
Ed Carberry strich sich über das Rammkinn. „In dem Fall brauchen wir nicht den frommen Pilger zu mimen?“
„Nein, braucht ihr nicht. Aber ich möchte darum bitten, die Niederländer nicht zu provozieren. Verhaltet euch friedlich. Wenn sie euch allerdings reizen, dann habt ihr keinen Grund, euch in aller Demut zu beugen. Und kämpft sauber. Die Kerle sollen merken, daß ihr scharfe Äxte seid, denen man besser aus dem Weg geht. Wenn ihr mit ihnen spielt, reicht das vollauf. Wir sind keine Totschläger, verstanden?“
„Aye, aye, Sir“, erwiderte Carberry strahlend, und wenn dieser Kerl mit seinem zernarbten Gesicht strahlte, dann sah es aus, als fletsche ein Wolf die Zähne. „Wie viele von diesen frommen Pilgern dürfen an Land, Sir?“
„Hm.“ Hasard überlegte. „Wenn ihr zu sechst seid, sollte das reichen, denn wir müssen auch damit rechnen, daß dieser de Jonge versucht, etwas gegen die ‚Isabella‘ zu unternehmen. Sollte das der Fall sein, lasse ich drei Böller mit den Drehbassen abfeuern. Dann ist für die ‚Isabella‘ Gefahr im Verzug, und ihr brecht sofort euren Landgang ab.“
„In Ordnung, Sir. Du gehst nicht mit?“
„Ben wollte auch mal an Land“, erwiderte Hasard und drehte sich zu Ben Brighton um. „Oder?“
„Genau.“ Der ruhige, breitschultrige Mann lächelte. „Ich muß mir mal die Füße vertreten. Außerdem muß einer aufpassen, daß unser Ed es nicht zu wild treibt.“
„Mister Brighton“, sagte der Profos mit gesalbter Stimme, „ich bin ein durch und durch friedlicher Mensch, wie jeder hier an Bord weiß. Und noch nie habe ich es wild getrieben, das liegt mir nicht …“
Schallendes Gelächter dröhnte über das Mitteldeck.
Als es verebbte, schüttelte Carberry den Kopf. „Ich weiß gar nicht, was es da zu lachen gibt, was, wie? Euch juckt wohl das Fell, ihr verlausten, irischen Plattfüße?“ Er stach den Zeigefinger vor, der den Umfang eines Belegnagels hatte. „Mister Ballie, du gehst mit.“ Der Belegnagel richtete sich auf den schwarzen Mann aus Gambia. „Du, Mister Batuti, du, Mister Stenmark, und du, Mister Roskill. Oder möchte einer der vier Gentlemen an Bord bleiben?“
„Nein!“ donnerten die vier Männer.
„Dann zieht saubere Klamotten an, ihr Fürsten der Hölle, wascht euch den Hals und die Pfoten, wie es sich geziemt, wenn man an Land geht. Mister Roskill, du brauchst gar nicht so dämlich zu grinsen, deine schwarze Mähne solltest du mit einer Wurzelbürste entstauben, außerdem wachsen dir Haare aus der Nase, lang genug, um dreikardeelige Zöpfe daraus zu spleißen!“ Und dann donnerte der Profos: „Wird überhaupt mal Zeit, euch daran zu erinnern, daß der Kapitän im Himmel das Wasser erfunden hat, damit solche Kanalratten wie ihr nicht verstauben. Wer sich ab heute nicht jeden Morgen eine Pütz Seewasser über den Schädel gießt, wird von mir persönlich gereinigt. Und anschließend wringe ich einen solchen Kerl aus, daß er meint, von zehn Waschweibern gemangelt zu werden, jawohl! Mister Ballie, Mister Batuti, Mister Stenmark, Mister Roskill – in fünf Minuten ist Abmarsch!“
Sie brauchten weniger als fünf Minuten, und Sam Roskill hatte sogar seine Nasenhaare gestutzt, was den Profos zu einem zufriedenen Grunzen veranlaßte.
Manierlich meldete Carberry sechs Männer von Bord, und dann zogen sie los, in einer Reihe nebeneinander, Ben Brighton und der Profos am rechten Flügel. In dieser Phalanx marschierten sie im Gleichschritt an der „Zwarte Leeuw“ vorbei, von der sich etwa zehn Minuten später eine Gruppe von Männern löste und die Richtung der sechs Seewölfe einschlug.
Es dunkelte bereits, aber Dan O’Flynns scharfe Augen zählten fünfzehn Kerle, was Hasard den Kopf wiegen ließ.
„Fünfzehn gegen sechs“, sagte er mit leichter Besorgnis in der Stimme.
„Unsere zählen doppelt“, sagte Dan O’Flynn.
„Bleiben immer noch drei“, meinte Hasard.
„Die nimmt Ed zur Brust“, erwiderte Dan unbekümmert. „Wenn sie die Kampfesweise der Mönche von Formosa anwenden, hat’s bei den de Jonges sowieso gerappelt.“
„Dan“, sagte Hasard mahnend, „tu mir einen Gefallen und sei nicht so großkotzig. Wer seinen Gegner unterschätzt, kann eine böse Überraschung erleben. Draußen auf der Reede liegen noch vier Niederländer, mit der ‚Zwarte Leeuw‘ sind es fünf und alle beachtlich gut bestückt. Wenn Ferris unserer Tante ein neues Ruderblatt verpaßt hat, werden wir darüber nachdenken müssen, wie wir ungerupft verschwinden können. Ich habe keine Lust, mich mit den Niederländern herumzuprügeln, nur weil dieser de Jonge scharf auf unser Schiff ist.“
„Weiß ich“, sagte Dan ungerührt und grinste. „Wir können uns zur Abwechslung ja mal auf die Seite der Portugiesen schlagen. Laut de Jonge scheinen sie mit denen bereits Stunk zu haben. Aus gebotener Klugheit sollte man es mit denen halten, die hier über die älteren Rechte verfügen. Und das sind nun mal die Portugiesen. Die haben mit den Sultanaten hier Verträge geschlossen, genießen also zumindest deren Wohlwollen, daher wäre es von uns unklug, die Portugiesen zu verärgern, ganz abgesehen davon, daß wir ihr Dock brauchen.“
„Alles richtig. Und wenn die Portugiesen auch noch was gegen uns haben, sitzen wir zwischen zwei Stühlen – von Land her Zunder und von der See her Zunder, denn die Niederländer können diese Bucht abriegeln.“ Hasard blickte sinnend zu den vier Schiffen hinüber. „De Jonge, so vermute ich, scheint darauf versessen zu sein, das Gewürzmonopol der Portugiesen zu brechen oder sich zumindest hier in Java festzusetzen. Wenn er ein anständiger Kerl wäre, hätte er in uns einen Bundesgenossen. Aber in dem Mann steckt zuviel Brutalität – der geht über Leichen, um seine Ziele zu erreichen. Wo er hintrampelt, läßt er Zerstörung zurück, ein niederländischer Konquistador. Er ist um nichts besser als die Dons, die in die Neue Welt eingebrochen sind.“
„Wahrscheinlich hast du recht.“ Dan O’Flynn nickte. „Meinst du, daß er dich an die Portugiesen verrät?“
„Er will mich und uns auf seiner Seite haben. Wenn er endgültig weiß, daß wir nicht mitspielen, wird er nicht zögern und den Portugiesen sagen, wer wir sind. So lange wird eine Art Burgfrieden herrschen.“
„Schonzeit“, murmelte Dan O’Flynn, „wie das Wild, das ein guter Jäger nicht jagt, wenn es dabei ist, seinen Nachwuchs zu kriegen.“
Hasard lächelte. „Unser Nachwuchs ist das Ruderblatt. Morgen früh werde ich der portugiesischen Faktorei einen Besuch abstatten und um die Erlaubnis bitten, das Dock benutzen zu dürfen. Wer löst dich ab, Dan?“
„Gary“, erwiderte Dan O’Flynn. „Smoky hat die Wachen bereits eingeteilt.“
„In Ordnung. Paßt vor allem auf die ‚Zwarte Leeuw‘ auf. Auch unsere Seeseite muß unter Kontrolle bleiben.“ Hasard wandte sich zu Al Conroy um, dem Stückmeister der „Isabella“. „Sind die Drehbassen klar, Al?“
„Aye, aye, Sir, alles klar.“
„Danke, Al.“ Hasard blickte sich um. „Wo stecken denn meine beiden Bürschchen?“
Aus dem Großmars ertönte eine helle Stimme – Hasard junior:
„Hier oben, Sir!“
Und Philip junior meldete: „Mister Smoky hat uns als Ausguck Großmars eingeteilt, Sir.“
„Mit Spektiv“, erklärte Hasard junior. „Der dicke Kapitän, der vorhin das Maul so weit aufgerissen hat, sitzt in einer Achterdeckskammer seines Potts und würfelt mit drei anderen Kerlen. Ich kann genau in die Kammer sehen, Sir. Und sie saufen aus großen Humpen.“
Hasard lächelte verstohlen.
„Im Auge behalten“, befahl er.
„Aye, aye, Sir!“ riefen die beiden Bürschchen im Duett.
Noch hausten die Fremden in den ihnen zugewiesenen Quartieren an den westlichen Stadtmauern. Dort standen die Hütten der Chinesen oder die festen Häuser der Orang blanda. Da waren Pfahlbauten an den zahlreichen Nebenarmen des Tji Serang, der die Stadt mit drei breiten Armen durchfloß, und da waren Gebäude aus Stein oder Lehm. Das alles wucherte westwärts und ins Hinterland – Hölle und Paradies zugleich. Hölle durch den stinkenden Morast, durch den Modder verstopfter Nebenarme, die im Laufe der Zeiten zu Kloaken geworden waren. Paradies durch das kräftige Grün der Waringin- und Datibäume, das brennende Rot der Hibiskusblüten, die anmutigen Kokospalmen, das Zirpen der Zikaden, das Gurren von Tauben.
Schwankende Stege führten über die Arme und Rinnsale des Serang.
Carberry lehnte es ab, sie zu betreten. Mit sicherem Instinkt blieb er mehr am Ufer der Bantambai, wo die See weite Tangstreifen abgelagert hatte.
Dann steuerte er ein ziemliches Stück hinter der Faktorei einen Steinbau an, dessen Eingang Lampions verzierten. Aber nicht das Licht war es, das ihn anzog, sondern der Krach, der aus dem Bau drang.
Unverkennbar waren in diesem Krach helle Stimmen, girrende, kieksende Stimmen.
„Oho, oho“, sagte der Profos und hielt die Mannen zurück, „lauschet, ihr irischen Pilger, die ihr gelobt habt, der Sünde zu entsagen. Was höret ihr dort so lockend?“
Sam Roskill sagte: „Liebliche Stimmen weiblichen Geschlechts.“
„Packen wir’s an, Mister Brighton?“ fragte Carberry grinsend.
„Mir nach“, erwiderte Ben Brighton entschlossen.
Auf diese Weise gelangten die sechs Seewölfe an einen Ort, der zwar portugiesisch geführt wurde, aber eindeutig europäischen Zuschnitt hatte.
Dort zechten die Seefahrer spanischer, portugiesischer, französischer, dänischer und niederländischer Schiffe, die Bantam angelaufen hatten.
Sie zechten nicht nur.
Sogar ein paar weiße Ladys hatten sich nach Bantam verirrt. Sie wirkten merkwürdig fremd zwischen den zierlichen Chinesinnen, den anmutigen Grazien der Insel und den Sirenen des Orients. Und da lachte sogar ein bildhübsches Wesen aus Batutis Heimat.
Ja, lustig waren sie alle – lustig, sorglos, angeheitert.
Wie in europäischen Hafenkneipen gab es massive Tische, Bänke, Stühle und Hocker. Ein breiter Tresen, aus Stein gemauert, zog sich rechts des Raumes entlang. Öllampen und Kerzen brannten überall. Hinter dem Tresen hantierte ein dicker, schwitzender und kahlköpfiger Mann mit Bechern, Flaschen und Humpen. Ein schwarzes Bärtchen zierte seine Oberlippe, eine Narbe seine linke Wange, eine wüste Narbe, wie sie ein Säbelhieb hinterließ.
Am Ende des Tresens führte eine Holztreppe zu den oberen Gemächern, wie Sam Roskill mit sicherem Blick feststellte und den Profos darauf hinwies.
„Das hat Zeit“, brummte der Profos, „erst wird die Lage gepeilt.“
Das Peilen der „Lage“ ergab, daß ein Tisch an Backbord der Schenke, in der Ecke, unbesetzt war.
„Kurs hart Backbord“, bestimmte der Profos, während Ben Brighton den Tresen ansteuerte und auf spanisch einen Korb verlangte.
In diesen Korb, so verhandelte der Bootsmann und Erste Offizier der „Isabella“, versenkte der portugiesische Wirt sechs Flaschen, von denen zwei roten, zwei gelblichen und zwei nahezu weißen Inhalts waren. Dazu gehörten sechs Becher. Ben bezahlte großzügig mit einem Silberbarren, den der Glatzkopf verzückt unter dem Tresen verschwinden ließ.
„Auch Täubchen?“ fragte er Ben und küßte die Fingerspitzen seiner linken Hand, was andeuten sollte, daß diese Täubchen sehr lecker seien.
„Später“, sagte Ben Brighton etwas irritiert. Ihm ging das hier reichlich schnell, aber so war er nun einmal. Er brauchte immer erst einen Anlauf, um voll einsteigen zu können. Und seit er mit Philip Hasard Killigrew fuhr, hatte er stets die Führung des Schiffes übernommen, wenn der Seewolf „an Land schoß“.
Ben war bescheiden, zurückhaltend und ein Kaltblüter.
„Orientalisch?“ fragte der schnurrbärtige Glatzkopf. „Suleika ist ein Stern unter dem Baldachin des Bettes, den selbst Sultan Maulana Muhamad, auch Seda ning Rana genannt, als erlesenst bezeichnet hat.“ Und wieder küßte der Glatzkopf seine Fingerspitzen.
„Wer ist das denn?“ fragte Ben. „Ich meine, dieser Sultan.“
„Der Herrscher des Banten-Reiches“, sagte der Portugiese. Und hinter der vorgehaltenen Hand flüsterte er: „Sein Thron wackelt ein bißchen, Señor, aber was bedeutet das! Heute ist heute, nicht wahr?“
„Stimmt“, sagte Ben. „Und wer ist Suleika?“
Der Glatzkopf deutete mit der rechten Hand. Suleika saß auf dem Schoß eines dürren Menschen, der schwitzte, schielte und offenbar zuviel getrunken hatte. Er streichelte ständig die Tischkante, die er wohl für den Popo von Suleika hielt. Suleika selbst hatte nichts dagegen, daß ihr Popo verwechselt wurde. Sie warf Ben glutäugige Blicke zu.
„Hm“, meinte Ben, „mal sehen.“
Mit dem Korb marschierte er zu den fünf Männern der „Isabella“, die bereits Blickgefechte geführt hatten und erklärten, durstige Kehlen zu haben.
Sie köpften eine Flasche des weißen Inhalts, Ben schenkte ein, Carberry probierte und erklärte, in diesem Stoff seien mächtig gute Geister verborgen. Sie tranken mehrere Geister, und es war die Lady aus dem schwarzen Kontinent, die sich zu Batuti setzte und die Männerrunde sprengte.
Batuti war total weg.
Eine Chinesin eroberte im Sturm den blonden Stenmark.
Und als Ben sich entschloß, den künftigen Abend und die Nacht Suleika zu widmen, trampelten fünfzehn Kerle in die Kneipe, die Mienen hatten, als seien sie scharf darauf, die erste Geige zu spielen.
Nein, sie wollten die erste Geige spielen, und darum kriegte der Glatzkopf hinter dem Tresen als erster eine gewischt, aber er war hart im Nehmen, und der bullige Kerl, der die Bande anführte, langte noch einmal zu – mit einem Humpen. Der Glatzkopf sank auf einen Hocker und war vorerst nicht mehr da.
Der Bulle lehnte sich mit dem Rükken an den Tresen und betrachtete die Runde in der Kneipe. Er hatte eine niedrige Stirn, sehr eng zusammenstehende Augen, eine gebrochene Nase, zernarbte Lippen und ein Kinn, das Ed Carberry hätte gehören können. Das war aber auch die einzige Ähnlichkeit, denn Ed hatte keine verkrüppelten Ohren, und er sah auch nicht aus wie ein Urwaldaffe.
„Männer“, sagte Ed Carberry voller Fröhlichkeit und krempelte sich die Hemdsärmel hoch, „ich glaube, jetzt geht’s los.“
Zu diesem Zeitpunkt hatte der Bulle einem schlanken, schwarzhaarigen Mann, der gerade am Tresen vorbeiging, ein Bein gestellt. Der Mann stolperte, konnte sich aber fangen und wirbelte herum.
Der Bulle sagte: „Bist du ’n Don?“
Der schlanke Mann nickte irritiert. Sekunden später beförderte ihn ein Hieb zur Tür.
„Alle Dons und sonstigen Sardinenfresser raus!“ befahl der Bulle. „Hier stinkt’s sonst zu sehr.“
Carberry wollte schon vom Stuhl hoch, aber Ben bremste ihn.
„Abwarten!“ zischte er. „Wenn die Bude leer ist, können wir uns besser entfalten, Ed!“
Der Profos grinste und fletschte die Zähne.
Drei Kerle des Bullen schlenderten durch die Kneipe und stießen mit blitzschnellen Fußtritten Stühle und Hocker um, auf denen Spanier und Portugiesen saßen. Sie packten die Männer an den Kragen und beförderten sie Richtung Ausgang, unterstützt von den anderen Kerlen der Gruppe.
Das wickelte sich ziemlich schnell ab. Es dauerte knapp vier Minuten, da war die Kneipe fast leer. Da saßen noch drei Franzosen und einige Dänen – und die sechs Seewölfe.
Der Bulle trank inzwischen aus einem Humpen, deutete mit ihm zu dem Tisch mit den Franzosen und sagte: „Ihr dürft auch verschwinden.“
Einer der drei stand auf, zog ein Messer – und das war auch alles. Der Humpen flog ihm ins Gesicht, und schon waren vier Kerle über ihm. Sekunden später flog er wie ein Geschoß durch die Tür nach draußen, die einer geöffnet hatte. Die beiden anderen Franzosen verzogen sich freiwillig. Die Niederländer waren ihnen wohl zu ruppig.
Zu den Dänen sagte der Bulle: „Ihr dürft bleiben und zusehen.“
Die Grazien verschiedener Hautfarben hasteten die Treppe hoch, der Bulle beobachtete sie grinsend und ziemlich lüstern. Hinter ihm rappelte sich der Glatzkopf vom Hocker hoch, griff nach einer Flasche und schlug zu. Die Flasche zersplitterte auf dem Tresen, denn der Bulle war einen Schritt zur Seite getreten. Er mußte Augen im Hinterkopf haben. Vielleicht war es auch Instinkt.
Ansatzlos ruckte er herum, den rechten Arm ausgestreckt. Mit dem fegte er den Glatzkopf von den Füßen. Es war eine beachtliche Leistung. Der Glatzkopf sauste in ein Schapp am Anfang des Tresens. Dort schepperte und klirrte es.
Jetzt richteten sich alle Augen auf die sechs Seewölfe.
„Was seid ihr für welche?“ fragte der Bulle lässig.
„Fromme irische Pilger“, sagte Carberry.
„Verrückt, wie?“
„Nein, voller Demut, wie es sich für fromme irische Pilger gehört.“
Der Bulle grunzte. „Du spinnst wohl, Gevatter?“
„Kann sein, manchmal“, erwiderte Carberry, faltete die Pranken und drehte Däumchen. „Du lebst in Sünde, Bruder, weil du an diesem Ort Böses getan hast. Alles hier war friedlich, aber ihr habt diese heilige Stätte entweiht. Der Zorn des Allmächtigen wird euch treffen. Du solltest beten und in dich gehen, Bruder. Es steht geschrieben, daß man seine Feinde lieben solle.“
„Amen“, sagte Ben Brighton.
„Hosianna“, sagte Pete Ballie.
„Halleluja“, sagte Stenmark.
„Tuet Buße“, sagte Sam Roskill.
Und jetzt fehlte nur noch Batuti. Der sagte: „Gehet hin in Frieden.“
Eine Weile herrschte Stille. Dieser fünfzehnköpfige Schlägerhaufen wirkte ziemlich verdattert.
Dann sagte einer zu dem Bullen: „Die nehmen uns auf den Arm, Profos.“
Carberrys grauen Augen blitzten auf. Siehe da, ein Kollege! Aber was für einer! Der war weiß Gott keine Glanzleuchte für die Profosgilde. Das war einer von der tückischen und gemeinen Sorte, einer, der seinen Spaß daran hatte, andere zu piesacken, ein skrupelloser Raufbold und Menschenschinder.
In Edwin Carberry begann es zu gären.
„He, der Nigger da!“ sagte der Bulle. „Komm mal her und laß dich anfassen, ob du auch fest im Fleisch bist. So einen wie dich brauchen wir, um mit dir die Bilge und den Abtritt unserer Offiziere auszuwischen.“
Carberry fuhr wieder hoch, aber dieses Mal drückte ihn Batuti zurück.
„Das ist meine Sache, Profos“, sagte er leise und sehr sanft.
Die dunkle Gazelle brachte er zur Treppe, die Chinesin trippelte hinterher. Batuti wandte sich um und ging zu dem Bullen – ein Bild des Jammers, krummrückig, mit eingezogenem Kopf, hängenden Armen, ängstlich rollenden Augen.
„Nicht hauen, lieber weißer Mann“, sagte er und zitterte sogar.
Aber der Bulle haute doch, und sein Gesicht war dabei nichts weiter als gemein. Schwarze waren ja keine Menschen, sondern Putzlappen, gut genug, um die Abtritte von Offizieren auszuwischen.
Nur traf der Bulle nicht, und er hatte auch keine Zeit mehr, verdutzt zu sein, daß der Schwarze, der eben noch gewinselt hatte, plötzlich ein ganz anderer war.
Die Faust Batutis war schneller und schlug wie ein Blitz ein. Es war ein ungeheuerlicher Schlag, wie ihn der Bulle wohl noch nie in seinem gewalttätigen Leben empfangen hatte.
Er flog nahezu waagerecht am Tresen entlang, riß vier, fünf seiner Kerle von den Füßen, fegte zwei Stühle beiseite, stieß einen Tisch um und sauste zwischen zwei Stufen der Treppe, zwischen denen er eingeklemmt hängenblieb. Die ganze Treppe wackelte und ächzte.
Der Bulle ächzte nicht, denn er war bewußtlos. Und seine vierzehn Mann waren zu Salzsäulen erstarrt.
Situationen richtig zu erkennen, das hatten die Seewölfe in unzähligen harten Kämpfen gelernt, und sie nutzten die Gunst des Augenblicks.
Der Sturm brach los, ausgelöst von sechs entfesselten Seewölfen. Noch bevor sich die vierzehn Niederländer aus ihrer Erstarrung gelöst hatten, sanken zwölf auf die Holzdielen, und zwar jeweils paarweise, weil harte Fäuste ihre Köpfe gegeneinandergedonnert hatten. Das war eine erprobte Methode, wenn man es mit zu vielen Gegnern zu tun hatte. Außerdem hatten sie wie die Ölgötzen dagestanden und sich angeboten.