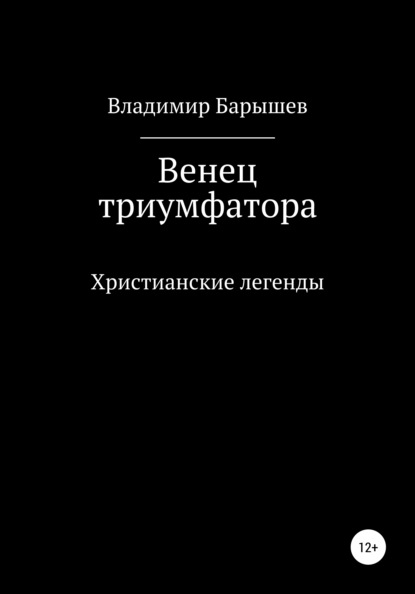Seewölfe Paket 11

- -
- 100%
- +
„Ich sehe mir das genauer an. Wartet hier auf mich.“
Der Schiffszimmermann nickte.
Hasard verlor keine Zeit. Ohne das leiseste Geräusch zu verursachen, pirschte er sich weiter voran. Unbehelligt legte er die nächsten zwanzig, fünfundzwanzig Yards zurück und fand hinter einem mächtigen Mangrovenstamm Deckung.
Das steinerne Gebäude war jetzt zum Greifen nahe vor ihm.
Er brauchte nicht zweimal hinzusehen. Er kannte genügend asiatische und auch ostasiatische Länder, um zu wissen, daß dies nur der Palast des Raja sein konnte. Das Wort Palast war zwar reichlich übertrieben, im Vergleich zu den Hütten aber angebracht.
Während Hasard beobachtete, glaubte er plötzlich, fernes Stimmengemurmel zu hören. Er hielt den Atem an. Möglich war auch, daß diese Stimmen aus dem Palast kamen. Zum Herumrätseln war keine Zeit. Er mußte der Sache auf den Grund gehen.
Lautlos schlich er weiter und bahnte sich jetzt vorsichtig seinen Weg durch das Unterholz, denn die rückwärtigen Fensterhöhlen des Palasts waren nur einen Steinwurf weit entfernt.
Je mehr er sich der jenseitigen Gebäudeecke näherte, desto deutlicher waren die Stimmen zu vernehmen. Und wenige Minuten darauf hatte Hasard Gewißheit.
Es waren Stimmen, die Portugiesisch sprachen!
Vorsichtig schob sich der Seewolf weiter, bis er die Seitenmauer des Palasts im Blickfeld hatte. Jetzt war er kaum noch überrascht, als er sie dort stehen sah.
Laurindo de Carvalho und seine Landsleute.
Der Einäugige stolzierte unruhig auf und ab und redete gestikulierend, während die anderen an der Mauer lehnten.
Hasard erblickte die Fensteröffnung knapp über dem Erdboden. Die Tatsache, daß einer der Portugiesen mit schußbereiter Muskete vor diesem Fenster stand, ließ keinen Zweifel offen. Dies mußte das Verlies sein, in dem Ed Carberry und die anderen gefangengehalten wurden. Immerhin schienen sie also noch am Leben zu sein.
Hasard atmete auf.
Von dem Gerede de Carvalhos kriegte er nur Wortfetzen mit. Was er heraushören konnte, war die Empörung des Portugiesen darüber, daß er von den Beratungen im Königspalast ausgeschlossen war.
Der Seewolf lächelte kalt. Also hatte der Kutscher mit seinen Mutmaßungen recht gehabt!
Hasard hielt sich nicht länger auf. Er wandte sich ab und kehrte ebenso geräuschlos wie zuvor zu seiner Gruppe zurück. Mit gedämpfter Stimme informierte er sie über seine Beobachtung. Die Augen der Männer leuchteten. Auf einen Wink des Seewolfs öffneten Al Conroy und Big Old Shane die Kisten.
Assistiert von den anderen, erledigte der Stückmeister seine Arbeit im Handumdrehen. Sie rammten Bambusstöcke in den weichen Boden und banden die Raketen in ihren Führungsrohren daran fest. Diese Mitbringsel aus dem Reich der Mitte richteten zwar keinen Schaden an, waren dafür aber in ihrer Wirkung bislang immer äußerst eindrucksvoll gewesen.
„Fertig!“ flüsterte Al Conroy schließlich. Die glimmende Lunte hielt er schon in der Hand.
Hasard zog seinen Radschloßdrehling und gab das Zeichen. Gemeinsam mit den anderen pirschte er los. Al Conroy blieb zurück, und deutlich war das Zischen der ersten Zündschnüre zu hören.
Das chinesische Feuer würde auch für Ben Brighton das vereinbarte Zeichen zum Angriff sein.
Der Feuerzauber begann, als sie die Rückseite des Königspalasts erreichten.
Fauchend zog die erste Rakete ihre Bahn bis hoch über das Dorf. Während die nächsten Raketen ebenfalls zischend aufstiegen, detonierte die erste mit einem Krachen, der an Kanonendonner erinnerte. Feurige Blitze zuckten über den Hütten auf, ein Funkenregen in allen schillernden Farben des Regenbogens schwebte langsam nieder.
Noch bevor dieser erste Funkenregen erloschen war, detonierte die zweite Rakete. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Ein ohrenbetäubendes Stakkato von Detonationen hallte über die Ansiedlung der Insulaner.
Entsetzensschreie wurden laut. Wie von allen Teufeln gehetzt, verließen die ersten Indonesier ihre Hütten und suchten mit Frauen und Kindern Zuflucht im nahen Dschungel.
Chaos setzte ein. Unter dem andauernden Krachen des chinesischen Feuers schwoll das panikartige Stimmengewirr an. Auch Flüche auf portugiesisch waren jetzt zu hören.
Al Conroy schloß mit langen Sätzen zur Gruppe des Seewolfs auf. Spätestens jetzt mußten Ben Brighton und die anderen vom jenseitigen Dorfrand vordringen. Auch die Gefangenen mußten jetzt begriffen haben, daß der Augenblick der Entscheidung da war.
Hasard und seine Männer erreichten die Palastecke, als die Portugiesen auszuschwärmen begannen.
Wie vom Donner gerührt, prallten sie zurück, als sie die Seewölfe erblickten.
Zwei der Portugiesen hatten den Riegel entfernt und waren im Begriff, die Tür zu öffnen. Verständlich, daß sie ihre Gefangenen in Sicherheit bringen wollten, denn diese Gefangenen bedeuteten letztlich noch immer das Faustpfand, dessen Gegenwert eine englische Galeone bester Bauart war.
Aber diese Rechnung würde Hasard ihnen gründlich durchkreuzen. Jetzt und auf der Stelle.
Laurindo de Carvalho, schon auf dem Weg zur Vorderseite des Palasts, wirbelte herum.
Die Seewölfe wichen zu breiter Front auseinander.
Und das Überraschungsmoment war auf ihrer Seite. Während die Portugiesen ihre Waffen noch hochrissen, krachten die ersten Warnschüsse. Ohne Ergebnis.
De Carvalho schrie einen gellenden Befehl und zog gleichzeitig seine Pistole aus dem Gurt.
Die Portugiesen gehorchten und ergaben sich nicht. Ihre Musketen und Pistolen flogen hoch.
Das Krachen des chinesischen Feuers verebbte.
Hasard, der eine erste Kugel als Warnschuß aus seinem Drehling abgefeuert hatte, stürmte voran, auf die Portugiesen zu, hakenschlagend.
Seine Männer hatten die Musketen fallen lassen und griffen zu den Pistolen. Reaktionsschnell warfen sie sich zu Boden.
Mündungsblitze zuckten dem Seewolf auf seinem rasanten Sturmlauf entgegen. Er spürte den Gluthauch einer Kugel, die haarscharf über ihn wegsirrte.
Breitbeinig stand de Carvalho da. Unter der Augenklappe war sein Gesicht zu einem teuflischen Grinsen verzerrt, als er den Seewolf herannahen sah. Für einen Sekundenbruchteil blickte Hasard in die großkalibrige Pistolenmündung. Der Zeigefinger des Einäugigen krümmte sich.
Weiter entfernt sah Hasard Ben Brighton und seine Männer herbeieilen. Hinter sich hörte er die Pistolenschüsse seiner Gruppe und das erste Klirren von Säbeln und Entermessern.
Eine feurige Lanze stieß aus der Pistole de Carvalhos.
Im selben Moment schnellte Hasard vor, überschlug sich knapp über dem Boden, rollte sich ab und war im nächsten Atemzug federnd auf den Beinen.
Donnernd entlud sich der Radschloßdrehling.
Ein Ausdruck grenzenlosen Entsetzens malte sich in de Carvalhos Gesichtszügen. Langsam, unendlich langsam sank er in sich zusammen, die Pistole entfiel seinen kraftlos werdenden Fingern.
Hasard wirbelte herum. Mit dem Einäugigen konnte er kein Mitleid empfinden. Nicht nach allem, was geschehen war.
Er ließ die Waffe sinken. Seine Männer hatten bereits für klare Verhältnisse gesorgt.
Drei, nein vier Portugiesen waren es, die mit langen Sätzen ihr Heil in der Flucht suchten. Die anderen lagen reglos am Boden. Von ihnen war keine Gegenwehr mehr zu erwarten. Sie hatten de Carvalho und seinen hinterhältigen Plänen zur Seite gestanden und dafür ihr Leben gelassen.
Aus dem Verlies erschienen die Gefangenen mit klirrenden Ketten. Ihre Gesichter strahlten, freudiges Gebrüll zur Begrüßung wurde laut.
Ferris Tucker begann sofort mit der Arbeit und benutzte die stumpfe Seite einer Axt, um die Splinte loszuschlagen, mit denen die stählernen Ringe der Ketten gesichert waren.
Aus dem Dorf gellten noch immer die Schreie der Indonesier. Mit einem Blick über den Vorplatz des Palastes stellte Hasard fest, daß von den Inselbewohnern keine Gefahr drohte. Nachdem sie bereits durch den Vulkanausbruch einen Schock erlitten hatten, waren sie jetzt endgültig in Panik geraten.
Dies bestätigte auch Ben Brighton, der mit seiner Gruppe beim Palast eintraf. Niemand hatte sich ihnen in den Weg gestellt. Als das Krachen des chinesischen Feuers begonnen hatte, waren die Indonesier in heillosem Entsetzen geflohen.
Es dauerte nur wenige Minuten, bis Ferris Tucker die Männer von ihren Ketten befreit hatte. Dann fielen sie sich alle vor Freude in die Arme. Aus dem Gewühl heraus tauchte der Profos vor Hasard auf.
Hasard lachte und schlug ihm wortlos auf die Schulter.
Edwin Carberry öffnete den Mund und wollte etwas sagen, brachte aber kein Wort hervor. Im nächsten Moment wandte er sich rasch ab. Seine Augen waren feucht geworden, und so etwas sollte niemand beim Profos der „Isabella“ jemals sehen – auch der Seewolf nicht.
Hasard rief zum Sammeln. Bis auf einige unbedeutende Kratzer hatten seine Männer keinen Schaden gelitten.
Eilends durchsuchten sie den Palast des Raja. Die Vermutung des Seewolfs bestätigte sich sehr rasch. Keine Menschenseele hielt sich mehr in dem feuchten Gemäuer auf. Wie die übrigen Dorfbewohner waren auch der Raja und sein Gefolge geflohen.
Sie spürten es, als sie aus dem Palast ins Freie traten und zum Abmarsch rüsteten.
Der Boden unter ihren Füßen begann zu vibrieren.
„Weg hier“, sagte Hasard knapp und übernahm die Führung.
Im Eilschritt durchquerten sie das Dorf über jenen Hauptweg, von dem sie wußten, daß er zur Westseite der Insel führte.
Der Boden schien jetzt zu schwanken, ein tiefes, noch verhaltenes Grollen war zu hören. Es schien tief aus dem Inneren der Erde zu dringen, war doch überall und umgab die Männer mit bedrohlich anschwellender Lautstärke.
Sie begannen zu laufen, als sie den Tropenwald erreicht hatten. Auf ihrem Weg durch das stickige Dickicht wurde die Luft unerträglich. Ein beklemmender Druck legte sich auf die Atemwege.
Keuchend drangen sie bis zu der plateau-ähnlichen Anhöhe vor, wo sie einen Moment verharrten.
Jäh gab es einen Donnerschlag, der alles auszulöschen schien. Die Insel bebte, und der Donner wollte nicht enden.
„Da!“ schrie Dan O’Flynn. „Seht!“
Ihre Köpfe ruckten herum.
Feurige Lohe stieß aus dem Krater des Vulkans, bis hoch in den Himmel hinauf. Eine finstere Rauchwolke begleitete diese Lohe, breitete sich rasend schnell aus und verdüsterte das Sonnenlicht.
„Weiter!“ rief der Seewolf. „Beeilt euch!“
Das Atmen fiel ihnen immer schwerer, als sie durch den Palmenwald stürmten. Ein schwefliger Geruch lag jetzt in der Luft.
Wieder folgte ein urwelthafter Donnerschlag. Der Erdboden erzitterte heftiger als zuvor.
Die Männer von der „Isabella“ blickten nicht mehr zurück. Als sie mit schmerzenden Lungen den Strand erreichten, herrschte fast völlige Finsternis.
Ein Donnerschlag folgte jetzt dem anderen, und ein kurzer Blick zum Vulkan zeigte ihnen das Ausmaß der Naturkatastrophe.
Aus dem Krater wälzte sich ein breiter Strom glühender Lava, hatte bereits den Fuß des Vulkankegels erreicht und fraß sich weiter in die grüne Vegetation vor. Weißliche Dämpfe stiegen auf, aus dem Krater zuckten in kurzen Abständen feurige Strahlen bis hoch in den verdüsterten Himmel.
Böen kamen plötzlich auf und orgelten über die Palmen, deren Stämme sich ächzend bogen.
In fliegender Hast erreichten die Männer das Beiboot und die große Jolle. Mit vereinten Kräften brachten sie die Boote zu Wasser, dann pullten sie mit peitschenden Schlägen. Wenigstens war die Luft über dem Wasser etwas klarer, und die Schmerzen in ihren Atemwegen ließen nach.
Der Vulkan brüllte wie ein gigantisches Tier aus Urzeiten. Die Böen wehten den Gluthauch der Lava herüber, deren todbringende Masse sich zähflüssig und unaufhaltsam nach allen Seiten über die Insel fraß.
Keuchend erreichten die Männer das Schiff. Die helfenden Hände der an Bord Zurückgebliebenen waren sofort zur Stelle, um die Boote hochzuhieven. Minuten später waren alle Mann an Deck, um den Anker zu lichten und die Segel zu setzen.
Der Wind stand günstig. Unter Vollzeug nahm die „Isabella“ rasch Fahrt auf.
Hasard ließ auf Nordwestkurs gehen. Dann legte er die Arme um die Schultern seiner Söhne, die sich zu ihm auf das Achterkastell geflüchtet hatten.
Die Insel bestand nur noch aus glühender Lava. Unablässig spie der Vulkan Feuer und Rauch und schleuderte glühende Brocken aus seinem Krater fast eine Meile weit, als wollte er die Galeone jetzt noch vernichten. Doch die Lavabrocken versanken zischend in der See wie schlecht gezielte feurige Kanonenkugeln, die keinen Schaden mehr anrichteten.
Erst jetzt sahen die Seewölfe den großen Pulk von Auslegerbooten, die von der Südostseite der Insel her der offenen See entgegenstrebten.
Die Menschen von Seribu hatten rechtzeitig fliehen können. Auf dem nahen Java würden sie unter fremder Herrschaft leben müssen. Aber sie lebten. Das allein zählte.
Erst in diesem Moment wurde dem Seewolf bewußt, daß Al Conroys chinesisches Feuer den Inselbewohnern das Leben gerettet hatte. Wären sie durch die Detonationen nicht aufgescheucht worden, hätte der Vulkanausbruch sie wahrscheinlich überrascht.
Philip Hasard Killigrew strich seinen Söhnen sanft über das Haar. Der Wind sang in Wanten und Pardunen, und die Stille auf der „Isabella“ trug einen Hauch von Frieden in sich.
Bald schmolz die Insel Seribu über der Kimm zu einem glühenden Punkt zusammen …

1.
Der polierte Spitzhelm und der Brustpanzer des spanischen Soldaten schimmerten nur noch für eine Weile im silbrigen Mondlicht, dann aber wurde auch dieser matte Glanz wie alle anderen optischen Wahrnehmungen ausgelöscht, denn der Wind, der zunehmend kräftig von der See in den Dschungel von Sumatra hinüberblies, schob Wolken vor die weiße Sichel und hüllte das Lager und die Festung von Airdikit mit tiefster Finsternis ein.
Der Soldat hatte seine Inspektionsrunde im Inneren der Palisaden beendet und wandte sich zum Gehen. Morgan Young hörte, wie sich das Knirschen seiner Schritte auf dem sandigen Untergrund entfernte und der Mann sich zwischen den Sträflingen hindurch zum Tor bewegte.
Knarrend öffnete sich das Tor in seinen eisernen Angeln, wenig später schloß es der Wachtposten von außen und schob den eisernen Riegel vor.
Die Gefangenen waren wieder allein mit ihrem Schweigen und ihrer Verzweiflung, mit den dumpfen, bohrenden Fragen und den Ängsten, die die Dunkelheit und die unheimlichen Laute des Urwaldes immer wieder hervorriefen. Viele der gut vier Dutzend Spanier, Portugiesen, Engländer, Holländer und Franzosen, die hier festgekettet waren, fielen bald in einen Erschöpfungsschlaf, aber viele blieben auch wach, weil ihnen die Ausweglosigkeit ihres Schicksals zusetzte und an ihren Nerven zehrte.
Niemand glaubte ernsthaft, daß ein Ausbruch aus den Palisaden und eine anschließende Flucht durch den Dschungel jemals gelingen konnten – niemand außer dem Engländer Morgan Young und Romero, dem jungen Spanier.
Das Vorhaben allein mußte wie die reinste Ausgeburt des Wahnsinns erscheinen, aber die Chance war eben doch plötzlich da, und Morgan Young klammerte sich genau wie Romero mit jener Verbissenheit daran, die nur die Verzweiflung hervorzubringen vermochte.
Sie wußten, daß nach Ablauf von einer Stunde – oder von zwei Glasen, wie man auf See sagen würde – die Wachablösung erschien und erneut einen Kontrollgang durch das Innere der Palisaden unternahm. Das ging die ganze Nacht über so, und ebenso, wie die Sträflinge hier in der Umzäunung scharf im Auge behalten wurden, überprüft man auch jene Gefangenen, die bereits im Kerker des Festungsneubaus eingesperrt worden waren.
Somit war Airdikit zu einem ausbruchsicheren Sträflingslager geworden. Keinem war es bislang geglückt zu entweichen. Don Felix Maria Samaniego verwendete sein ganzes Können und seine Sorgfalt als Lagerkommandant darauf, daß es dabei auch blieb.
Dennoch: In dieser Nacht sollte es geschehen, in der nächsten Stunde bis zur Wachablösung sogar. Das Heulen des Windes nahm zu, und auch das Konzert der Urwaldfauna schien anzuschwellen – eine willkommene Geräuschkulisse, die andere Laute überdecken würde.
Morgan Young wandte den Kopf.
Romero, der junge Spanier, saß rechts von ihm, an einen in den Boden gerammten Pfahl gefesselt wie auch er, Young, und alle anderen Gefangenen. Young konnte seine Gestalt in dieser Finsternis kaum noch sehen, aber er wußte, daß auch Romero zu ihm blickte.
„Jetzt“, flüsterte er ihm zu. „Fangen wir an.“
„Ja“, raunte Romero. „Versuchen wir es. Eine bessere Gelegenheit kriegen wir nicht.“ Er sprach ein relativ gutes, jedoch stark akzenthaltiges Englisch. Das hatte er in den fast anderthalb Jahren, die er hier schon festsaß, von den englischen Mitgefangenen gelernt.
Romero war Decksmann auf einer spanischen Galeone gewesen, die zweimal im Jahr von Cadiz nach Manila und zurück segelte. Kurz vor den Philippinen hatte er sich auf seiner letzten Fahrt gegen einen ruppigen Bootsmann aufgelehnt, der einen Kameraden zu Unrecht gemaßregelt und dann vom Profos hatte auspeitschen lassen. Romero wäre dem Bootsmann an den Hals gesprungen, wenn ihn seine Freunde nicht zurückgehalten hätten. Ein rasch zusammengerufenes Bordgericht hatte den Aufsässigen wegen Insubordination und versuchter Meuterei zur Höchststrafe verurteilt: Zwangsarbeit in einem spanischen Gefängnislager. Von Manila aus hatte man ihn direkt nach Airdikit im südlichen Sumatra verfrachtet.
„Du kannst noch froh sein, daß dein Kapitän dich nicht gleich an der Rahnock aufgehängt hat“, hatte Morgan Young gesagt, als er diese Geschichte von Romero vernommen hatte. „Dann wäre dir nämlich der Anblick dieses wunderschönen Fleckchens Erde hier entgangen, mein Freund.“
Romero hatte darüber gelacht, und auch Young hatte gegrinst. Der Aufseher hatte ihnen die Peitsche über den Rücken gezogen, aber das hatte sie beide wenig beeindruckt. Oder, anders ausgedrückt: Auf diese höchst schmerzhafte Weise war ihre neue Freundschaft zumindest handfest besiegelt worden.
Morgan Young nahm es dem jungen Mann, der höchstens zweiundzwanzig, dreiundzwanzig Jahre alt sein konnte, wahrhaftig ab, daß er kein richtiger Verbrecher war. In eine solche Situation an Deck, die dann zu drakonischen Strafen führte, konnte jeder anständige Seemann hineinschlittern, wenn er es mit einem unfairen Bootsmann oder Zuchtmeister zu tun hatte.
Young seinerseits war auch kein Mörder, Meuterer oder Plünderer, sondern er war wegen eines Schiffsbruchs in die Hände der Spanier geraten.
So war es seiner Ansicht nach nur legitim, wenn alle, die in Wirklichkeit gar nichts auf dem Kerbholz hatten, den Ausbruch aus dem Arbeitslager versuchten.
Nicht alle waren dazu bereit, bei diesem Höllenunternehmen ihr Leben zu riskieren und so hoch zu setzen, wie es nötig war. Morgan Young hatte also eine Auslese getroffen und wußte, auf wen er zählen konnte. Da waren seine Kameraden von der „Balcutha“ – mit ihm die einzigen Überlebenden des Schiffsunglücks –, also Tench, Josh Bonart, Sullivan und Christians. Kerle, die Kopf und Kragen aufs Spiel setzten, um nur hier herauszukommen. Weiter Jonny, auch ein Engländer, über dessen Herkunft aber nichts Näheres bekannt war, dessen „glorreiche Zehn“, eine Crew, wie sie wilder und bunter nicht zusammengewürfelt hätte sein können, sowie letztlich ein paar Holländer und Franzosen, die lieber im Kampf starben, als auch nur einen Tag länger unter der erbarmungslosen Hitze und Feuchtigkeit der Äquatorzone im moskitoverseuchten Dschungel zu schuften.
Romero fiel sozusagen die Schlüsselposition bei dem geplanten Ausbruch zu – und Young war derjenige, der voll und ganz seinen Fähigkeiten vertraute, während alle anderen ihre gelinden Zweifel daran hatten.
Aber hatte Romero nicht schon bewiesen, daß er über eine überdurchschnittliche Fingerfertigkeit verfügte. Wer außer ihm hätte wohl an diesem Nachmittag oben auf der Baustelle des Kastells unter der scharfen Aufsicht der Posten einen Schlegel und ein Scharfeisen entwenden können? Wäre denn jemand anderes in der Lage gewesen, diese beiden Werkzeuge so geschickt unter der Hose zu verbergen, daß auch nachträglich niemand den Diebstahl aufzudekken vermochte?
Nein. Nicht einmal Young, der sich auch schon einiges zutraute, oder Jonny, der ein tolldreister Draufgänger und Abenteurer zu sein schien, hätten etwas Vergleichbares vollbracht. Romero beherrschte richtige Taschenspielertricks, er war ein Meister im Jonglieren mit Gegenständen und konnte sie blitzschnell verschwinden lassen.
Den kleinen Hammer und das Scharfeisen hatte er vermittels dünner, jedoch sehr haltbarer Fäden, die er schon Tage zuvor vorbereitet hatte, an seinem Gürtel festgebunden und dann an der Innenseite seiner Hose herabbaumeln lassen.
Jetzt holte er die Geräte zum Vorschein und begann sein schwieriges, langwieriges Werk.
Allen Gefangenen waren die Hände auf dem Rücken zusammengekettet, wenn sie nicht zur Arbeitsschicht auf die Festung mußten, und diese Handfesseln waren wiederum durch eine Kette mit dem Pfahl verbunden, der für jeden Sträfling in den Boden innerhalb der Palisaden gerammt worden war. Die Beine wurden durch Schäkel zusammengehalten, an denen als Gewichte schwere eiserne Kugeln befestigt waren.
Wir können froh sein, daß sie uns nicht auch noch Halseisen verpaßt und uns damit an diese verdammten Pflöcke gehängt haben, dachte Young, als er sich jetzt auf die linke Körperseite legte und so nah wie möglich an Romero heranrückte.
Sie hatten verschiedene Pläne gewälzt und auch in Erwägung gezogen, die Flucht tagsüber zu versuchen. Doch dieses Vorhaben hatten sie gleich wieder verworfen. Wenn sie während der Arbeit an der zu errichtenden Festung auch die Hände frei hatten, die Zahl der schwerbewaffneten Wächter war doch zu groß, um einem derartigen Unternehmen auch nur die geringsten Erfolgschancen einzuräumen.
Blieb nur die Nacht, und zwar mußte es diese zunehmend stürmische Nacht sein, in der sie den Ausbruch durchführen. Ihre Wächter hatten ihnen bereits in Aussicht gestellt, daß auch die Gefangenen hier in den nächsten Tagen zu den Sträflingen in den Festungskerker gepfercht würden, dessen letzte Räume kurz vor der Vollendung standen. Wenige Wachtposten genügten, um den einzigen Ausgang des Kellergewölbes ständig ausreichend zu bewachen, und jeder Mann, der das Kunststück fertigbrachte, sich von seinen Ketten zu befreien und die Eisengitter zu öffnen, die ihn vor der Freiheit trennten, wurde spätestens dort erschossen.
Dort oben, im Kerker des Kastells, ist unser aller Schicksal endgültig besiegelt, sagte sich Morgan Young im stillen. Er drehte sich so, daß seine Beine sich denen von Romero näherten. Der junge Spanier hatte sich ebenfalls auf die Körperflanke sinken lassen. Sie lagen in stark verkrümmter Haltung Rücken an Rükken da, wobei die Verbindungsketten, die ihre eisernen Handfesseln an den Pfählen festhielten, sich strafften und an ihren Gelenken zu zerren begannen.
Romero konnte weder seine eigenen Handschellen noch seine Beinschäkel lösen. Aber er konnte dank seiner großen Fingerfertigkeit die Spitze des Scharfeisens in die Zwischenräume von Morgan Youngs Fußeisen zwängen und mit dem Schlegel auf das obere, stumpfe Ende des Werkzeugs hauen.
Die Schlaggeräusche wurden vom Jaulen und Heulen des Windes und dem Kreischen der Nachtvögel geschluckt, doch immer wieder hielt Romero inne, um zu lauschen. Hatten die Posten, die außerhalb der Palisade auf und ab patrouillierten, wirklich noch nichts gehört? Der junge Spanier arbeitete in der beständigen Furcht, entdeckt zu werden.
Morgan Young hielt immer wieder den Atem an, ballte die Hände zu Fäusten und schickte stumme Stoßgebete zum Himmel: Herr, laß es uns schaffen, gib, daß wir Erfolg haben und diesen gräßlichen Ort verlassen können.
„Morgan“, wisperte plötzlich eine Stimme. „Morgan Young!“
Young fuhr unwillkürlich zusammen, aber dann begriff er, daß es Jonnys Stimme war.
„Was ist?“ fragte er ebenso leise zurück. „Gefahr im Verzug?“