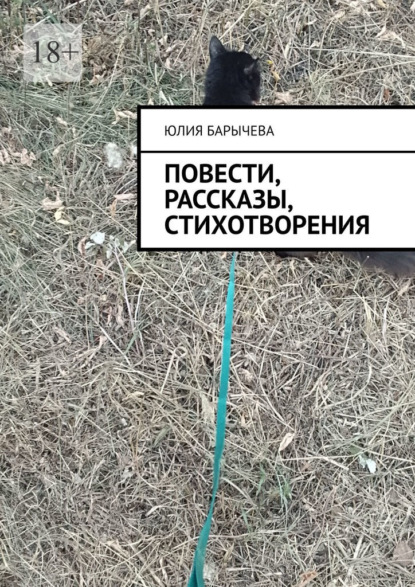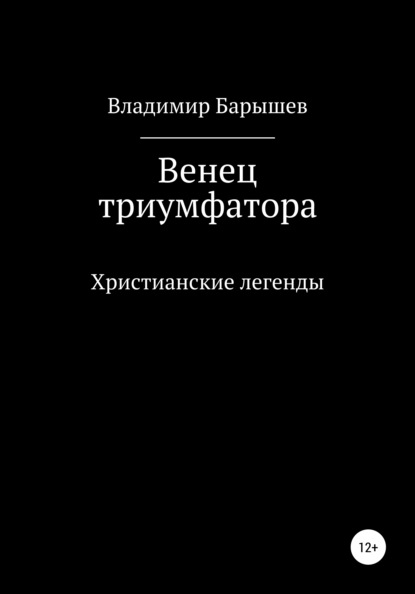Seewölfe Paket 11

- -
- 100%
- +
Bei diesem Wind konnten Ben Brighton und die anderen an Bord der „Isabella“ das Wummern eines Siebzehnpfünders vielleicht gerade noch vernehmen. Was sie vorher garantiert nicht gehört hatten, war das Krachen der Musketen und Tromblons, der Falkons und Minions im Lager der Spanier gewesen. Der auflandige Wind trug all diese Laute in den Dschungel. Daher konnte Ben, der jetzt das Kommando auf der „Isabella VIII.“ hatte, nicht wissen, was geschehen war.
Der Seewolf hatte von Morgan Young erfahren, daß auf dem Festungsbau von Airdikit Culverinen standen. Deshalb hatte er Ben in gleichsam weiser Voraussicht gesagt, er würde eine dieser Kanonen zünden, wenn etwas schiefginge.
Die Glut der Zündschnur sprang auf das Pulver im Zündkanal des Geschützes über.
„Also dann“, sagte der Profos grimmig. „Dies ist ein Salut für dich, Don Felix, du Hundesohn, mit dem ich dich zur Hölle wünsche – und wenn ich mir selbst dabei den Arsch verbrenne.“
4.
Ranon, der Inder, kehrte auf die Kuhl der „Malipur“ zurück und wählte zwei Männer als seine Helfer aus: Calderazzo, den Sizilianer, der mit zu den drei „Altgedienten“ an Bord der Galeone zählte, und Shindaman, einen Bengalen, den René Joslin erst zu Beginn dieser Überfahrt in einem der Dörfer von Sunderbunds angeheuert hatte.
Zu dritt stiegen sie in den achteren Laderaum hinunter. Hier war der Wassereinbruch größer als in dem zweiten Frachtraum, und aus diesem Grund begannen sie hier, zwischen Ballen von Stoffen und Kisten und Fässern mit Gewürzen, die Lenzpumpen einzusetzen.
Bis über ihre Fußknöchel reichte das Wasser jetzt schon, und sie hatten die allergrößte Mühe, die Pumpen überhaupt in Gang zu bringen, denn die Schwankungen des Schiffes waren tief im Rumpf nicht weniger stark als an Oberdeck.
Immer wieder glitten die drei Männer aus und landeten in der hin und her schwappenden Flüssigkeit. Es war so dunkel, daß sie kaum etwas von ihrer näheren Umgebung zu erkennen vermochten, mehrfach gerieten sie sich gegenseitig ins Gehege.
Calderazzo prallte mit Shindaman zusammen, als er wieder einmal ausrutschte. Der Bengale stieß sich den Hinterkopf an einem der gut verpackten Fässer und stöhnte vor Schmerz auf. Der Sizilianer begann wild zu fluchen.
„So schaffen wir es nicht!“ brüllte er zwischen zwei lästerlichen Verwünschungen. „Das weiß auch der Capitaine, das muß er zumindest einsehen! Wir brauchen Verstärkung, um das verdammte Wasser aus dem Bauch des Kahns rauszukriegen!“
„Wenn wir uns mit den Rücken gegen die Tuchballen stemmen, haben wir einen besseren Halt!“ schrie Ranon ihm im Toben des Seewassers an den Bordwänden zu. „Oder aber wir binden uns fest!“
„Damit wir hier unten jämmerlich ersaufen?“ rief Calderazzo. „Wenn die morschen Planken der Wegerung nachgeben, ist hier der Teufel los, das ist doch klar! Dann haben wir nicht einmal mehr Zeit, uns loszuknüpfen!“
Ranon bückte sich nach der einen Pumpe, die umgekippt im zischenden und gurgelnden Naß lag, richtete sie wieder auf und zerrte sie weiter nach vorn in den Mittelgang, der beim Stauen der Ladung zwischen den Packen geblieben war, um den Zugang zum vorderen Frachtraum zu ermöglichen.
Er lehnte sich mit dem Rücken gegen die Tuchballen und spreizte die Beine ab. In dieser Haltung vermochte er gegen den Seegang anzukämpfen, die Schiffsbewegungen konnten ihn jetzt nicht mehr aus der Balance bringen.
Allein mühte er sich mit der Pumpe ab, aber all seine Anstrengungen brachten keinen großen Erfolg.
Calderazzo eilte ihm schimpfend zu Hilfe, und zu zweit konnten sie den Pumpenschwengel nun schon schneller hochhieven und wieder hinunterdrükken.
Auch der Bengale hatte sich inzwischen wieder aufgerappelt. Er rieb sich den Kopf und stöhnte auch noch, doch auch er trug seinen Teil zu der Aktion bei, indem er das Rohr richtete, das durch eine Öffnung in der Decke bis nach oben auf die Kuhl führte und dort das Leckwasser ausspuckte. Das Wasser rann mit den Fluten, die immer wieder von außen her über das Oberdeck rauschten, durch die Speigatten ab.
So arbeiteten sie gut eine halbe Stunde lang hart und verbissen. Der Schweiß lief ihnen über ihre nackten Oberkörper und über die Gesichter, und Calderazzo hörte nicht auf, ihre Tätigkeit durch sein Fluchen zu begleiten.
Schließlich rief er: „Es hat keinen Zweck! Merkt ihr nicht, daß das Wasser steigt?“
„Wir müßten auch die zweite Pumpe einsetzen!“ schrie Ranon.
„Der Henker weiß, wo die abgeblieben ist!“ brüllte der Sizilianer.
„Shindaman!“ rief der Inder dem Bengalen zu. „Übernimm du meinen Platz, und pumpt zu zweit weiter! Ich suche nach den größten Lecks und sehe zu, sie zu stopfen!“
„Das ist Wahnsinn!“ ließ sich Calderazzo vernehmen. „Du säufst dabei ab, sage ich!“
„Laß es mich wenigstens probieren!“
Ranon überließ seinen Platz dem Bengalen, stolperte zur anderen Seite des schmalen Ganges und prallte hier gegen die Ballen. Er suchte mit den Händen nach einem Halt, fand ihn jedoch nicht und sank deshalb bei der nächsten Schlingerbewegung der „Malipur“ zu Boden. Die Galeone hob ihren Bug an, um sich eine anrollende Woge hinaufzuschieben, und Ranon rutschte auf den nassen Planken ein Stück nach achtern.
Er stieß sich die Schulter an einem harten Gegenstand, der im Leckwasser lag, und unterdrückte nur mit Mühe einen Schrei.
Das Wasser sammelte sich im achteren Bereich des Laderaums und stieg derart an, daß es dem Inder schon bis zu den Hüften reichte, als er sich jetzt wieder erhob.
Ranon stellte fest, daß er sich die Schulter an der zweiten Lenzpumpe aufgeschrammt hatte. Bevor sie ihm jetzt auch noch über die nackten Füße rollen konnte, brachte er sich aus ihrer Nähe und watete durch das schwappende Wasser zur Backbordseite, wo sich seines Wissens eins der kritischen Lecks befand.
Er entdeckte es und erschrak, als er feststellte, daß er bereits seinen Finger in die entstandene Öffnung schieben konnte. Das Leck hatte sich unter dem Druck der Wassermassen bedenklich erweitert. Er mußte es abdichten, so schnell er konnte.
So wankte er ein Stück zurück zur Mitte des Schiffsraums, löste ein Stück Persenning von einer der Kisten und zerrte es zu dem Leck. Hier kniete er sich in eine Wasserpfütze, ehe das nächste Stampfen der Galeone ihn wieder umwerfen konnte, und begann, das gewachste und geteerte Segeltuch Stück für Stück in die Spalte zu stopfen, die zwischen zwei Planken klaffte. Es gelang ihm, dies mit seinen bloßen Fingern zu bewerkstelligen. Aber er wußte, daß es nicht genügte. Er brauchte einen Hammer, Nägel und Planken, um seine Arbeit zu vervollständigen, sonst würde sie innerhalb der nächsten Minuten allein durch den Wasserdruck wieder beseitigt werden.
„Ich gehe in die Zimmermannswerkstatt!“ schrie er seinen beiden Kameraden zu. „Ich brauche ein paar Hilfsmittel!“
„Sag dem Kapitän Bescheid!“ rief der Sizilianer.
„Das ist nicht nötig!“
„Doch! Er soll sich die Schweinerei hier unten ansehen!“ brüllte Calderazzo.
Ranon hörte nicht auf ihn, sondern wandte ihm und dem Bengalen den Rücken zu und enterte auf dem Weg durch den nächsten Niedergang in das nächsthöhere Deck auf. Rasch hatte er sich Zugang zur Werkstatt des Schiffszimmermanns verschafft. Er mußte eine Weile herumtasten, bis er das Nötige gefunden hatte, aber bald hatte er alles zusammen und kehrte stolpernd und vor sich hin wetternd in den Frachtraum zurück.
Hier nagelte er zwei Planken über das mit der Persenning zugepfropfte Leck, kroch weiter und suchte nach dem nächsten Leck.
Plötzlich stießen Calderazzo und Shindaman einen Schrei aus.
„Hierher!“ brüllte der Sizilianer gleich darauf gegen das Donnern und Tosen des Sturmes an. „Ranon, hier ist ein neuer Wassereinbruch! Hölle, es sprudelt nur so herein! Teufel, wo steckst du denn bloß?“
„Hier!“ schrie der Inder.
Er preßte nur noch eine Planke auf das zweite Leck, das er gefunden hatte, und hämmerte sie mit drei, vier Nägeln fest. Dann richtete er sich auf und eilte zu seinen Kameraden, die immer noch mit aller Kraft an der Pumpe arbeiteten.
Er spürte das Wasser an seinen Knien und hörte es durch den Frachtraum schießen. Seine Verzweiflung war wieder da. Er sah ein, daß der Sizilianer recht hatte mit seinen Warnungen und Prophezeiungen.
Ranon rutschte wieder aus und stürzte neben dem Bengalen auf die Planken, aber genauso schnell hatte er sich auch wieder aufgerappelt und torkelte durch das einströmende, sprudelnde Wasser bis zu der Stelle im Holzkleid des Schiffes, an der es einbrach.
Seine Finger vermochten den gewaltigen Guß nicht aufzuhalten, er konnte kaum das Loch finden, durch das der Schwall eindrang. Seine Verzweiflung schlug jetzt in Panik um.
„Helft mir!“ schrie er. „Ich kann es allein nicht schaffen!“
Calderazzo und Shindaman ließen von der Lenzpumpe ab und wateten zu ihm.
„Sieh dir das an!“ brüllte der Sizilianer dem Bengalen zu. „Das ist unser aller Untergang! Madonna Santa, diesmal stehen wir es nicht durch! Ich habe dem Alten schon ein paarmal gesagt, der Kahn ist zu morsch und zu brüchig für solche Fahrten geworden, aber er will es ja nicht einsehen!“
„Hör auf!“ rief Ranon. „Reich mir lieber eine von den Planken herauf! Ich habe sie hier irgendwo verloren, du mußt sie finden!“
Fluchend suchte Calderazzo mit seinen Fingern im Wasser herum.
„Shindaman!“ schrie der Inder. „Besorg mir ein Stück Persenning! Na los, reiß sie einfach von einem Ballen Tuch herunter!“
„Der Alte wird sich freuen!“ meinte der Sizilianer.
„Ist mir egal, was er denkt!“
Ranon glaubte, das Leck in der Bordwand gefunden zu haben. Er drückte mit seinen beiden Händen gegen den Wasserstrom an und konnte sich unter erheblichem Kraftaufwand dagegen behaupten. Schließlich preßte er seine linke Faust in das Loch, so daß das Salzwasser jetzt nur noch in dünnen Spritzern eindrang.
„Schnell!“ brüllte er. „Lange halte ich das nicht durch!“
Shindaman hatte einen der Ballen geöffnet, schnitt die Persenning, die irgendwo festsaß, mit seinem Messer durch und balancierte damit durch den schwankenden Raum zu Ranon hinüber.
„Die Planke!“ schrie Calderazzo in diesem Augenblick. „Ich hab sie gefunden! Wo sind der Hammer und die Nägel?“
„Der Hammer steckt in meinem Gürtel!“ rief der Inder ihm zu. „Die Nägel sind in meiner Hosentasche!“
„Dann los!“
„Shindaman!“ schrie Ranon.
Der Bengale hob das wasserdichte Segeltuch ein Stück höher und legte es um Ranons linke Faust. Ranon nickte dem Kameraden zu, riß die Faust weg, und Shindaman schob die Persenning blitzschnell in das Loch.
Ranon zog den Hammer aus dem Gurt und holte die Nägel aus der Tasche. Calderazzo war mit der Planke zur Hand. Shindaman stopfte die Persenning soweit wie möglich in das Leck, dann zog er seine Hände zurück. Der Sizilianer preßte die Planke gegen die Bordwand – gerade noch rechtzeitig genug, ehe der Wasserdruck ihm den geballten Fetzen Tuch ins Gesicht spie.
Der Bengale und der Sizilianer hielten die Planke fest, und Ranon trieb die Nägel hinein. Calderazzo konnte jetzt loslassen. Er bückte sich und forschte in fieberndem Eifer nach einer weiteren Planke. Er fand eine, hob sie hoch und knallte sie unter die erste, und wieder war Ranon mit Hammer und Nagel zur Stelle.
Wenig später glaubten sie, das Leck gut genug abgedichtet zu haben, aber sie lauschten dem Knacken und Knarren, dem Knirschen und Schaben, das überall in dem großen Frachtraum zu sein schien.
„Das ist alles nur Stückwerk!“ schrie Calderazzo dem Inder ins Ohr. „Sag dem Capitaine Bescheid, daß er runterkommt und sich selbst davon überzeugt!“
„Ja“, sagte der Inder. „Ja, das tue ich jetzt auch.“
So schnell er konnte, kehrte er zu dem Niedergang zurück und kletterte nach oben. Er arbeitete sich durch den Achterdecksgang voran und öffnete die Tür zur Kuhl. Kaum war er draußen angelangt und hatte die Tür wieder zugerammt, toste ein neuer Brecher über das Schiff. Ranon klammerte sich an einem Manntau fest, schluckte Wasser, spie es wieder aus und blickte mit vor Entsetzen geweiteten Augen zum Himmel auf.
Der hatte sich fast schwarz gefärbt, der Tag war zur Nacht geworden. Blitze zuckten auf die See nieder, schwerer Gewitterdonner übertönte die Schreie der Besatzung, die mit schwindender Kraft an den Schoten und Brassen arbeitete, um die Stellung der Segel beizubehalten.
Bedrohlich krängte die „Malipur“ nach Backbord. Ihre Großrahnock schien in die Fluten der kochenden See zu tauchen.
Voll Panik kletterte Ranon auf das Achterdeck und hangelte an den Manntauen auf seinen Kapitän zu.
„Wir haben zuviel Wasser in den Frachträumen!“ schrie er ihm zu. „Mit den Pumpen schaffen wir es nicht! Wenn wir ein Leck abgedichtet haben, bricht das nächste auf! Sehen Sie es sich selbst an, Monsieur!“
René Joslin wandte ihm sein nasses, gehetzt und abgekämpft wirkendes Gesicht zu. Er wirkte um Jahre gealtert. Auch ihm, das begriff Ranon in diesem Moment, war jetzt voll bewußt geworden, in welch mörderische Gefahr sie sich dieses Mal begeben hatten.
Dennoch brüllte Joslin: „Das glaube ich dir auch so! Hol dir Dobro, den Malaien, und noch einen anderen Mann! Nimm sie mit nach unten! Zu fünft müßt ihr mit dem Wasser fertigwerden!“
„Unmöglich, Monsieur!“
„Das ist ein Befehl, Ranon!“ schrie der Franzose, und seine Stimme überschlug sich dabei. „Ich peitsche dich aus, wenn du meinen Befehl nicht befolgst!“
„Wir müssen eine Bucht anlaufen …“
„Nein!“
„… solange wir es noch können!“ rief der Inder verzweifelt.
„Niemals!“ brüllte Joslin ihn an. „Ich bin der Kapitän, ich bestimme, was zu tun ist!“
Aber vielleicht nicht mehr lange, dachte Ranon, dann drehte er sich um und hastete durch Wolken von Gischt zum Niedergang zurück. Diesmal ergeht es uns allen dreckig, sagte er sich, und du säufst mit uns ab, du Narr.
5.
Hasards letzte Worte waren scheinbar ungehört verklungen. In der Sturmbö, die jetzt wild über den Platz zwischen den Hütten und dem Hafen von Airdikit fegte, wandte Don Felix Maria Samaniego den Blick zur Palisadenwand – und plötzlich schien ihm die Erleuchtung zu kommen.
„Das Palisadenlager!“ rief er seinen Soldaten zu. „Die drei Kerle sind in die Umzäunung eingebrochen und versuchen, die Gefangenen herauszuholen! Seht doch, sie haben den Wachtposten niedergestreckt!“
„Warum hat das keiner bemerkt?“ schrie ein Offizier.
„Ich weiß es nicht, Senor“, antwortete ihm einer der jüngeren Unteroffiziere, ein Sargento.
„Egal!“ schrie Don Felix. „Zwanzig Mann sofort zum Tor des Lagers! Das Tor vorsichtig öffnen und ein paar Warnschüsse abgeben! Wenn die Kerle dann noch nicht aufgeben, greife ich hart durch!“
Die Soldaten stürmten unter der Führung des jungen Sargentos los.
Don Felix richtete seine Pistole, die er inzwischen nachgeladen hatte, auf den Seewolf.
„Killigrew“, sagte er. „Sie begleiten mich. Wir treten vor das offene Tor hin, und dann rufen Sie Ihrem Trio von Schwachsinnigen noch einmal zu, was sie zu tun haben. Eins versichere ich Ihnen schon jetzt: Sie sind meine Geisel, und ich werde Sie als solche rücksichtslos benutzen, falls diese Hunde nicht die Waffen strekken.“
„Wollen Sie mich töten?“
„Ich werde Ihnen vielleicht nur ins Bein schießen.“
„Das ist mehr als unfair.“
„Sie sprechen von Fairneß?“ Mit einer heftigen Geste wies der Kommandant auf seine toten Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten. „Das ist doch wohl ein Hohn! Sind dies hier vielleicht die Auswirkungen Ihrer legendären Ritterlichkeit, Corsario?“
„Ich habe versucht, meine Landsleute zu befreien. Sie haben kein Recht, sie hier festzuhalten und zur Zwangsarbeit zu vergewaltigen.“
Samaniego lachte laut auf. „Bestimmen Sie, was Recht und Unrecht ist? Wer sind Sie eigentlich, daß Sie …“
Weiter gelangte er nicht.
Ein Blitz stach vom schwarz und schmutziggelb gefärbten Himmel genau in die Bucht hinunter. Er zerriß die Dunkelheit mit seinem grellen Licht und ließ die Spanier unwillkürlich zusammenzucken. Donner dröhnte in dem Moment auf, in dem er sich ins Wasser entlud, unsichtbare Giganten schienen über die Lichtung zu stürmen und alles niederzureißen.
Die Soldaten, die jetzt das Tor des Palisadenzauns geöffnet hatten, waren für einen Augenblick irritiert. Sie wandten die Köpfe und blickten zu ihrem Kommandanten, weil sie das Krachen des Gewitterdonners mit dem Grollen eines Kanonenschusses verwechselten.
Und da geschah es.
Eine Meute von Männern stürmte aus dem Inneren des Palisadenlagers, allen voran Leusen, der Holländer, der die Führung der befreiten Sträflinge übernommen hatte.
Mit Leusen waren es dreizehn Männer – Holländer, Franzosen, Spanier und Portugiesen –, die ihre Ketten hatten lösen können. Die ganze Gruppe sprang als kompakte Einheit mitten zwischen den Zug Soldaten. Sie hieben mit ihren Fäusten zu und traten mit ihren Füßen aus, entwanden einigen völlig verdatterten Spaniern die Musketen und Tromblons und schossen auf die etwas weiter entfernt stehenden Soldaten, die jetzt ihrerseits mit den Feuerwaffen auf sie anlegten.
Wieder donnerte es, aber diesmal war es nicht das Gewitter, das seinen Zorn auf Airdikit niederschickte, sondern eins der Festungsgeschütze, das gesprochen hatte.
Hasard sah den Feuerblitz zwischen den Zinnen des Söllers und beobachtete auch, wie eine dicke schwarze Rauchwolke gen Himmel stieg.
Jetzt wußte er, daß Carberry, Shane, Dan und vielleicht auch ein paar Männer aus dem Palisadenlager in dem Kastell angelangt waren.
Don Felix war erschüttert und schien in diesem Moment nicht zu wissen, wohin er zuerst blicken sollte – zu seinen vor dem Palisadenzaun kämpfenden Männern oder zum Kastell, das ganz offensichtlich von den Feinden erobert worden war.
Der Seewolf warf sich auf ihn.
Wie auf einen Befehl hin handelten auch Smoky und Luke Morgan. Sie duckten sich, fuhren herum und rammten den Soldaten, die sie bewachten, die Ellenbogen in die Leiber. Die Überraschung der Spanier, die sich schon als Sieger gefühlt hatten, war ihr großer Trumpf.
Smoky schlug den direkt hinter ihm stehenden Soldaten nieder und riß dessen Muskete an sich.
Luke Morgan beförderte einen Spanier zu Boden, stürzte sich auf ihn und rammte ihm die rechte Faust unter die Kinnlade. Der Mann sank schlaff zusammen. Luke hob dessen Blunderbüchse auf, spannte deren Hahn und drückte auf zwei Soldaten ab, die sich auf den blutenden Ferris Tucker zubewegten.
Dann schoß auch Smoky.
Hasard hatte Don Felix’ Handgelenk gepackt und drückte dessen Waffenarm nach oben, während sie beide zu Böden gingen. Samaniego konnte zwar den Pistolenabzug bedienen, aber der Schuß stob wirkungslos in den Himmel. Hasard drehte ihm den Arm halb um, als der Kommandant versuchte, ihm den hölzernen Knauf der Pistole auf den Hinterkopf zu schlagen.
Samaniego mußte die Waffe loslassen. Sie fiel zu Boden. Aber noch gab der. Kommandant nicht auf. In wütendem Kampf wälzte er sich mit dem Seewolf auf dem Boden.
Wieder donnerte einer der schweren Siebzehnpfünder auf dem Söller des Kastells und entließ seine Ladung mit Feuer und Rauch. Die Kugel heulte über den Platz und landete im Hafenwasser, nicht weit von der Stelle entfernt, an der auch die erste eingeschlagen war. Es war der Umsicht des Profos zu verdanken, daß beide Geschosse nicht die „San Rosario“ trafen, die immer noch wild an ihrer Ankertrosse schwoite.
Carberry hatte zuerst seinen Augen nicht trauen wollen, als er gesehen hatte, welche Entwicklung die Dinge unten auf der Lichtung genommen hatten. Jetzt aber zündete er auch noch eine dritte Kanone – mehr wegen des Effekts als wegen der eigentlichen Wirkung –, verpaßte Trench einen begeisterten Hieb gegen die Schulter, daß dieser fast vom Söller kippte, und rannte zur Treppe, die auf den Hof der Festung hinunterführte.
Trench und Bonart sahen des Profos’ wuchtige Gestalt verschwinden und hörten seine Schritte die steinernen Stufen hinuntertrappeln. Sie tauschten einen Blick, nickten sich kurz zu und schlossen sich dem Narbenmann an.
Sie hasteten die Stufen so schnell hinunter wie er und befanden sich im nächsten Augenblick wieder neben ihm. Carberry war bei dem überwältigten Wachtposten stehengeblieben, der nicht weit vom Tor der Festung entfernt lag, und bückte sich nach dessen Waffen.
Shane, Dan, Jonny und die anderen Männer hatten nur die Muskete, die Pistole und den Degen des einen Spaniers mit in den Kerker hinuntergenommen. Carberry konnte sich also jetzt die Waffen des zweiten Wächters aneignen. Er richtete sich wieder auf, drehte sich zu seinen beiden Helfern um und warf Trench die Pistole und Josh Bonart den Degen zu.
Beide fingen die Waffen geschickt auf.
„Los jetzt“, sagte der Profos. „Wir öffnen das Tor und stürmen auf den Platz, um Hasard und den anderen im Kampf gegen diese verlausten Hundesöhne zu helfen.“
Er hatte gerade ausgesprochen, da fiel ein Schuß, und zwar unzweifelhaft im Kellergewölbe der Festung.
„Josh!“ rief der Profos. „Sieh mal nach, ob unsere Gruppe etwa auch unsere Unterstützung braucht!“
„Aye, Sir!“ Bonart wandte sich um und lief los, zu dem Turm hinüber, durch den der Weg in die Keller hinunterführte.
Trench blickte dem Kameraden nach und stellte bei dieser Gelegenheit fest, daß der erste Posten, den sie bewußtlos geschlagen hatten, sich in diesem Moment zu regen begann. Er schien aus seiner Ohnmacht zu erwachen, während der zweite immer noch tief im Reich der Träume versunken zu sein schien.
Trench eilte zum Sockel der Treppe, die auf den Söller hinaufging. Nur ein paar Schritte von der untersten Stufe entfernt lag der spanische Soldat. Trench nahm ihm kurzerhand den Helm ab, holte mit der erbeuteten Pistole aus und zog ihm den abgerundeten Kolben über den Hinterkopf – nicht zu hart, aber doch kräftig genug, um ihn zumindest für die nächste Viertelstunde zurück ins Land des Schlummers zu schicken.
Carberry hantierte derweil am Tor. Er hievte den Querbalken aus seinen eisernen Bügeln, schob den schweren geschmiedeten Riegel auf und zog den einen Torflügel zu sich heran, der sich ohne jedes Quietschen in seinen gut geölten neuen Angeln bewegte.
Trench verfolgte mit wachem Blick Josh Bonarts Bewegungen. Bonart hatte den Eingang zum Südturm erreicht und verschwand jetzt darin, aber schon nach wenigen Sekunden erschien er wieder und gab seinem Kameraden ein Zeichen, daß alles in Ordnung sei.
Trench lief zu Carberry. Bonart folgte ihm. Sie hetzten beide hinter dem Profos her, der jetzt mit der Muskete in den Fäusten aus dem offenen Tor auf die mit Steinen und Kies befestigte Anfahrt stürmte, die das Kastell mit dem Hüttenlager verband. Sie versuchten, ihn einzuholen und sich neben ihn zu bringen, schafften es aber nicht.
Der Profos konnte schneller laufen, als man es ihm wegen seiner riesigen, fast ungeschlachten Gestalt zutraute. Mitten zwischen die spanischen Soldaten raste er, schoß die Muskete ab und benutzte die Waffe dann als Hiebwerkzeug. Er fluchte und schlug wild mit dem Kolben nach links und nach rechts. Er trat Gegner mit seinen Füßen nieder, duckte sich vor Schüssen, die bedrohlich nah an ihm vorbeisirrten, und hatte nur ein Ziel vor Augen: zu Hasard, Blacky, Ferris, Smoky und Luke zu gelangen.
Hölle und Teufel, dachte Trench, so was hat die Welt noch nicht gesehen!
Dann richtete er seine Pistole auf einen spanischen Soldaten, der soeben zu dem vorbeijagenden Carberry herumfuhr und ihm die Ladung seines Tromblons in den Rücken zu jagen trachtete. Trench drückte ab, und sein Schuß erreichte den Spanier, als wieder ein Blitz die Dunkelheit erhellte und das Dröhnen des Gewitterdonners das Krachen der Schüsse auf der Lichtung übertönte.
Der Soldat brach zusammen und blieb auf der Seite liegen. Trench rannte zu ihm und nahm ihm das Tromblon ab. Josh Bonart stürzte sich unterdessen mit gezücktem Degen auf einen Spanier, der seine Muskete auf Carberry abgefeuert hatte, ohne diesen zu treffen.
Bevor der Profos auf dem Söller des Kastells die erste Kanone gezündet hatte, hatten Dan O’Flynn und Big Old Shane ihren Überraschungsangriff auf die Bewacher des Eingangs zum Kerker durchgeführt, und zwar so, wie Dan es sich ausgedacht hatte.