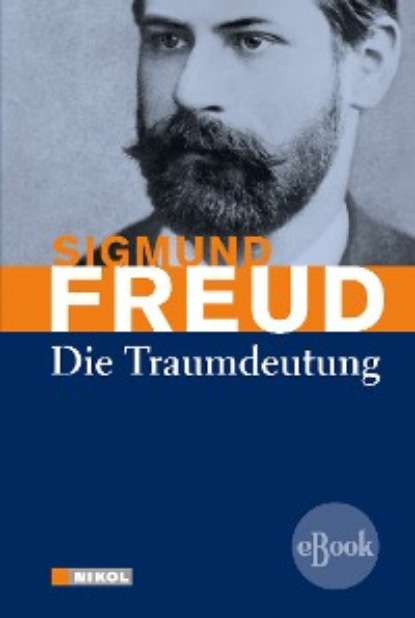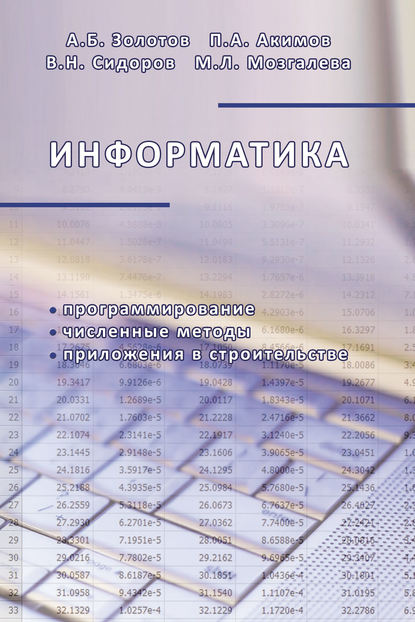- -
- 100%
- +
Mit ungewöhnlicher Einmütigkeit – von den Ausnahmen wird an anderer Stelle die Rede sein – haben die Autoren solche Urteile über den Traum gefällt, die auch unmittelbar zu einer bestimmten Theorie oder Erklärung des Traumlebens hinleiten. Es ist an der Zeit, daß ich mein eben ausgesprochenes Resumé durch eine Sammlung von Aussprüchen verschiedener Autoren – Philosophen und Ärzte – über die psychologischen Charaktere des Traumes ersetze:
Nach Lemoine ist die Inkohärenz der Traumbilder der einzig wesentliche Charakter des Traumes.
Maury pflichtet dem bei; er sagt (Le sommeil, p. 163): »II n’y a pas de rêves absolument raisonnables et qui ne contiennent quelque incohérence, quelque anachronisme, quelque absurdité.«
Nach Hegel bei Spitta fehlt dem Traum aller objektive verständige Zusammenhang.
Dugas sagt: »Le rêve c’est l’anarchie psychique affective et mentale, c’est le jeu des fonctions livrées à elles-mêmes et s’exercant sans contrôle et sans but; dans le rêve l’esprit est un automate spirituel.«
»Die Auflockerung, Lösung und Durcheinandermischung des im Wachen durch die logische Gewalt des zentralen Ich zusammengehaltenen Vorstellungslebens« räumt selbst Volkelt ein (S. 14), nach dessen Lehre die psychische Tätigkeit während des Schlafes keineswegs zwecklos erscheint.
Die Absurdität der im Traume vorkommenden Vorstellungsverbindungen kann man kaum schärfer verurteilen, als es schon Cicero (De divinatione, II) tat: »Nihil tam praepostere, tam incondite, tam monstruose cogitari potest, quod non possimus somniare.«
Fechner sagt (S. 522): »Es ist, als ob die psychologische Tätigkeit aus dem Gehirne eines Vernünftigen in das eines Narren übersiedelt.«
Radestock (S. 145): »In der Tat scheint es unmöglich, in diesem tollen Treiben feste Gesetze zu erkennen. Der strengen Polizei des vernünftigen, den wachen Vorstellungslauf leitenden Willens und der Aufmerksamkeit sich entziehend, wirbelt der Traum in tollem Spiel alles kaleidoskopartig durcheinander.«
Hildebrandt (S. 45): »Welche wunderlichen Sprünge erlaubt sich der Träumende z. B. bei seinen Verstandesschlüssen! Mit welcher Unbefangenheit sieht er die bekanntesten Erfahrungssätze geradezu auf den Kopf gestellt! Welche lächerlichen Widersprüche kann er in den Ordnungen der Natur und der Gesellschaft vertragen, bevor ihm, wie man sagt, die Sache zu bunt wird und die Überspannung des Unsinnes das Erwachen herbeiführt! Wir multiplizieren gelegentlich ganz harmlos: Drei mal drei macht zwanzig; es wundert uns gar nicht, daß ein Hund uns einen Vers hersagt, daß ein Toter auf eigenen Füßen nach seinem Grabe geht, daß ein Felsstück auf dem Wasser schwimmt; wir gehen alles Ernstes in höherem Auftrage nach dem Herzogtum Bernburg oder dem Fürstentum Liechtenstein, um die Kriegsmarine des Landes zu beobachten, oder lassen uns von Karl dem Zwölften kurz vor der Schlacht bei Pultawa als Freiwillige anwerben.«
Binz (S. 33) mit dem Hinweis auf die aus diesen Eindrücken sich ergebende Traumtheorie: »Unter zehn Träumen sind mindestens neun absurden Inhaltes. Wir koppeln in ihnen Personen und Dinge zusammen, welche nicht die geringsten Beziehungen zueinander haben. Schon im nächsten Augenblick, wie in einem Kaleidoskop, ist die Gruppierung eine andere geworden, womöglich noch unsinniger und toller, als sie es schon vorher war; und so geht das wechselnde Spiel des unvollkommen schlafenden Gehirns weiter, bis wir erwachen, mit der Hand nach der Stirne greifen und uns fragen, ob wir in der Tat noch die Fähigkeit des vernünftigen Vorstellens und Denkens besitzen.«
Maury (Le Sommeil, p. 50) findet für das Verhältnis der Traumbilder zu den Gedanken des Wachens einen für den Arzt sehr eindrucksvollen Vergleich: »La production de ces images que chez l’homme éveillé fait le plus souvent naître la volonté, correspond, pour l’intelligence, à ce que sont pour la motilité certains mouvements que nous offrent la chorée et les affections paralytiques...« Im übrigen ist ihm der Traum »toute une série de degradations de la faculté pensante et raisonnante« (p. 27).
Es ist kaum nötig, die Äußerungen der Autoren anzuführen, welche den Satz von Maury für die einzelnen höheren Seelenleistungen wiederholen.
Nach Strümpell treten im Traum – selbstverständlich auch dort, wo der Unsinn nicht augenfällig ist – sämtliche logischen, auf Verhältnissen und Beziehungen beruhenden Operationen der Seele zurück (S. 26). Nach Spitta (S. 148) scheinen im Traum die Vorstellungen dem Kausalitätsgesetz völlig entzogen zu sein. Radestock u. a. betonen die dem Traum eigene Schwäche des Urteils und des Schlusses. Nach Jodl (S. 123) gibt es im Traum keine Kritik, keine Korrektur einer Wahrnehmungsreihe durch den Inhalt des Gesamtbewußtseins. Derselbe Autor äußert: »Alle Arten der Bewußtseinstätigkeit kommen im Traume vor, aber unvollständig, gehemmt, gegeneinander isoliert.« Die Widersprüche, in welche sich der Traum gegen unser waches Wissen setzt, erklärt Stricker (mit vielen anderen) daraus, daß Tatsachen im Traum vergessen oder logische Beziehungen zwischen Vorstellungen verlorengegangen sind (S. 98) usw., usw.
Von den Autoren, die im allgemeinen so ungünstig über die psychischen Leistungen im Traume urteilen, wird indes zugegeben, daß ein gewisser Rest von seelischer Tätigkeit dem Traume verbleibt. Wundt, dessen Lehren für so viele andere Bearbeiter der Traumprobleme maßgebend geworden sind, gesteht dies ausdrücklich zu. Man könnte nach der Art und Beschaffenheit des im Traume sich äußernden Restes von normaler Seelentätigkeit fragen. Es wird nun ziemlich allgemein zugegeben, daß die Reproduktionsfähigkeit, das Gedächtnis, im Traum am wenigsten gelitten zu haben scheint, ja eine gewisse Überlegenheit gegen die gleiche Funktion des Wachens (vgl. oben S. 26) aufweisen kann, obwohl ein Teil der Absurditäten des Traumes durch die Vergeßlichkeit eben dieses Traumlebens erklärt werden soll. Nach Spitta ist es das Gemütsleben der Seele, was vom Schlaf nicht befallen wird und dann den Traum dirigiert. Als »Gemüt« bezeichnet er »die konstante Zusammenfassung der Gefühle als des innersten subjektiven Wesens des Menschen« (S. 84).
Scholz (S. 37) erblickt eine der im Traume sich äußernden Seelentätigkeiten in der »allegorisierenden Umdeutung«, welcher das Traummaterial unterzogen wird. Siebeck konstatiert auch im Traum die »ergänzende Deutungsfähigkeit« der Seele (S. 11), welche von ihr gegen alles Wahrnehmen und Anschauen geübt wird. Eine besondere Schwierigkeit hat es für den Traum mit der Beurteilung der angeblich höchsten psychischen Funktion, der des Bewußtseins. Da wir vom Traum nur durchs Bewußtsein etwas wissen, kann an dessen Erhaltung kein Zweifel sein; doch meint Spitta, es sei im Traum nur das Bewußtsein erhalten, nicht auch das Selbstbewußtsein. Delboeuf gesteht ein, daß er diese Unterscheidung nicht zu begreifen vermag.
Die Assoziationsgesetze, nach denen sich die Vorstellungen verknüpfen, gelten auch für die Traumbilder, ja ihre Herrschaft kommt im Traume reiner und stärker zum Ausdruck. Strümpell (S. 70): »Der Traum verläuft entweder ausschließlich, wie es scheint, nach den Gesetzen nackter Vorstellungen oder organischer Reize mit solchen Vorstellungen, das heißt, ohne daß Reflexion und Verstand, ästhetischer Geschmack und sittliches Urteil etwas dabei vermögen.« Die Autoren, deren Ansichten ich hier reproduziere, stellen sich die Bildung der Träume etwa folgenderart vor: Die Summe der im Schlaf einwirkenden Sensationsreize aus den verschiedenen, an anderer Stelle angeführten Quellen wecken in der Seele zunächst eine Anzahl von Vorstellungen, die sich als Halluzinationen (nach Wundt richtiger Illusionen wegen ihrer Abkunft von den äußeren und inneren Reizen) darstellen. Diese verknüpfen sich untereinander nach den bekannten Assoziationsgesetzen und rufen ihrerseits nach denselben Regeln eine neue Reihe von Vorstellungen (Bildern) wach. Das ganze Material wird dann vom noch tätigen Rest der ordnenden und denkenden Seelenvermögen, so gut es eben gehen will, verarbeitet (vgl. etwa Wundt und Weygandt). Es ist bloß noch nicht gelungen, die Motive einzusehen, welche darüber entscheiden, daß die Erweckung der nicht von außen stammenden Bilder nach diesem oder nach jenem Assoziationsgesetz vor sich gehe.
Es ist aber wiederholt bemerkt worden, daß die Assoziationen, welche die Traumvorstellungen untereinander verbinden, von ganz besonderer Art und verschieden von den im wachen Denken tätigen sind. So sagt Volkelt (S. 15): »Im Traume jagen und haschen sich die Vorstellungen nach zufälligen Ähnlichkeiten und kaum wahrnehmbaren Zusammenhängen. Alle Träume sind von solchen nachlässigen, zwanglosen Assoziationen durchzogen.« Maury legt auf diesen Charakter der Vorstellungsbindung, der ihm gestattet, das Traumleben in engere Analogie mit gewissen Geistesstörungen zu bringen, den größten Wert. Er anerkennt zwei Hauptcharaktere des »délire«: 1) une action spontanée et comme automatique de l’esprit; 2) une association vicieuse et irrégulière des idées (Le Sommeil, p. 126). Von Maury selbst rühren zwei ausgezeichnete Traumbeispiele her, in denen der bloße Gleichklang der Worte die Verknüpfung der Traumvorstellungen vermittelt. Er träumte einmal, daß er eine Pilgerfahrt (pélérinage) nach Jerusalem oder Mekka unternehme, dann befand er sich nach vielen Abenteuern beim Chemiker Pelletier, dieser gab ihm nach einem Gespräch eine Schaufel (pelle) von Zink, und diese wurde in einem darauffolgenden Traumstück sein großes Schlachtschwert (p. 137). Ein andermal ging er im Traum auf der Landstraße und las auf den Meilensteinen die Kilometer ab, darauf befand er sich bei einem Gewürzkrämer, der eine große Waage hatte, und ein Mann legte Kilogewichte auf die Waagschale, um Maury abzuwägen; dann sagte ihm der Gewürzkrämer: »Sie sind nicht in Paris, sondern auf der Insel Gilolo.« Es folgten darauf mehrere Bilder, in welchen er die Blume Lobelia sah, dann den General Lopez, von dessen Tod er kurz vorher gelesen hatte; endlich erwachte er, eine Partie Lotto spielend.[15]
Wir sind aber wohl gefaßt darauf, daß diese Geringschätzung der psychischen Leistungen des Traumes nicht ohne Widerspruch von anderer Seite geblieben ist. Zwar scheint der Widerspruch hier schwierig. Es will auch nicht viel bedeuten, wenn einer der Herabsetzer des Traumlebens versichert (Spitta, S. 118), daß dieselben psychologischen Gesetze, die im Wachen herrschen, auch den Traum regieren, oder wenn ein anderer (Dugas) ausspricht »le rêve n‘est pas déraison ni même irraison pure«, solange beide sich nicht die Mühe nehmen, diese Schätzung mit der von ihnen beschriebenen psychischen Anarchie und Auflösung aller Funktionen im Traum in Einklang zu bringen. Aber anderen scheint die Möglichkeit gedämmert zu haben, daß der Wahnsinn des Traumes vielleicht doch nicht ohne Methode sei, vielleicht nur Verstellung wie der des Dänenprinzen, auf dessen Wahnsinn sich das hier zitierte, einsichtsvolle Urteil bezieht. Diese Autoren müssen es vermieden haben, nach dem Anschein zu urteilen, oder der Anschein, den der Traum ihnen bot, war ein anderer.
So würdigt Havelock Ellis den Traum, ohne bei seiner scheinbaren Absurdität verweilen zu wollen, als »an archaic world of vast emotions and imperfect thoughts«, deren Studium uns primitive Entwicklungsstufen des psychischen Lebens kennen lehren könnte. J. Sully (p. 362) vertritt dieselbe Auffassung des Traumes in einer noch weiter ausgreifenden und tiefer eindringenden Weise. Seine Aussprüche verdienen um so mehr Beachtung, wenn wir hinzunehmen, daß er wie vielleicht kein anderer Psychologe von der verhüllten Sinnigkeit des Traumes überzeugt war. »Now our dreams are a means of conserving these successive personalities. When asleep we go back to the old ways of looking at things and of feeling about them, to impulses and activities which long ago dominated us.« Ein Denker wie Delboeuf behauptet – freilich ohne den Beweis gegen das widersprechende Material zu führen und darum eigentlich mit Unrecht: »Dans le sommeil, hormis la perception, toutes les facultés de l’esprit, intelligence, imagination, mémoire, volonté, moralité, restent intactes dans leur essence; seulement, elles s’appliquent à des objets imaginaires et mobiles. Le songeur est un acteur qui joue à volonté les fous et les sages, les bourreaux et les victimes, les nains et les géants, les démons et les anges.« (p. 222.) Am energischesten scheint die Herabsetzung der psychischen Leistung im Traum der Marquis d‘Hervey bestritten zu haben, gegen den Maury lebhaft polemisiert und dessen Schrift ich mir trotz aller Bemühung nicht verschaffen konnte. Maury sagt über ihn (Le sommeil, p. 19): »M. le Marquis d’Hervey prête à l’intelligence durant le sommeil, toute sa liberté d’action et d’attention et il ne semble faire consister le sommeil que dans l’occlusion des sens, dans leur fermeture au monde exterieur; en sorte que l’homme qui dort ne se distingue guère, selon sa manière de voir, de l’homme qui laisse vaguer sa pensée en se bouchant les sens; toute la différence qui sépare alors la pensée ordinaire de celle du dormeur c’est que, chez celui-ci, l’idée prend une forme visible, objective et ressemble, à s’y méprendre, à la sensation déterminée par les objets extérieurs; le souvenir revêt l’apparence du fait présent.«
Maury fügt aber hinzu: »qu’il y a une différence de plus et capitale à savoir que les facultés intellectuelles de l’homme endormi n’offrent pas l’équilibre qu’elles gardent chez l’homme éveillé.«
Bei Vaschide, der uns eine bessere Kenntnis des Buches von d‘Hervey vermittelt, finden wir, daß sich dieser Autor in folgender Art über die scheinbare Inkohärenz der Träume äußert. »L‘image du rêve est la copie de l‘idée. Le principal est l‘idée; la vision n‘est qu‘accessoire. Ceci établi, il faut savoir suivre la marche des idées, il faut savoir analyser le tissu des rêves; l‘incohérence devient alors compréhensible, les conceptions les plus fantasques deviennent des faits simples et parfaitement logiques« (p. 146). Und (p. 147):»Les rêves les plus bizarres trouvent même une explication des plus logiques quand on sait les analyser.«
J. Stärcke hat darauf aufmerksam gemacht, daß eine ähnliche Auflösung der Trauminkohärenz von einem alten Autor, Wolf Davidson, der mir unbekannt war, 1799 verteidigt worden ist (p. 136): »Die sonderbaren Sprünge unserer Vorstellungen im Traume haben alle ihren Grund in dem Gesetze der Assoziation, nur daß diese Verbindung manchmal sehr dunkel in der Seele vorgeht, so daß wir oft einen Sprung der Vorstellung zu beobachten glauben, wo doch keiner ist.«
Die Skala der Würdigung des Traumes als psychisches Produkt hat in der Literatur einen großen Umfang; sie reicht von der tiefsten Geringschätzung, deren Ausdruck wir kennengelernt haben, durch die Ahnung eines noch nicht enthüllten Wertes bis zur Überschätzung, die den Traum weit über die Leistungen des Wachlebens stellt. Hildebrandt, der, wie wir wissen, in drei Antinomien die psychologische Charakteristik des Traumlebens entwirft, faßt im dritten dieser Gegensätze die Endpunkte dieser Reihe zusammen (S. 19 f.): »Es ist der zwischen einer Steigerung, einer nicht selten bis zur Virtuosität sich erhebenden Potenzierung, und anderseits einer entschiedenen, oft bis unter das Niveau des Menschlichen führenden Herabminderung und Schwächung des Seelenlebens.«
»Was das erstere betrifft, wer könnte nicht aus eigener Erfahrung bestätigen, daß in dem Schaffen und Weben des Traumgenius bisweilen eine Tiefe und Innigkeit des Gemütes, eine Zartheit der Empfindung, eine Klarheit der Anschauung, eine Feinheit der Beobachtung, eine Schlagfertigkeit des Witzes zutage tritt, wie wir solches alles als konstantes Eigentum während des wachen Lebens zu besitzen bescheidentlich in Abrede stellen würden? Der Traum hat eine wunderbare Poesie, eine treffliche Allegorie, einen unvergleichlichen Humor, eine köstliche Ironie. Er schauet die Welt in einem eigentümlich idealisierenden Lichte und potenziert den Effekt ihrer Erscheinungen oft im sinnigsten Verständnisse des ihnen zum Grunde liegenden Wesens. Er stellt uns das irdisch Schöne in wahrhaft himmlischem Glanze, das Erhabene in höchster Majestät, das erfahrungsgemäß Furchtbare in der grauenvollsten Gestalt, das Lächerliche mit unbeschreiblich drastischer Komik vor Augen; und bisweilen sind wir nach dem Erwachen irgendeines dieser Eindrücke noch so voll, daß es uns vorkommen will, dergleichen habe die wirkliche Welt uns noch nie und niemals geboten.«
Man darf sich fragen, ist es wirklich das nämliche Objekt, dem jene geringschätzigen Bemerkungen und diese begeisterte Anpreisung gilt? Haben die einen die blödsinnigen Träume, die anderen die tiefsinnigen und feinsinnigen übersehen? Und wenn beiderlei vorkommt, Träume, die solche und die jene Beurteilung verdienen, scheint es da nicht müßig, nach einer psychologischen Charakteristik des Traumes zu suchen, genügt es nicht zu sagen, im Traume sei alles möglich, von der tiefsten Herabsetzung des Seelenlebens bis zu einer im Wachen ungewohnten Steigerung desselben? So bequem diese Lösung wäre, sie hat dies eine gegen sich, daß den Bestrebungen aller Traumforscher die Voraussetzung zugrunde zu liegen scheint, es gäbe eine solche in ihren wesentlichen Zügen allgemeingültige Charakteristik des Traumes, welche über jene Widersprüche hinweghelfen müßte.
Es ist unstreitig, daß die psychischen Leistungen des Traumes bereitwilligere und wärmere Anerkennung gefunden haben in jener, jetzt hinter uns liegenden, intellektuellen Periode, da die Philosophie und nicht die exakten Naturwissenschaften die Geister beherrschte. Aussprüche, wie die von Schubert, daß der Traum eine Befreiung des Geistes von der Gewalt der äußeren Natur sei, eine Loslösung der Seele von den Fesseln der Sinnlichkeit, und ähnliche Urteile von dem jüngeren Fichte[16] u. a., welche sämtlich den Traum als einen Aufschwung des Seelenlebens zu einer höheren Stufe darstellen, erscheinen uns heute kaum begreiflich; sie werden in der Gegenwart auch nur bei Mystikern und Frömmlern wiederholt[17]. Mit dem Eindringen naturwissenschaftlicher Denkweise ist eine Reaktion in der Würdigung des Traumes einhergegangen. Gerade die ärztlichen Autoren sind am ehesten geneigt, die psychische Tätigkeit im Traume für geringfügig und wertlos anzuschlagen, während Philosophen und nicht zünftige Beobachter – Amateurpsychologen –, deren Beiträge gerade auf diesem Gebiete nicht zu vernachlässigen sind, im besseren Einvernehmen mit den Ahnungen des Volkes, meist an dem psychischen Wert der Träume festgehalten haben. Wer zur Geringschätzung der psychischen Leistung im Traume neigt, der bevorzugt begreiflicherweise in der Traumätiologie die somatischen Reizquellen; für den, welcher der träumenden Seele den größeren Teil ihrer Fähigkeiten im Wachen belassen hat, entfällt natürlich jedes Motiv, ihr nicht auch selbständige Anregungen zum Träumen zuzugestehen.
Unter den Überleistungen, welche man auch bei nüchterner Vergleichung versucht sein kann, dem Traumleben zuzuschreiben, ist die des Gedächtnisses die auffälligste; wir haben die sie beweisenden, gar nicht seltenen Erfahrungen ausführlich behandelt. Ein anderer, von alten Autoren häufig gepriesener Vorzug des Traumlebens, daß es sich souverän über Zeit- und Ortsentfernungen hinwegzusetzen vermöge, ist mit Leichtigkeit als eine Illusion zu erkennen. Dieser Vorzug ist, wie Hildebrandt bemerkt, eben ein illusorischer Vorzug; das Träumen setzt sich über Zeit und Raum nicht anders hinweg als das wache Denken, und eben weil es nur eine Form des Denkens ist. Der Traum sollte sich in bezug auf die Zeitlichkeit noch eines anderen Vorzugs erfreuen, noch in anderem Sinne vom Ablauf der Zeit unabhängig sein. Träume, wie der oben S. 41 mitgeteilte Maurys von seiner Hinrichtung durch die Guillotine, scheinen zu beweisen, daß der Traum in eine sehr kurze Spanne Zeit weit mehr Wahrnehmungsinhalt zu drängen vermag, als unsere psychische Tätigkeit im Wachen Denkinhalt bewältigen kann. Diese Folgerung ist indes mit mannigfaltigen Argumenten bestritten worden; seit den Aufsätzen von Le Lorrain und Egger »über die scheinbare Dauer der Träume« hat sich hierüber eine interessante Diskussion angesponnen, welche in dieser heikeln und tiefreichenden Frage wahrscheinlich noch nicht die letzte Aufklärung erreicht hat[18].
Daß der Traum die intellektuellen Arbeiten des Tages aufzunehmen und zu einem bei Tag nicht erreichten Abschluß zu bringen vermag, daß er Zweifel und Probleme lösen, bei Dichtern und Komponisten die Quelle neuer Eingebungen werden kann, scheint nach vielfachen Berichten und nach der von Chabaneix angestellten Sammlung unbestreitbar zu sein. Aber wenn auch nicht die Tatsache, so unterliegt doch deren Auffassung vielen, ans Prinzipielle streifenden Zweifeln[19].
Endlich bildet die behauptete divinatorische Kraft des Traumes ein Streitobjekt, an welchem schwer überwindliche Bedenken mit hartnäckig wiederholten Versicherungen zusammentreffen. Man vermeidet es – und wohl mit Recht –, alles Tatsächliche an diesem Thema abzuleugnen, weil für eine Reihe von Fällen die Möglichkeit einer natürlichen psychologischen Erklärung vielleicht nahe bevorsteht.
F
Die ethischen Gefühle im Traume
Aus Motiven, welche erst nach Kenntnisnahme meiner eigenen Untersuchungen über den Traum verständlich werden können, habe ich von dem Thema der Psychologie des Traumes das Teilproblem abgesondert, ob und inwieweit die moralischen Dispositionen und Empfindungen des Wachens sich ins Traumleben erstrecken. Der nämliche Widerspruch in der Darstellung der Autoren, den wir für alle anderen seelischen Leistungen mit Befremden bemerken mußten, macht uns auch hier betroffen. Die einen versichern mit ebensolcher Entschiedenheit, daß der Traum von den sittlichen Anforderungen nichts weiß, wie die andern, daß die moralische Natur des Menschen auch fürs Traumleben erhalten bleibt.
Die Berufung auf die allnächtliche Traumerfahrung scheint die Richtigkeit der ersteren Behauptung über jeden Zweifel zu erheben. Jessen sagt (S. 553): »Auch besser und tugendhafter wird man nicht im Schlafe, vielmehr scheint das Gewissen in den Träumen zu schweigen, indem man kein Mitleid empfindet und die schwersten Verbrechen, Diebstahl, Mord und Totschlag mit völliger Gleichgültigkeit und ohne nachfolgende Reue verüben kann.«
Radestock (S. 146): »Es ist zu berücksichtigen, daß die Assoziationen im Traume ablaufen und die Vorstellungen sich verbinden, ohne daß Reflexion und Verstand, ästhetischer Geschmack und sittliches Urteil etwas dabei vermögen; das Urteil ist höchst schwach, und es herrscht ethische Gleichgültigkeit vor.«
Volkelt (S. 23): »Besonders zügellos aber geht es, wie jeder weiß, im Traume in geschlechtlicher Beziehung zu. Wie der Träumende selbst aufs äußerste schamlos und jedes sittlichen Gefühls und Urteils verlustig ist, so sieht er auch alle anderen und selbst die verehrtesten Personen mitten in Handlungen, die er im Wachen auch nur in Gedanken mit ihnen zusammenzubringen sich scheuen würde.«
Den schärfsten Gegensatz hiezu bilden Äußerungen wie die von Schopenhauer, daß jeder im Traum in vollster Gemäßheit seines Charakters handelt und redet. K. Ph. Fischer[20] behauptet, daß die subjektiven Gefühle und Bestrebungen oder Affekte und Leidenschaften in der Willkür des Traumlebens sich offenbaren, daß die moralischen Eigentümlichkeiten der Personen in ihren Träumen sich spiegeln.
Harfner (S. 25): »Seltene Ausnahmen abgerechnet, ... wird ein tugendhafter Mensch auch im Traum tugendhaft sein; er wird den Versuchungen widerstehen, dem Haß, dem Neid, dem Zorn und allen Lastern sich verschließen; der Mann der Sünde aber wird auch in seinen Träumen in der Regel die Bilder finden, die er im Wachen vor sich hatte.«