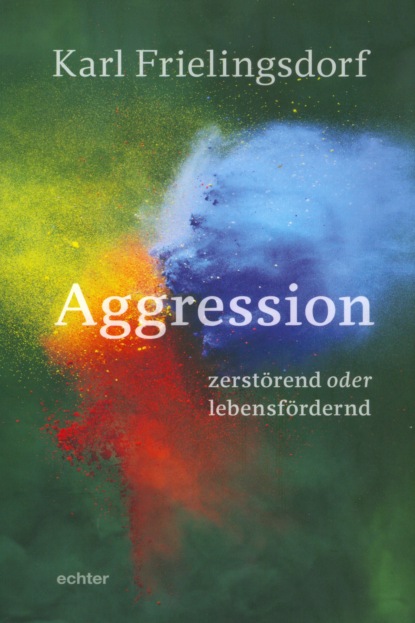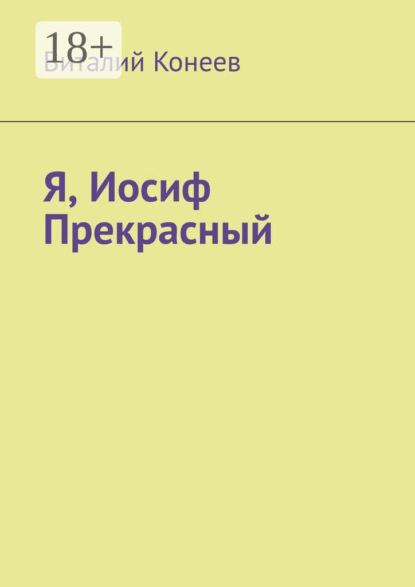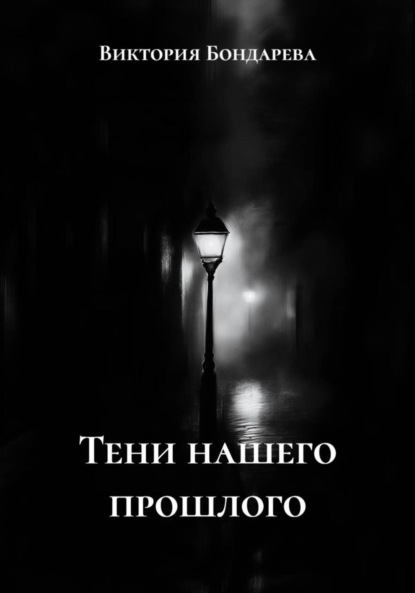- -
- 100%
- +
Danach kann ich neben dem Gefühl der Befreiung noch ein körperliches Unwohlsein spüren, das sich psychisch im Ärger ausdrückt. Ich bin erschöpft und erleichtert, spüre aber immer noch die Wut nachklingen und weiß nicht, wie ich die Energie abfließen lassen soll. Hier kann jede körperliche Bewegung helfen, z. B. laufen, körperlich arbeiten, viele Sportarten, damit ich zu einem größeren Gleichgewicht komme. Wut und verbleibender Ärger können auch in Wutbriefen, die laut gelesen werden, oder in Schimpfen und Anklagen bzw. in stellvertretenden körperlichen Auseinandersetzungen ausagiert werden.
Meist kommen danach Schmerz und Trauer hoch, oft vermischt mit Tränen, die andeuten, dass sich etwas löst. Der Blick ist frei für die Verletzung, die der Aggression zugrunde liegt, sei sie nach außen oder nach innen gerichtet. Hier kann dann der Prozess des Verstehens und der Versöhnung ansetzen, in dem die Aggressionen nicht mehr schädigend, sondern fruchtbar und lebensfördernd eingesetzt werden.
Wie bereits angedeutet, verstehen wir Aggressionen auch als einen Ausdruck von Lebensenergien, die in jedem Menschen vorhanden sind. Aggression ist eine positive Kraft, eine Antriebsenergie, die aus der inneren Lebensquelle des Menschen gespeist wird. Im Unterschied zur ungebündelten und eruptiven Wut kann die Aggression zielgerichtet und komprimiert werden (Besems, 30 ff.). Diese aggressive Lebensenergie macht den Menschen lebendig und aktiv, mit ihr gestaltet er kreativ seine Lebenswirklichkeit. Wir brauchen diese Antriebskraft immer wieder, um unsere potentiellen Möglichkeiten in Fähigkeiten und in Tun umzusetzen.
Im existentiellen Sinne bezeichnet Tillich diese aggressive Lebenskraft als „power to be“, d. h. als Trieb jedes lebendigen Wesens, sich mit zunehmender Intensität und Extensität selbst zu realisieren (Tillich, 36). Mit dieser aggressiven Lebenskraft verwirklicht der Mensch zunächst sich selbst. Sie gibt ihm die Möglichkeit, sein Leben in die Hand zu nehmen. Er entwickelt Selbstständigkeit und kann zu einer autonomen Persönlichkeit werden. Damit ist natürlich nicht eine fremdbestimmte Selbstsicherheit gemeint, die sich in Leistungen und den entsprechenden Bestätigungen durch andere beweisen muss. Die innere Lebenskraft zeigt ihre wahre Stärke in Krisensituationen und bei großen Herausforderungen. „Solche aktive Selbstbehauptung ist erfolgreich in dem Maß, wie die Subjekte in diesem Prozess der Selbstbehauptung ihre eigene Kraft spüren und die davon betroffenen „Objekte“ merken, dass sie es nicht mit einer aufgeblasenen Fassade, sondern wirklich mit dem Ausdruck einer inneren „power to be“ zu tun haben“ (Klessmann 1992, 75).
Das aggressive Potential ist ebenso notwendig, um die Welt zu erforschen und die anderen Menschen als Du zu entdecken, um dann auf dieses Du zuzugehen und Beziehungen anzuknüpfen.
In der Beziehung zu Gott ist die Aggression ein wichtiger Impuls auf unserer Suche nach einer Begegnung mit ihm, nach dem Gott, der in uns wohnt und gleichzeitig als Du im „Außen“ unseres Selbst zu finden ist.
Wir können unseren aggressiven Lebensenergien unterschiedliche Richtungen geben und sie verschieden wirken lassen. Wir können sie lebens- und beziehungsfördernd einsetzen. Wir können sie aber auch destruktiv-zerstörerisch gegen uns selbst und andere richten. Oder wir können sie einfach brachliegen und ruhen lassen. Das verursacht auf Dauer einen Energiestau, der sich dann vielleicht an unpassender Stelle Raum und Luft verschafft.
Daraus ergibt sich die Aufgabe, Wege zu finden, wie wir unser aggressives Lebenspotential lebensfördernd und beziehungsstiftend einsetzen können. In diesem Sinne schreibt C. Thompson: „Aggression ist keinesfalls notwendig destruktiv. Sie kommt aus einer angeborenen Tendenz, zu wachsen und das Leben zu meistern … Nur wenn diese Lebenskraft in ihrer Entwicklung behindert wird, verbinden sich Elemente von Ärger, Wut oder Hass mit ihr und werden schließlich zu erbarmungsloser Aggression“ (Thompson, 179).
2.Einige mit der Aggression verwandte Begriffe: Ärger, Wut, Zorn, Hass, Feindschaft, GrollDa die mit der Aggression verwandten Begriffe wie Ärger, Wut, Zorn, Hass und Groll häufig vermischt und synonym gebraucht werden, wollen wir eine kurze Klärung und Abgrenzung der wichtigsten Begriffe vornehmen.
Ärger ist vor allem ein psychisches Unwohlsein, das sich u. a. in einer lauteren Stimme, in Fluchen, Schimpfen, Drohgebärden und heftigen Bewegungen äußern kann. Die körperliche Erregung (z. B. Erröten, Schweißausbruch, drohende Gebärden, erhöhte Pulsfrequenz) muss „einer bestimmten psychologischen und kognitiven Einschätzung und Zuordnung unterworfen werden, um als spezifisches Gefühl – und nicht nur als diffuse Erregung wahrgenommen zu werden“ (Klessmann, 24; Bierhoff 5 f.).
Neben dieser Verbindung der physiologischen Erregung mit einer psychischen Einschätzung der aktuellen Situation spielt auch das soziokulturelle Element eine Rolle: „Die Einschätzung und Zuordnung sowohl der physiologischen Erregung als auch der auslösenden Situation sind bestimmten vorgegebenen gesellschaftlichen Regeln und Normen unterworfen, also nicht völlig Ausdruck individueller Spontaneität und Freiheit“ (Klessman 1992, 25). So ist Ärger eine Mischung aus Leidenschaft und einem kontrollierbaren Ausdruck. Kann der Ärger nicht geäußert werden, wirkt die Kränkung weiter und der Ärger schlägt plötzlich in Wut um.
Wut ist zunächst ein mehr körperliches Unwohlsein, ein leidenschaftliches Gefühl, das einfach „heraus“muss. Das geschieht meist unkontrolliert, eruptiv und wenig zielgerichtet und äußert sich in lautem Türzuschlagen, im Zertrümmern von Geschirr, im Treten gegen einen Schrank u. a. m. Wut ist ein Zustand „hoher affektiver Erregung mit motorischen und vegetativen Erscheinungen, der sich als Reaktion auf eine Beeinträchtigung der Persönlichkeits- oder Vitalsphäre aus einem aggressiven Spannungsstau entwickelt“ (Tisch, 2572). Nach einem Wutausbruch tritt meist wieder eine Ruhepause ein, ohne dass allerdings das eigentliche Problem gelöst ist: mit der dahinterliegenden Verletzung und Ohnmacht (ohnmächtige Wut) heilsam umzugehen.
Zorn ähnelt in seinem spontanen Anteil der Wut (Zornausbruch), kommt aber im Gegensatz zu den Begriffen Ärger und Wut in der Alltagssprache weniger vor. In Ausdrücken wie „heiliger Zorn“ oder Zorn Gottes ist er insgesamt archaischer und dem literarischen und religiösen Bereich vorbehalten (Klessmann, 26). Im Unterschied zur oft unkontrollierten Wut vollzieht sich Zorn mehr überlegend, ist zielgerichtet und wägt bewusst mehr die Konsequenzen für sich selbst und die Umwelt ab.
Groll und daraus erwachsene Feindschaft sind keine spontanen Gefühlsäußerungen wie Wut und Zorn, sondern länger andauernde Zustände, die sich z. B. aus einem unterdrückten Ärger entwickeln können. Es ist möglich, dass sie auf Dauer alle anderen Gefühle überdecken. Wenn sie nur noch auf die Schädigung anderer Menschen ausgerichtet sind, werden sie zu Hass.
3.Unterschiedliche Formen von AggressionWenn wir von dem zunächst wertfreien Begriff „Aggression“ ausgehen, können wir folgende Weisen von Aggressionen unterscheiden, die in ihrer Richtung und Wirkung unterschiedlich sind: die zerstörerischen (destruktiven) Aggressionen, die unterdrückten Aggressionen sowie die lebensfördernden und beziehungsstiftenden (konstruktiven) Aggressionen. Wir verdeutlichen sie am Modell des Autofahrens.
3.1.Zerstörerische (destruktive) AggressionenDie zerstörerischen Aggressionen sind durch ihre schädigenden Auswirkungen gekennzeichnet. Hier wird die Energie ohne Rücksicht auf das Wohl und die Grenzen des Gegenübers „zum Ziel“ gebracht. Diese Aggressionen können ihre zerstörerische Wirkung nach außen in sinnloser Wut, in chaotischen Kraftakten, in willkürlicher Unterdrückung bis hin zum Mord ausüben. Das geschieht in Privatfehden und Völkerkriegen, in Folterungen, in Wortfechtereien, im „Fertigmachen“ von anderen Menschen ebenso wie im Mobbing am Arbeitsplatz oder in der Schule. Alexander Mitscherlich meint dazu: Mehr oder weniger sind wir alle verführbar, den Mitmenschen zu quälen. Auch die sind es, die solches weit von sich weisen. Sie wissen nur nicht, was sie tun. Diese negative Tendenz wird von den Medien Tag für Tag unterstützt, wenn nach einer internen Untersuchung fast die Hälfte aller deutschen Fernsehprogramme, genau 47,7 Prozent, sich irgendwie um destruktive Aggression und Bedrohung drehen. Darin sind enthalten 481 Mordszenen wöchentlich und 70 täglich.
Die zerstörerischen Aggressionen können sich auch in subtileren Formen äußern, z. B. in „spitzen“ Bemerkungen, in „beißender“ Ironie, in „schlagenden“ Worten, in „Kränkungen“, in „Sticheleien“, in der schamlosen Neugier des Schlüsselloch-Journalismus, in der Verachtung oder im Auslachen und Verspotten anderer Menschen.
Hiermit setzen diese Aggressionen einen zerstörerischen Teufelskreis in Gang: Sie ziehen Hass und Feindschaft, Unverständnis und Unversöhnlichkeit, Verletzungen und Kränkungen nach sich, die bei den Geschädigten wiederum destruktive Aggressionen hervorrufen können nach dem Motto: „Wie du mir, so ich dir“. Die Kräfte, die eigentlich dem Leben dienen sollten, werden „gegen“ das Leben verwandt und können sogar in letzter Konsequenz zum Nicht-Leben, d. h. zum Tode, führen.
Menschen, die ein solches destruktives Aggressionsverhalten entwickeln, haben als Kinder oft Gewalt und Drohbotschaften erfahren: „Wenn du nicht brav bist, schlag ich dich tot“; „Du darfst nur leben, wenn du dich anpasst und nicht aufmuckst“. Aus diesen Kindern wurden häufig mit Gewalt der Trotz und Eigenwille herausgeprügelt. Sie haben gelernt: „Wenn die anderen stärker sind, passe dich an und ducke dich. Wenn du selbst stärker bist, unterdrücke die andern, hau drauf und schikaniere sie. Halte sie klein und lebe auf ihre Kosten.“
Häufig setzen die Betreffenden ihre Aggressionen nicht direkt in einer Auseinandersetzung mit den Kontrahenten ein, sondern lassen sie destruktiv an Untergebenen aus. Franklin Roosevelt kommentiert das so: Wer die Hand als Erster zum Schlag erhebt, gibt zu, dass ihm die Ideen ausgegangen sind. Stellvertretende aggressive Handlungen geschehen in unterschiedlichen Beziehungsgefügen, z. B. wenn Eltern ihre zerstörerischen Aggressionen an ihren Kindern auslassen oder Lehrer an ihren Schülern. Es fehlen die konstruktiven Zwischentöne des aggressiven Verhaltens, das zum Leben führt.
Vergleichbar ist dieses zerstörerische Verhalten mit dem eines Autofahrers, der sein Auto „auf viele PS hochfrisiert“ hat und rücksichtslos mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt fährt. Er beachtet keine Ampeln, keine Fußgänger, keine Verkehrsschilder, die nach seiner Meinung nur für die anderen gelten. Er fährt ohne Rücksicht auf Verluste und lässt eine Spur der Verwüstung zurück: schrottreife Autos, verletzte Menschen, Angst und Schrecken. Wenn Ungeduld und Hilflosigkeit aufeinandertreffen, entsteht Aggression (Tom Borg).
Eine andere Weise, die zerstörerischen Aggressionen auszuleben, ist die der Autoaggression: Menschen richten ihre Energie destruktiv nach innen gegen sich selbst. Eine solche Selbstzerstörung kann bis zum Selbstmord führen, der im Volksmund auch ein „verhinderter Mord“ genannt wird. Diese Menschen haben in der Kindheit meist folgende negativen Elternbotschaften gehört: „Du bist wertlos“; „Du bist ein Nichtsnutz“; „Ach wärst du doch nie geboren“; „Du bringst mich noch ins Grab“; „Geh mir aus den Augen“ etc. Vielleicht haben sie bei Vater oder Mutter erlebt, dass das Leben sinnlos und eine unerträgliche Last ist, nicht lebenswert. Solche Menschen verachten sich und ekeln sich vor sich selbst. Auch wenn nur relativ wenige Menschen ihr Leben durch Selbstmord beenden, so gibt es verschiedene selbstzerstörerische Methoden, wie man sich langsam, aber sicher dem Tod nähern kann: durch Tot-Trinken, Tot-Essen, Tot-Hungern, Tot-Schuften, Zu-Tode-Langweilen etc. Auch psychosomatische Störungen oder neurotische Verhaltensweisen können autoaggressive Reaktionen sein.
Im religiösen Bereich wird dieses autoaggressive Verhalten z. B. in einer „negativen Askese“ oder in einer „falschen Demut“ sichtbar, wo Menschen sich „um des Himmelreiches willen“ selbst kasteien und in einem sogenannten Opferleben ihre unterdrückte Wut selbstzerstörerisch gegen sich selbst richten.
Dieses destruktive Verhalten gleicht dem Verhalten eines Autofahrers, der seinen Wagen in die Garage fährt, das Tor schließt, den Motor anmacht, in den Leerlauf schaltet und auf Vollgas stellt. Alle Energien des Wagens werden sinnlos eingesetzt. Sie bleiben im Dunkel, im Rauch und Gestank stecken, setzen nichts in Bewegung. Der Autofahrer gibt Vollgas und „vergast“ sich dabei selbst. Er zerstört sich und den Wagen.
3.2.Unterdrückte AggressionenUnterdrückte Aggressionen fallen auf den ersten Blick nicht besonders auf. Doch je weniger sie beachtet werden, desto mehr können sie wirksam sein. Die Menschen mit mehrheitlich unterdrückten Aggressionen machen nach außen eher einen friedlichen und vorsichtigen, freundlichen und zurückhaltenden Eindruck. Bei näherem Hinschauen zeigen sich allerdings auch die Auswirkungen der unterdrückten Aggressionen in ihrem Verhalten: Sie wirken gehemmt, ängstlich, verklemmt, verkrampft, antriebsschwach und uninteressiert. Sie machen den Eindruck von Nachgiebigkeit, sind übervorsichtig, einfallslos und entscheidungsschwach. Zur Bekämpfung und Unterdrückung der eigenen Lebensimpulse und Energien benötigen sie viel Kraft. Aggressionen gelten als unerlaubt oder verboten, nicht schicklich oder unangemessen. Deshalb müssen sie unter Kontrolle gehalten und mit allen Mitteln „be-herrscht“ werden. Dies ist auf Dauer sehr anstrengend und kraftraubend. Menschen, die ihre lebensfördernden Aggressionen unterdrücken, gleichen dem Diener im Evangelium, der sein Talent in der Erde vergräbt, weil er Angst vor seinem Herrn hat (Mt 25,14 ff.).
Lebensgeschichtlich gesehen, haben ihnen die Eltern meist verboten, ihre Aggressionen zu äußern: Aggressionen sind nicht vom Guten oder gar „Sünde“; „Aggressionen zeigt man nicht, weil sie zerstören und zum Streit führen“; „Aggressionen sind in sich schlecht und schädlich“.
Unterdrückte Aggressionen wirken sich auch körperlich aus: „Entweder man nimmt ein leises Zittern wahr, eine mühsam zurückgehaltene Wut, das nervöse Flattern, die zusammengebissenen Zähne, die hinter Überfreundlichkeit versteckte Wut, die Kälte in der Stimme …; da kocht einer vor Wut, aber der Deckel ist fest zugeschraubt. Oder man bemerkt eine merkwürdige Lahmheit, Blassheit, Unlebendigkeit, Erschöpfung, Müdigkeit, Ausgelaugtheit, Traurigkeit, Starrheit“ oder Lähmung. Damit einher geht häufig ein introvertiertes Verhalten und eine depressive Grundstimmung (Lambert, 14 ff.).
Solche Menschen sind mit einem Autofahrer zu vergleichen, der in seinem Wagen sitzt, Vollgas gibt und gleichzeitig die Fuß- und Handbremse betätigt. Die Lautstärke des Motors lässt die großen Kräfte und Gegenkräfte ahnen, die im Auto wirksam sind. Allerdings verpuffen die meisten Energien, da sie nicht in Bewegung umgesetzt werden. Das Auto und der Fahrer bleiben bei allem Energieaufwand unbeweglich. Das Ganze endet in Erschöpfung, Kraftlosigkeit und Stillstand.
3.3.Lebensfördernde (konstruktive) AggressionenDie lebens- und beziehungsfördernden Aggressionen wirken als kreative, aufbauende und gestaltende Kräfte, die Leben und Beziehung anstiften und letztlich auf Liebe ausgerichtet sind, die wiederum neue Energien freisetzt. Erfüllt von dieser Lebensund Liebesenergie vermögen Menschen ihre Kräfte für sich selbst und für andere einzusetzen. Sie sind entscheidungsfreudig, gehen Konflikten nicht aus dem Wege, sagen ihre Meinung und sind doch einfühlsam und anpassungsfähig. Sie besitzen ein gesundes Selbstbewusstsein und kennen ihre lebensfördernden und zerstörerischen Anteile, und sie sind in der Lage, damit umzugehen. Sie haben sich mit ihrer eigenen Lebens- und Glaubensgeschichte auseinandergesetzt und haben ihre negativen Elternbotschaften in eigene, positive Leitsätze umgeschrieben, die ihnen helfen, ihre Aggressionen lebensfördernd einzusetzen. Sie sehen ihr Leben in Beziehung und sind geprägt von einem Glauben, der über das Irdische hinausweist. Aus dem „Prinzip Hoffnung“ lebend, lehnen sie einen lähmenden Pessimismus ebenso ab wie einen blinden Optimismus.
Sie haben gelernt, in kleinen Schritten auch die Zwischentöne der lebens- und beziehungsfördernden Aggressionen zu sehen und zu leben, z. B. in persönlichen Beziehungen, in Freundschaften, in der Ehe, in der Beziehung zur Umwelt und in der Beziehung zu Gott.
Ein Mensch, der seine Aggressionen so konstruktiv einsetzt, gleicht einem Autofahrer, der ein umweltfreundliches Auto fährt, der seinen Wagen gut kennt und ihn pflegt. Er setzt die PS-Energien seines Autos ein, um Neues zu entdecken, sich frei zu bewegen, und er steuert bestimmte Ziele an. Er lädt Menschen zu gemeinsamen Reisen ein und bildet Fahrgemeinschaften. Er nutzt den Wagen, um Waren zu transportieren. Auf seinen Fahrten ist er aufmerksam und passt sein Tempo den Gegebenheiten an, wie z. B. Steigungen, Abfahrten, Kurven, Signalen, Schildern und eventuell auftauchenden Hindernissen.
So steht er weder unter „Überdruck“, den er auf das Gaspedal überträgt und dadurch wertvolle Energien vergeudet. Noch fährt er mit „Unterdruck“, den er in ein langsames Dahinschleichen umsetzt. Sein Autofahren ist angemessen und stimmig, wenn er die freigesetzten Energien situationsgerecht und verantwortlich für sich selbst, die anderen und für die Umwelt und ihre Zukunft einsetzt.
4.Was ist Beziehung? 4.1.DefinitionGanz allgemein ist Beziehung eine Verbindung, ein Verhältnis zwischen zwei Subjekten, die sich in unterschiedlichen Kommunikationsformen äußern können. Hier geht es vor allem um zwischenmenschliche Beziehungen, die konstitutiv für das Leben des Menschen als soziales Wesen sind. In unserer von Individualismus und Selbstverwirklichung geprägten Zeit wird das Wort „Beziehung“ eher statisch verstanden und lässt die vormals mitgemeinte, dynamische Dimension des „Aufeinander-Beziehens“ mehr in den Hintergrund treten.
Die humanistische Psychologie betont, dass die Entwicklung der Persönlichkeit und das Entstehen von Wertgefühlen nicht zuletzt durch die Begegnung mit anderen geschehen. Rogers z. B. nennt Echtheit, einfühlendes Verstehen und emotionale Wertschätzung als Bedingungen, damit eine Beziehung gelingt. Im Kapitel über Beziehungsstörungen werden wir sehen, wie sehr eine Beziehung von der Dynamik der aufeinander gerichteten Lebensenergien lebt und von einem ausgewogenen Verhältnis von Nähe und Distanz abhängt.
Die christliche Anthropologie betont, dass der „Mensch daraufhin angelegt ist, mit Gott und in ihm die Fülle und Vollendung des Lebens zu finden und zu teilen“. Das tiefste Wesen des Menschen ist also „relativ“ (Greshake, 34), d. h. er steht trotz aller Eigenständigkeit als freies Geschöpf letztlich nicht in sich, sondern er ist und verwirklicht sich in der Beziehung zu Gott und seinen Mitmenschen. Augustinus drückt diese Einsicht treffend aus: „Du hast uns auf Dich hin erschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in Dir.“
Dieses Grundverständnis von Beziehung findet sich heute in der Beziehungstheologie und Beziehungsethik wieder (Pompey 1986, 179 ff.). Der christliche Gott unterscheidet sich von den monotheistischen Vorstellungen dadurch, dass seine letzte Seins-Wirklichkeit in der trinitarischen Beziehung besteht. Es ist eine liebende Beziehung zwischen den drei „Personen“ Vater, Sohn und Geist (1 Joh 4,8), in der alles Heil und jede Erlösung in dieser Welt ihren Ursprung hat. Durch die Erschaffung der Welt und insbesondere des Menschen schafft Gott sich ein „Gegenüber“ und eröffnet somit eine weitere Beziehungsmöglichkeit. Auch den Menschen erschafft Gott als ein Beziehungswesen, das ihm und seiner Beziehungsmöglichkeit ähnlich ist, wie es im ersten Schöpfungsbericht der Bibel beschrieben wird: „Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie“ (Gen 1,27).
Der Mensch ist also auch in seiner Beziehungsfähigkeit Gott ähnlich. Doch der Mensch ist auch frei, dieses Potential anzunehmen und lebensfördernd oder -zerstörend einzusetzen. Da das Wesen dieser Beziehungswirklichkeit des Menschen in Analogie zur innertrinitarischen Beziehung Gottes die Liebe ist, setzt sie Freiheit voraus, „d. h. die Verweigerung der Beziehung, das Nein, muss potentiell immer auch möglich sein, damit das Ja ein echtes Ja ist“ (Pompey 1986, 196). Eine erzwungene Beziehung ist keine liebende Beziehung. Die liebende Beziehung Gottes und des Nächsten ist ohne freie Zustimmung nicht möglich.
Wie die Offenbarungsgeschichte berichtet, misstraute der Mensch seinem Partner Gott, konnte die Liebe zu Gott nicht durchhalten, nicht glauben, dass Gott ihm alle guten Lebensmöglichkeiten der Beziehung zu sich, zum Nächsten, zur Schöpfung bot. „Die Menschen wollten selber erkennen – im Sinne von erfahren und erleben –, was gut und böse für sie ist, und glaubten, Gott hätte ihnen etwas vorenthalten (Gen 3,1–24). Die Folgen dieser Beziehungsstörung zu Gott waren die Beziehungsstörung des Menschen zu sich, zum Nächsten und zur Schöpfung. An dieser Urtat der Menschen wie an den Folgen dieser Urtat haben alle Anteil (Un-Heils-Zusammenhang)“ (Pompey 1986, 196). In der Ablehnung der Beziehung zu Gott und zur eigenen gottähnlichen Beziehungsfähigkeit wurzelt die Sünde, die Schuld und Un-Heil mit sich bringt. Diese fundamentale Beziehungsstörung zu Gott wirkt sich bis heute aus in Feindschaft und Hass, wo Menschen ihre aggressiven Lebensenergien nicht beziehungsstiftend, sondern zerstörend einsetzen, indem sie sich bekämpfen, verletzen und töten.
Trotz dieser existentiellen Beziehungsstörung zwischen Gott und Mensch infolge des Ungehorsams (Gen 3,1 ff.), in dem der Mensch selbstherrlich über seine Lebensenergien entscheidet, blieb Gott dieser Beziehung treu. Er kommt den Menschen in seiner vergebenden Liebe immer wieder neu entgegen. Ihre Krönung findet diese Liebesbeziehung Gottes zu den Menschen und der Schöpfung in der Menschwerdung und in der Erlösung durch Jesus Christus, in dem uns Gott als Mensch konkret erfahrbar wird: „Um die Menschen in den Wurzeln der Beziehungsstörung zu heilen, nimmt er Menschennatur an, wird den Menschen gleich mit Ausnahme der Sünde, d. h. der Beziehungsstörung zu Gott (Hebr 4,15; 2 Kor 5,21; Phil 2,6 ff.). Durch die Menschwerdung – einschließlich aller Beziehungsleiden der Seele und des Leibes, z. B. von den Menschen und von Gott verlassen bis zur Zerstörung seiner Beziehung zum eigenen Leib in Folter und Tod – kommt Gott den Menschen nahe und überwindet in seiner Auferstehung und Himmelfahrt den Beziehungsbruch Mensch – Gott und macht die neue Gottesbeziehung des Menschen deutlich und wieder lebendig“ (Pompey 1981, 97).
Die Beziehung zu Gott ist also nichts Zusätzliches, Akzidentelles im Leben des Menschen. Greshake weist darauf hin, dass „die Beziehung zum Schöpfer, die freilich in Freiheit anerkannt oder verweigert (nicht aber abgeschüttelt) werden kann, den Menschen überhaupt erst zum Menschen“ (Greshake, 34) macht. Die Beziehung des Menschen zu seinem Schöpfergott, der in sich selbst in dreipersönlicher Beziehung lebt und liebt, ist eng verbunden mit der Beziehung zur übrigen Menschheit und Schöpfung. Dieser Gott, der auch seine Geschöpfe, die er nach seinem Bild geschaffen hat, in die Communio des eigenen Lebens einbeziehen will, kann nur gefunden werden, wenn der Mensch diese Communio mit anderen Menschen lebt. So wird die Beziehung zu den anderen Menschen und zur Mitwelt eine verleiblichte Ausdrucksform der Beziehung zu Gott (Greshake, 36).
Im christlichen Sinnhorizont gesprochen, gründet die Aggression als lebens- und beziehungsfördernde Kraft letztlich im Schöpferwillen Gottes, der den Menschen auf Beziehung hin geschaffen und ihn dementsprechend mit einer aggressiven Lebensenergie ausgestattet hat, die auch zum anderen strebt und Beziehung stiftet.
4.2.Der Mensch als eigenständiges und relationales WesenWenn wir das Wesen des Menschen innerhalb seiner Welt betrachten, fällt zuerst seine Eigenständigkeit auf. Er ist ein freies, mit Geist begabtes Einzelwesen, das Selbstständigkeit und Selbstbestimmung besitzt, er ist Person.