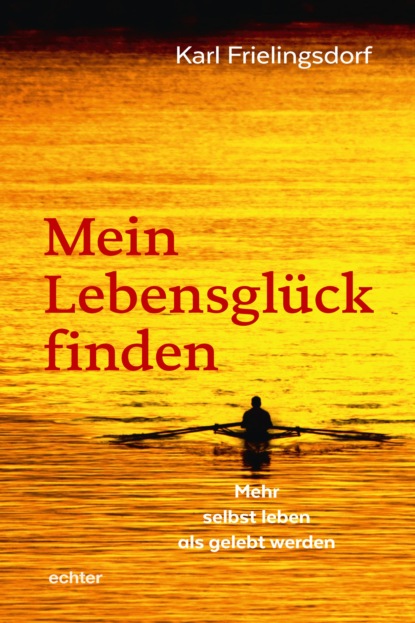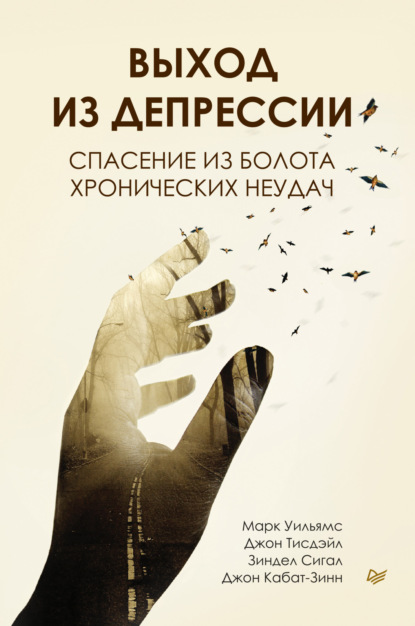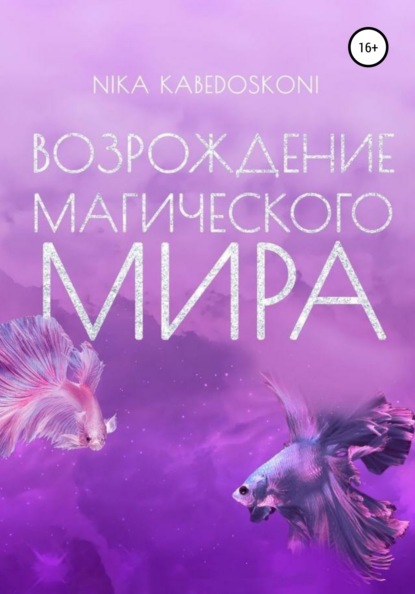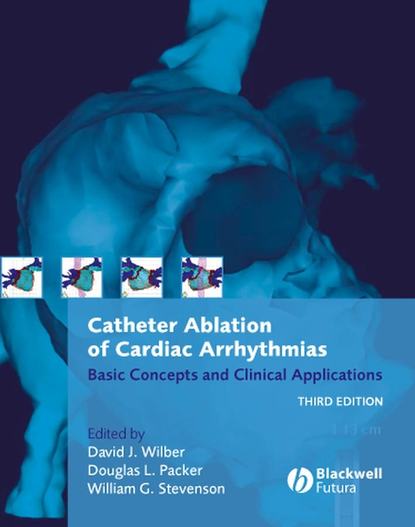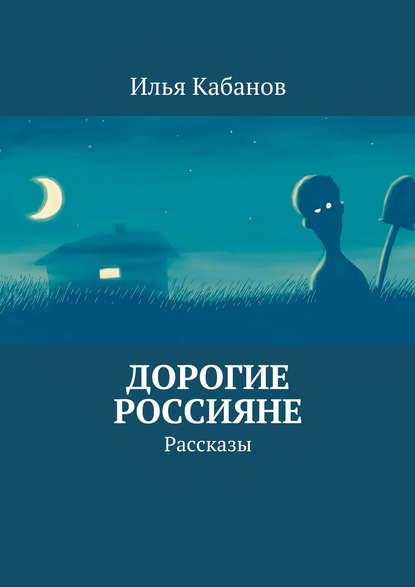- -
- 100%
- +
Serotonin ist eine Gewebshormon und Neurotransmitter, das für unsere innere Zufriedenheit und Ausgeglichenheit verantwortlich ist. Es hellt unsere Grundstimmung, unser Lebensgefühl auf und sorgt dafür, dass unser Nervensystem auf alles gelassener reagieren kann. Vor allem vermindert Serotonin unsere Angstgefühle und wird von Neurobiologen als „Well-Being“ oder als Botenstoff des Wohlbefindens bezeichnet.
Noradrenalin wird als Hormon in den Nebennieren produziert und ins Blut abgegeben. Es ist der Neurotransmitter im Zentral- und im sympathischen Nervensystem. Noradrenalin wirkt über alpha- und beta-Rezeptoren auf die Zielzellen ein. Es ist z.B. verantwortlich für die Aktivierung unseres Organismus und motiviert uns, das Erfreuliche und Angenehme in unserem Leben zu sehen und zu besorgen. Noradrenalin ist weiter für die Gedächtnisbildung, die Schlaf-Wach-Regulation und die körpereigene Schmerzhemmung wichtig und wird als Arzneistoff verwandt. „Ein chronisch zu niedriger Noradrenalinspiegel in den Synapsen des Noradrenalinsystems ist dagegen die zweite neurobiologische Ursache der Depression“ (Hornung, 60f.).
Endorphine sind Botenstoffe des Gehirns, können aber auch Hormone sein, die im Hypothalamus produziert und in den Blutkreislauf ausgeschüttet werden. Sie sind eine Sammelbezeichnung für „eine Gruppe selbstproduzierter Neuropeptide, die im Gehirn aufgebaut werden und Rezeptoren für Morphin und andere Opioide kontaktieren und aktivieren (…) Ihre stark schmerzlindernde Wirkung gleicht der des Opiums der Mohnpflanze. Aber auch wenn wir Stress empfinden und leiden, werden Endorphine ausgeschüttet. Schließlich ist eine erhöhte Endorphinausschüttung mit Trance, Dämmerzustand und genießender Glückseligkeit, aber auch mit schmerzfreier Geburt und dem ‚Runner high‘ (dem angeblichen ‚Hoch‘-Gefühl der Jogger) verbunden“ (Hornung, 62f.).
Zu erwähnen ist noch das Hormon Oxytocin, das aus dem Griechischen übersetzt „Schnelle oder leichte Geburt“ heißt und eine wichtige Bedeutung beim Geburtsprozess hat. Als ein Neuropeptid wird es in der Hirnanhangdrüse (Hypophyse) zwischengespeichert und in den Blutkreislauf ausgeschüttet. Es stärkt das zwischenmenschliche Vertrauen und Zusammenleben sowie die partnerschaftliche Risiko- und Kooperationsbereitschaft. „Liebe, Sex und Treue sind eng miteinander verbunden und Oxytocin ist an der Regulierung der mit ihnen deckungsgleich einhergehenden Gefühle beteiligt. Ohne Oxytocin im Gehirn gibt es kein Verliebtsein, keine Zärtlichkeiten und keine Partnertreue. Vor allem aber würde eine der wichtigsten Voraussetzungen für alles menschliche Miteinander fehlen: zwischenmenschliches Vertrauen. Wegen seiner komplexen Auswirkungen auf menschliche Beziehungen wird Oxytocin deshalb manchmal auch das ‚Vertrauens-, Kuschel-, Liebes-, Treue- und Sexhormon‘ genannt“ (Hornung 64f.).
Mehr Informationen über die jüngsten Ergebnisse der Psycho-Neurobiologie finden Sie im 2. Kapitel über „Die Bedeutung der Kindheit für ein geglücktes Leben“.
2. Das Schicksal oder ich – wer bestimmt mein Glück?
Bevor wir die Frage nach dem Glück stellen, wie man glücklich wird und was ein geglücktes Leben ausmacht, müssen wir klären, ob wir überhaupt unser Glück bestimmen können oder ob wir dem Glück bzw. dem Unglück nicht ausgeliefert sind. Kann ich tatsächlich mein Leben selbst bestimmen und in Freiheit Entscheidungen treffen? Bin ich nicht wie alle Menschen den globalen Schicksalsschlägen wie Erdbeben, Tsunamis, Unfällen in Atomkraftwerken, Sturmfluten, Terroranschlägen oder Kriegen mit ihren Folgen ohnmächtig ausgeliefert? Oder muss ich nicht auch im privaten Leben Krankheiten, Unglück, Missbrauch, Hass, Krisen und anderes über mich ergehen lassen? Schlägt das Schicksal nicht einfach willkürlich zu, ohne dass ich etwas dagegen oder dafür tun kann?
Zunächst stellt sich die Frage, was wir unter „Schicksal“ und „Freiheit“ verstehen.
„Schicksal wird in der Regel als etwas verstanden, das sich einfach ereignet, das uns zugemutet wird, das über uns herfällt. Wir sind ihm ausgesetzt, können nichts dagegen tun. Für den einen ereignet es sich ohne einen bestimmten Grund. Für einen anderen geht es auf den Einfluss einer höheren Macht oder von höheren Mächten zurück, die geheimnisvoll, undurchschaubar auf unser Leben einwirken. Die menschliche Freiheit scheint (…) angesichts des Schicksals wie ausgelöscht, hat keine oder kaum eine Chance, zum Einsatz zu kommen oder muss vor dem Schicksal kapitulieren“ (Müller, 10f.).
Im Altertum wird dieses Schicksal „fatum“ genannt, ein anonymes Etwas, das willkürlich ohne Gründe auf jedes Leben einwirkt. Dieses Verständnis von „Schicksalsschlägen“ ist meist mit tragischen Ereignissen verbunden, die unausweichlich und unwiderruflich über uns kommen, Gegebenheiten, in die wir hineingeboren oder -geworfen werden, ohne dass wir eine Möglichkeit der Abwehr oder des Eingreifens hätten. Diese Auffassung vom blinden Schicksal kommt im englischen „Fate“ zum Ausdruck.
In unserer Zeit begegnen wir dieser Weltanschauung u. a. im Determinismus von Sigmund Freud oder bei dem Begründer der existentiellen Psychotherapie Irvin Yalom und seinen Schülern. Für sie sind wir Menschen ein Zufallsprodukt: „Das Leben im Allgemeinen und unser menschliches Leben im Besonderen ist aus Zufallsereignissen entstanden. (…) Wir sind auf uns allein angewiesen, und so hängt es ausschließlich von uns ab, was wir aus unserem Leben machen und wie wir es gestalten“ (Yalom, 2010, 193f.). „Aus deterministischer Sicht sind die Bewegungen des menschlichen Willens nicht frei im Sinn der Wahlfreiheit, sondern im Voraus zu dieser Freiheit durch von außen einwirkende Motive oder von inneren Ursachen (psychischen Zuständen) eindeutig festgelegt“ (Vorgrimler, Neues theologisches Wörterbuch, 2000, 127).
W. Müller weist darauf hin, dass diese deterministische Haltung nicht typisch für die Psychoanalyse ist. Psychoanalytiker wie E. Erikson, C. Rogers, A. Maslow oder F. Perls sind sehr wohl offen für das Geheimnisvolle, für geheimnisvolle Kräfte oder eine höhere Macht in ihrer Betrachtung des Schicksals (Müller, 19ff.).
Im Denken von C. G. Jung spielen Schicksal und das Geheimnisvolle eine große Rolle. Für ihn haben die Menschen ein Geheimnis „und die Ahnung von etwas Wissbarem. Es erfüllt das Leben mit etwas Unpersönlichem, einem Numinosum … Der Mensch muss spüren, dass er in einer Welt lebt, die in einer gewissen Hinsicht geheimnisvoll ist, dass in ihr Dinge geschehen und erfahren werden können, die unerklärbar bleiben … Das Unerwartete und das Unerhörte gehören in diese Welt“ (C. G. Jung, 1990, 358).
Aber bei all diesen Überlegungen bleibt die Frage: Inwieweit sind wir überhaupt frei in unseren Entscheidungen? Gibt es nicht viele Lebensbereiche, die uns vorgegeben sind? Wir werden in einem Kontinent, in einem Land, in einer Gesellschaft und Kultur, in einer Familie geboren, die wir nicht wählen konnten. Unsere Gene enthalten physische und psychische Anlagen, die zunächst einfach da sind und die sich dann weiterentfalten wie: Gesundheit, Begabungen, Intelligenz, oder Persönlichkeitsprofil. Die pränatalen und perinatalen Elternbotschaften und die Vorstellungen und gesellschaftlichen Normen unserer Umgebung haben uns ebenso geprägt wie die Erwartungen, die z.B. in der Familie, in der Schule und im Beruf an uns gestellt wurden.
Im Neuen Theologischen Wörterbuch heißt es: „Grundsätzlich ist der Mensch von allem anderen in seiner Umwelt dadurch unterschieden, dass der Naturzusammenhang, in dem er existiert wie alles andere, ihn im Vollzug seines menschlichen Wesens nicht durchgängig und restlos determiniert. Das heißt: Er ist ins ‚Offene‘ gesetzt; es ist ihm aufgegeben, selbst die verschiedenen geschichtlichen Möglichkeiten zu verwirklichen (durch Wahl der Lebensform, des Berufs, durch Arbeit usw.) und darin seine Wesensausprägung zu finden“ (Vorgrimler, 197f.). So gibt es viele Bereiche in unserem Leben, die uns vorgegeben sind und in denen wir uns eingeschränkt fühlen. Und doch sind wir von unserem Wesen her frei und grundsätzlich autonom darin, wie wir Begrenzungen und Einschränkungen gestalten. Das beginnt mit unseren kleinen Entscheidungen im Alltag, wenn wir uns entschließen, in die Stadt zu gehen oder nicht, einen Besuch zu machen oder nicht, einen Anruf zu machen oder nicht, den Arzt aufzusuchen oder nicht usw. Das gilt auch für grundsätzliche Entscheidungen.
Für Romano Guardini ist der Mensch frei und bestimmt selbst sein Schicksal: Denn immer wieder „bestimme ich das scheinbar objektiv an mich Herantretende mit, wähle aus den Möglichkeiten des Geschehens einzelne heraus, rufe und lenke sie. So ist das Schicksal das aus der Fremdheit der Welt über mich Kommende, anderseits wieder das Verwandte, ja Eigene …“ (Guardini, 1948, 215).
Paul Tillich schreibt zu demselben Thema: Ich muss mich entscheiden, ob ich mich dem Schicksal überlasse oder nicht. Mit dieser Entscheidung trage ich zur Verwirklichung meines Schicksals bei, das für mich dann nicht länger „eine Macht ist, die entscheidet, was mir passiert. Dann bin ich es selbst, so wie ich bin, wie ich von der Natur, der Geschichte und mir selbst geformt wurde. Mein Schicksal ist die Basis meiner Freiheit; meine Freiheit trägt dazu bei, mein Schicksal zu formen“ (Tillich, 216).
Uns sind also viele Begabungen vorgegeben, doch was wir aus ihnen machen, das hängt auch von uns ab. Für die Einzelnen kommt es darauf an, auf der Basis der Vorgegebenheiten, des Schicksals oder des bisher So-geworden-Seins, die Entscheidungen zu treffen, die ihnen möglich sind. „Wir entscheiden nicht über die politischen und kulturellen Gegebenheiten, in die wir hinein geboren werden, doch wir sind ihnen nicht einfach nur ausgeliefert, sondern können durch Wahlen, Aktionen usw. auf sie reagieren und damit unsere Freiheit umsetzen“ (Müller, 31).
Darüber hinaus gibt es eine existentielle Freiheit, die im Innern eines jeden Menschen verankert ist. May nennt sie die innere Freiheit, die von den äußeren Einschränkungen nicht tangiert wird und die sich in unserer Einstellung zu vorgegebenen Situationen zeigt. Der Benediktiner Sales Hess schreibt in seinem Buch „Dachau – eine Welt ohne Gott“ über seine Erfahrungen im KZ Dachau: „Was konnten diese Menschen ohne Gott uns antun? Sie konnten wohl den Leib aushungern und töten, aber der Seele konnten sie nicht schaden“ (Hess, 124). Dieser innerste Teil des Menschen, die Seele, ist unzerstörbar und für gläubige Menschen eingebettet und aufgehoben in einem tiefen Gottvertrauen. Ohne äußere Freiheit kann ein Mensch leben, aber nicht ohne die innere, existentielle Freiheit. „Bin ich in Berührung mit dem Zentrum meiner absoluten Freiheit, die grenzenlos und unverfügbar ist, erwächst mir daraus eine große Unabhängigkeit. Und das inmitten einer Welt, einer persönlichen und gesellschaftlichen, die mich an tausend Stellen und Orten einschränkt, in Freiheit zu handeln. Doch diese Welt vermag den Bereich meiner existentiellen Freiheit nicht zu berühren, gar zu beeinflussen“ (Müller, 143).
Ebenso wichtig ist, dass ich nicht in der Auflehnung gegen mein Schicksal verharre, sondern dass ich mich mit ihm auseinandersetze, dass ich versuche, einen Sinn darin zu entdecken, und dann gleichsam mit dem Schicksal kooperiere. Denn der „Bestand der jeweiligen Situation wie der Zusammenhang des Lebensganzen sind ja nicht starr. Sie bestehen (…) nicht nur aus Notwendigkeiten, denen der Mensch sich fügen muss, sondern auch aus Tatsachen, an denen die Freiheit des Menschen ansetzen kann: aus Kräften, die er lenken, aus Zuständen, die er formen, aus Fließendem, das er zusammenhalten, aus Hindernissen, die er überwinden kann“ (Guardini, 227).
Wenn wir unserem Schicksal nicht ohnmächtig ausgeliefert sind, sondern eine äußere und innere Freiheit haben, dieses Schicksal mitzugestalten, dann beginnt aber auch unsere Verantwortung für unser Schicksal. Dies bedeutet, dass wir unser vergangenes Leben anschauen, wer und was uns negativ und positiv geprägt und geformt hat, welche unbewussten und bewussten Elemente und Vorstellungen unser Leben bis heute beeinflussen. Sonst besteht die Gefahr, dass wir von dem in unserem Leben Vorgegebenen unbewusst bestimmt werden und so letztlich mehr gelebt werden als selbstbestimmt leben. Wir haben die Freiheit und Verantwortung, uns dieser Aufgabe zu stellen, obwohl uns „angesichts dieser Freiheit schwindelig werden kann“ wie Kierkegaard einmal sagt. Doch es bleibt uns letztlich nichts anderes übrig, als uns dieser Verantwortung zu stellen. Selbst wenn wir uns nicht entscheiden, haben wir die Entscheidung getroffen, uns nicht zu entscheiden, und wir haben „die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, zu verantworten. Wir können dieser Verantwortung, dieser Freiheit, nicht aus dem Wege gehen“ (Müller, 44).
In diesem Wechselspiel von Schicksal und Bestimmung sowie Freiheit und Verantwortung stellt sich die Frage nach einer Instanz, die unsere Wünsche, Überlegungen und Erkenntnisse in Handeln umsetzt und zu Taten macht. Dabei schließen wir die deterministische Lösung von S. Freud aus, wo das Unbewusste mehr oder weniger unser Leben bestimmt und für die Freiheit kein Raum ist. Wir nennen diese Instanz in uns „Zentrum des Willens“, „Sitz der Willenskraft“ oder „geistige Instanz“. Im Willen wird die Fähigkeit des Menschen verwirklicht, „als Person ein als Wert erkanntes Ziel aktiv anzustreben, und falls dieses Ziel mit anderen möglichen Zielen kollidiert, diese in Freiheit abzulehnen oder zurückzustellen“ (Vorgrimler, 679f.).
So ist der Wille die Triebfeder unseres Handelns. Die Willenskraft ist es, mit der wir unser Leben gestalten und verändern können. Bevor wir aber unsere Willenskraft einsetzen und für die Gestaltung unseres Lebens nutzen können, müssen wir wissen, was wir wollen, welche Ziele wir für unser Leben haben. Wenn mein Wunsch klar ist, kann mein Wille mein Tun und Handeln so anregen und lenken, dass dieses Ziel erreicht wird. Rollo May beschreibt das Verhältnis von Wunsch und Wille so:
„Dem Wunsch verdankt der Wille die Wärme, den Inhalt, die Einbildungskraft, das Spielerische, die Frische und den Reichtum. Der Wunsch verdankt dem Willen die Selbststeuerung und die Reife. Der Wille schützt den Wunsch und ermöglicht es ihm weiter zu existieren, ohne zu große Risiken einzugehen. Aber ohne Wunsch verliert der Wille seine Vitalität und Lebensfähigkeit … Wenn man nur Wille und keinen Wunsch hat, dann hat man es mit dem vertrockneten, viktorianischen, neopuritanischen Menschen zu tun. Wenn nur ein Wunsch und kein Wille vorhanden sind, dann hat man den zwanghaften, unfreien, kindlichen Menschen vor sich, der als infantil gebliebener Erwachsener zum Roboter werden kann“ (May, 1969, 218).
Es erfordert Mut und Vertrauen, sich auf diese Auseinandersetzung mit dem Schicksal, mit dem eigenen Leben einzulassen: mit allem, was mich ausmacht, meinem bewussten und unbewussten Ich, meinem Selbst, mit dem inneren Kern meiner Person. Das wird am ehesten gelingen, „wenn ich aus der Tiefe meines Seins heraus in Beziehung trete zu meinem Leben. Ich weiß dann um meine Angst vor der Freiheit, ich blende mein Schicksal und meine Bestimmung nicht aus meinem Leben aus, sondern gehe mit diesem Wissen und dieser Erfahrung auf mein Leben zu … Wir bleiben nicht länger an der Außenseite stehen, betrachten und beurteilen unsere Probleme nicht nur oberflächlich. Wir dringen jetzt tiefer in sie ein, gehen sie grundsätzlicher, von unserem Kern her, an. Wir stellen uns dann der Aufgabe, die sich für uns daraus ergibt, die Verantwortung für unser Leben zu übernehmen“ (Müller, 87f.).
Für den christgläubigen Menschen ist das Schicksal kein blindes Fatum. Gott hat die Menschen „gut“ geschaffen nach seinem göttlichen Bild und Gleichnis und er hat seinen göttlichen Lebensatem in sie gelegt. Und Gott hat ihm die Schöpfung anvertraut. In Jesus hat Gott unser menschliches Schicksal angenommen und ist uns in unserem Menschsein in allem gleich geworden, außer der Sünde.
Nach christlichem Glauben liegt unser Schicksal in der Hand Gottes und ist in seiner Liebe letztlich gut aufgehoben (Jes 43,1ff.; Joh 15,9ff.). Wenn wir uns darauf einlassen und vertrauen, dann können wir unser Schicksal, so weit möglich, selbst in die Hand nehmen. „Wir sind der Kapitän unseres Lebensschiffes, übernehmen das Steuer und geben die Richtung vor. Wir tun das auch bei stürmischer See, im Wissen, dass es Situationen gibt, bei denen wir nur noch beten und uns dem Schicksal überlassen können. Das hält uns aber nicht davon ab, bis zum Schluss alle in uns vorhandenen Kräfte und alle uns gegebenen Möglichkeiten zu nutzen“ (Müller, 135). Je mehr wir unser Leben Gott überlassen, desto mehr können wir ohne Angst unser Leben wagen und glücklich werden.
Abschließen möchte ich dieses Kapitel mit einer Geschichte, die mir und vielen Menschen geholfen hat, heilsamer und fruchtbarer mit dem eigenen Schicksal umzugehen.
„Eine chinesische Geschichte erzählt von einem alten Bauern, der ein altes Pferd für die Feldarbeit hatte. Eines Tages entfloh das Pferd in die Berge, und als die Nachbarn des Bauern sein Pech bedauerten, antwortete der Bauer: ‚Pech? Glück? Wer weiß‘. Eine Woche später kehrte das Pferd mit einer Herde Wildpferde aus den Bergen zurück, und diesmal gratulierten die Nachbarn dem Bauern wegen seines Glücks. Seine Antwort: ‚Glück oder Pech? Wer weiß‘. Als der Sohn des Bauern versuchte, eines der Wildpferde zu zähmen, fiel er vom Rücken des Pferdes und brach sich ein Bein. Jeder hielt das für ein großes Pech. Nicht jedoch der Bauer, der nur sagte: ‚Pech? Glück? Wer weiß?‘ Ein paar Wochen später marschierte die Armee ins Dorf und zog jeden tauglichen jungen Mann ein, den sie finden konnten. Als sie den Bauersohn mit seinem gebrochenen Bein sahen, ließen sie ihn zurück. War das nun Glück oder Pech? Wer weiß?
Was an der Oberfläche wie etwas Schlechtes, Nachteiliges, aussieht, kann sich als etwas Gutes herausstellen. Und alles, was an der Oberfläche gut erscheint, kann in Wirklichkeit etwas Böses sein. Wir sind dann weise, wenn wir Gott die Entscheidung überlassen, was Glück oder Unglück ist; wenn wir ihm danken, dass für jene, die ihn lieben, alles zum Besten gedeiht. Dann werden wir ein wenig an der wunderbaren mystischen Vision der Juliana von Norwich teilhaben, die einen Ausspruch tat, der mir von allen, die ich je gelesen habe, der liebste und tröstlichste ist: ‚Und alles wird gut sein; und alles wird gut sein; und alle Dinge, die es gibt, werden gut sein“ (de Mello, 1984, 182f.).
3. Der Urwunsch des Menschen nach einem „glücklichen Leben“
In den alten Traditionen der Menschheit finden sich Aussagen über Grundbedingungen menschlichen Lebens, die in Sagen, Mythen, religiösen Schriften, aber auch in modernen Studien der Psychologie und Soziologie festgehalten sind: Jeder Mensch hat in seinem innersten Wesen Grundhoffnungen, Antriebe und Urwünsche nach einem Leben in Glück, Frieden, Freiheit und Liebe.
Die Sehnsucht nach einem glücklichen Leben ist offensichtlich ein Urwunsch des Menschen (Horn, 24ff.). Ein „glückliches Leben“ ist für ihn eine faszinierende Vorstellung, ein Zauberwort, ein Sehnsuchtswort. Wenn es einen Wunsch gibt, in dem sich die Menschen aller Völker und Rassen einig sind und immer einig waren, dann ist es der Wunsch, glücklich zu leben, glücklich zu sein. Glück ist das kostbarste Gut des Menschen, und nicht zuletzt aus diesem Grund ist es sehr zerbrechlich. „Glück und Glas, wie leicht bricht das.“
In dem Urwunsch nach einem glücklichen Leben erkennt Zulehner eine Lebens-Trias: Zu einem glücklichen Leben „gehört demnach die Erfahrung, einen Namen zu haben, wachsen zu können und Wurzeln zu schlagen“ (Zulehner, 1983, 15ff.).
Der erste Urwunsch nach einem Namen beinhaltet: nicht austauschbar, einzigartig sein, Ansehen haben, lieben und geliebt werden, erkannt und anerkannt werden, nicht missbraucht werden.
Der zweite Urwunsch nach Macht bedeutet: Selbst etwas machen können, Selbst-Mächtigkeit, aber auch Bewegung, wachsen in Freiheit; sich schöpferisch entfalten können. Wachsen heißt lebendig sein.
Der dritte Urwunsch nach Heimat und Geborgenheit meint: Dazugehören und zu Hause sein; einen Ort der Verwurzelung finden; einen letzten Halt haben.
Diese Urwünsche gehören zum menschlichen Leben, unabhängig von bestimmten Religionen und Weltanschauungen. Jedoch gestaltet die jeweilige Kultur den Umgang mit den Urwünschen und bestimmt damit auch, ob das Leben gut und glücklich ist oder nicht.
Grundsätzlich gibt es kulturübergreifend einen positiven und einen negativen Umgang mit den Urwünschen und der Begrenzung ihrer Erfüllbarkeit. Dies zeigt sich am Beispiel des Umgangs mit dem Urwunsch nach Macht darin, dass ein positiver Umgang mit Macht zu einem größeren Selbst- und Freiheitsbewusstsein, zu Eigenständigkeit und Anpassungsfähigkeit führt. Ein negativer Umgang mit dem Urwunsch nach Macht kann zu egoistischer Geltungs- und Herrschsucht führen, die das eigene oder fremde Leben beeinträchtigen oder gar zerstören.
Die Urwünsche sind in ihrer Tiefe auf eine Erfüllung außerhalb der Grenze von Raum und Zeit gerichtet: auf eine transzendente Erfüllung. Wer kennt nicht die Maßlosigkeit des Sehnens, wenn „Sternstunden“ (von Liebe, Macht, Beheimatung) wie Momente der Erfüllung erscheinen und im nächsten Augenblick nur mehr Erinnerung sind? So sehr in solchen Augenblicken die Urwünsche befriedigt werden, es bleibt ein schaler Geschmack des „Noch-nicht“ und des „Noch-mehr“ zurück. In einer solchen Befriedigung von Liebe, Macht und Geborgenheit, die immanent an Zeit und Raum gebunden geschieht, erfahren Menschen ein Stück gutes, ganzes Leben. Es ist aber nur ein Stück von einem sinnvollen und glücklichen Leben, das sie nicht nur teilweise, sondern ganz erleben möchten. Diese letztlich erfüllte Sehnsucht nennen wir im Glauben das „ewige Leben“, wo das Sehnen des menschlichen Herzens zur Ruhe kommt. Hier werden wir erfahren, dass Gott selbst unseren Namen ins Buch des Lebens geschrieben und damit ein Leben in Fülle für uns bereitet hat. Da der Mensch aber an Zeit und Raum gebunden ist, geraten wir immer wieder in die Spannung zwischen unseren grenzenlosen, unendlichen Wünschen nach einem glücklichen Leben und der begrenzten Befriedigung im konkreten Leben.
Diese Enttäuschung wird „leibhaftig“ in folgender Beziehungsskulptur deutlich. In dieser Übung bitte ich z.B. Ehepartner, ihre Idealvorstellung von der Beziehung zwischen Mann und Frau in einer Skulptur darzustellen, in der alle Wünsche nach Nähe, Geborgenheit, Wärme, Liebe und Sexualität erfüllt sind. Meist wird eine Gestalt gewählt, in der die beiden Partner sich umarmen. Wenn aber der Kopf des einen auf der Schulter des anderen liegt, schauen das Gesicht und insbesondere die Augen, die für eine Beziehung so wichtig sind, über die Schultern des Partners hinweg. Wohin? Häufige Antworten: in die Ferne, irgendwohin, auf einen anderen Menschen, in die Zukunft, auf Gott. Das Sehen, das Anschauen, die Kommunikation mit den Augen sind in dieser „idealen“ engen Beziehung nicht möglich, da die Augen über die Schultern des Partners hinwegsehen. Es fehlt die nötige Distanz, die von einer zu großen Nähe abgrenzt und eine Begegnung auf Augenhöhe ermöglicht. Das wird noch deutlicher, wenn einer oder beide in der Umarmung „Fortschritte“ machen und auf das eigene Lebensziel zugehen wollen. Wenn einer nach vorn geht, muss der andere Partner rückwärtsgehen. Beide behindern sich in dieser Nähe am Gehen auf ihrem je eigenen Weg. Um den eigenen Weg gehen zu können, müssen sie die einengende Nähe in der Umarmung aufgeben, die an eine „Paaridentität“ erinnert, und sich an die Seite des Partners stellen mit dem Blick auf ein gemeinsames Ziel.
Wie aber können wir mit diesem schmerzlichen Missverhältnis zwischen den unendlichen Wünschen und ihrer begrenzten Erfüllung glücklich leben? Hier scheiden sich die Geister. Die unterschiedlichen Lebensanschauungen lösen das Problem entweder immanent, d. h., sie versuchen, die Unendlichkeit und Unbegrenztheit der Urwünsche samt ihrer Erfüllung in den irdisch-menschlichen Bereich zu verlegen; oder aber sie wählen die transzendente Lösung, wie z.B. den christlichen Glauben, der die letzte Erfüllung der menschlichen Grundbedürfnisse im ewigen Leben bei Gott sieht.
Was heißt das konkret? Wenn der Mensch sich selbst zur letzten Instanz macht, verliert die Frage nach der Erfüllbarkeit der Urwünsche ihre transzendente und geheimnisvolle Dimension. Der Mensch selbst übernimmt jetzt die ganze Verantwortung für das Leben und die Erfüllung aller Lebensbedürfnisse und Urwünsche, auch der „unendlichen“, und entscheidet, was diesem Ziel dient und was nicht. Er macht sich zum „Herrn über Leben und Tod“. Zumindest setzt er sich diesem alles fordernden Anspruch aus.