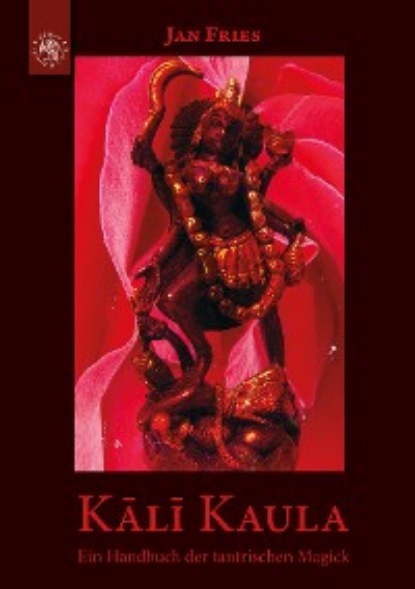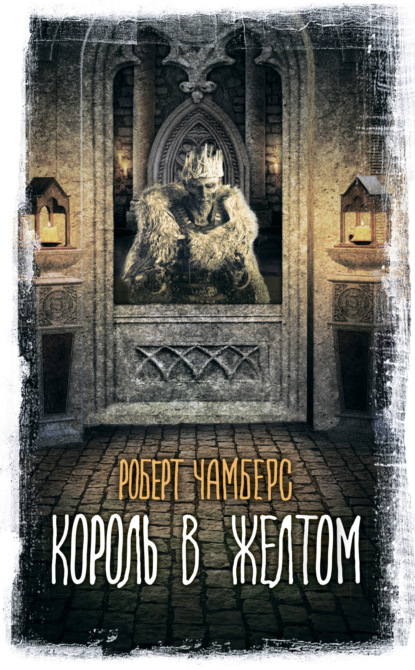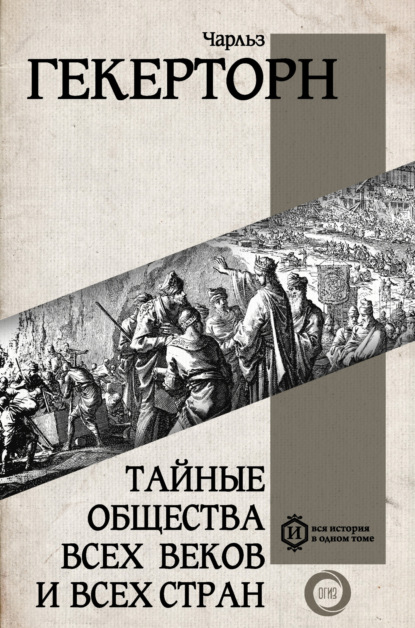- -
- 100%
- +
Für manche Autoren blieben die Anderswelten bestehen, aber sie wurden lediglich zu Übergangspunkten. Zum Beispiel erklärt die Kauṣītakī Brāhmaṇa Upaniṣad 1, 2, dass die Seelen nach dem Tod zum Mond gehen. Jene, die den Mond als Himmelstür verstehen und wissen, ‘wie man darauf antwortet’, können zu den höheren Reichen aufsteigen. Diejenigen, die es nicht können, kehren als Regen zur Erde zurück und werden als Tiere oder Menschen wiedergeboren. Damit sind wir am Anfang eines von mehreren Wiedergeburtsmodellen. Die Upaniṣaden entwickelten das Thema immer weiter; sie hatten noch nicht den Konsens erreicht, der im frühen Hinduismus auftauchte. Wie die Idee der Wiedergeburt auch immer aufkam, sie war sicher nützlich. Einerseits nahm sie den Gläubigen viel von der Angst vor dem Tod. Andererseits stabilisierte sie die gesellschaftliche Ordnung.
In einer Gesellschaft, die immer starrer wurde, muss sich so mancher gefragt haben, was für einen Sinn das alles haben sollte. Eine feste Unterteilung in Klassen ist nun mal eine Sache, die viele ganz schön unfair trifft. Vielleicht ist die Idee, dass die Dinge im nächsten Leben besser werden, ein kleiner Trost für diejenigen, die unten am Boden sind. Dasselbe kann man über die Idee sagen, dass Dein gegenwärtiges Elend kein Schicksal, sondern Deine eigene Schuld ist. In diesem Sinne wurde die Reinkarnation zu einem bequemen Beruhigungsmittel für diejenigen, die mit dem Klassensystem unglücklich waren. Gleichzeitig fühlten sich die Reichen und Mächtigen dadurch geschmeichelt, denn schließlich hatten sie sich ihren Wohlstand ja in anderen Leben durch gute Taten verdient. Der Wiedergeburtsglauben lieferte eine Philosophie, die die Leute mehr oder weniger dort hielt, wo sie sein sollten. Diese Denkweise verringert die soziale Unruhe und wird von der Regierung allgemein gefördert.
Die älteren Upaniṣaden führten die Idee ein, dass alle Taten Auswirkungen haben. Dasselbe gilt für das Nichttun: Was immer Du tust oder zu tun vermeidest, beeinflusst die Welt. Wenn Wesen durch das Leben gehen, erzeugen sie Karman. Karman bedeutet Handeln, Tun, Wirken und die Ergebnisse von Taten. Diese einfache Beobachtung hatte einen radikalen Charakter. In der frühen vedischen Epoche hielt man das menschliche Schicksal für abhängig von angemessenen Ritualen, Opferungen, Zaubersprüchen und dem guten Verhältnis zu Göttern und Priestern. Die Menschen konnten etwas tun, um ein böses Schicksal abzuwenden, sie konnten von Unglück und Sünden der Vergangenheit durch die richtigen Rituale erlöst werden. Selbst ein grausiges Schicksal nach dem Tod, den drohenden zweiten Tod (Punarmṛtyu), konnte durch die richtigen Opferungen abgewendet werden. Karman setzte all dem ein Ende. Die erste Erkenntnis der karmischen Philosophie besagt, dass die Menschen für sich selbst verantwortlich sind. Was nach dem Tod geschieht, hängt vom richtigen Verhalten im Leben ab. Karman wurde jetzt als subtiler Einfluss betrachtet, der sich der individuellen Seele (Ātman) im Laufe des Lebens anfügt und die nächste Geburt beeinflusst. So kann einen Karman Leben um Leben verfolgen. Wenn Du jetzt ein gutes Leben genießt, dann kommt das von dem Karman, das Du in den letzten Leben entwickelt hast, abhängig von deinem Verhalten in diesen. Karman war nicht nur eine abstrakte Qualität, ein Kausalitätsgesetz, sondern es wurde manchmal auch zu einem moralischen Prinzip. Hier waren sich die Seher alles andere als einig. Manche hielten Ethik für ein bedeutendes Prinzip, und andere wollten sie so weit wie möglich ignorieren. Schauen wir uns beide Möglichkeiten an: gute und böse Taten (was auch immer das sein soll) erzeugen gleichermaßen Karman, und Karman, egal ob gut oder schlecht, impliziert Bindung an die Welt der Dinge und Illusionen. Die war natürlich ein Hindernis, wenn man sich gerne ins Brahman auflösen wollte. Nach Ansicht mancher Seher galt es also, sowohl gute wie böse Taten zu vermeiden. Das ist nicht ganz das, was moderne Hindus, ganz zu schweigen von New-Age-Anhängern oder Theosophen, unter Karman verstehen. Im Denken vieler Leute ist Karman so etwas wie ein Bankkonto. Gute Taten erhöhen den Betrag auf dem Konto, schlechte Taten verringern ihn, und wenn man genügend Bonuspunkte gesammelt hat, kann man heilig werden oder sich komplett aus der Existenz ausklinken. Der Schwachpunkt in dieser gesellschaftlichen Philosophie ist die Unterscheidung zwischen guten und schlechten Taten. Gut und schlecht sind Bewertungskategorien, die vom individuellen Standpunkt abhängen und für sich keine eigene Existenz haben. Gute Taten müssen nicht unbedingt zu guten Ergebnissen führen, schlechte Taten und Sünden müssen nicht unbedingt für jeden schädlich sein. Tatsächlich ist Gutes oft die Wurzel von Schlechtem und umgekehrt: es kommt immer drauf an, für wen. Und allein, dass Deine Absichten gut sind, bedeutet nicht, dass Deine Taten Gutes bewirken. Die MuUp 1, 2, 7-11 verspottet solche Aktivitäten wie richtiges Sozialverhalten, gute Taten, Kultivierung von Wissen, Durchführung von Ritualen, Opferungen und die Erlangung von Verdiensten als nutzlos. Stattdessen erklärt sie das Leben des waldbewohnenden Bettelmönchs zum Weg der Befreiung.
In der Philosophie der Upaniṣaden wurde die Idee des Karman erst entwickelt, und unsere Quellen stimmen nicht miteinander überein. Manche sahen das Karman als ein abstraktes Prinzip (das Gesetz der Kausalität, wenn man so will), während andere es primär zu einem moralischen Prinzip machten. Wir begegnen sogar der Ansicht, dass das Karman eines Vaters auf den Sohn vererbt wird (Kauṣītaki Brāhmaṇa Upaniṣad 2, 15), aber diese wurde nie wirklich populär. Von Bedeutung für die Epoche der Upaniṣaden ist die Idee, dass alles Karman, egal ob gut oder schlecht, zu einer Bindung an die Welt führt. Eine Befreiung von dieser Bindung war für diejenigen möglich, die es schafften, ihr menschliches Selbst (Ātman) mit dem All-Selbst, Brahman, zu verschmelzen. Diese Ansicht verwandelte die ganze religiöse Landschaft.
Alle Wesen erzeugen zu allen Zeiten Karman, ob sie es wollen oder nicht, und dies schließt auch die Götter ein. Wenn die Götter in den Fesseln des Karmans gefangen sind, dann sind sie nicht mehr frei, ihre göttliche Macht auszuüben, wie sie es gewohnt sind. Dies setzte dem vedischen Glauben ein Ende, dass die Götter Übeltäter bestraften. Der allsehende Varuṇa, der keulenschwingende, donnernde Indra, die Gottheiten von Gesetz und Ordnung verloren einfach ihre Funktion. Wenn jemand Böses tat, dann wurde einfach das Karman der Tat die Strafe. Die Götter hatten nichts damit zu tun, es sei denn, es war ihr Karman, eine Bestrafung zu veranlassen, die das Karman des Übeltäters verursacht hatte. Göttliche Belohnungen waren ebenso nur möglich, wenn das Karman des Belohnten es erlaubte. Kurz gesagt, verloren die Götter mit der Etablierung der Prinzipien von Karman und Wiedergeburt viel von ihrer Bedeutung. Tatsächlich erklären manche Texte wie die BāUp 1, 4, 10:
Wer immer das ‘Ich bin Brahman’ kennt, wird dieses Alles. Selbst die Götter können das nicht verhindern, denn er wird ihr Selbst. Wer immer also eine andere Gottheit (als sich selbst) verehrt, in dem Gedanken, dass er einer und (Brahman) ein anderes ist, kennt es nicht. Er ist für die Götter wie ein Tier.
So wie sich die Menschen von Tieren ernähren, so ernähren sich die Götter von ignoranten Anhängern. Die noch immer durchgeführten rituellen Opferungen wurden von vielen heiligen Philosophen verspottet. Sie erklärten, dass Befreiung statt durch Ritualismus durch die direkte Erfahrung von Brahman zu finden ist. Dies ist das Wissen, das vom Bösen befreit, das alle Fesseln löst, dies ist der Weg, der aller Ethik überlegen ist. Die Autoren der frühen Upaniṣaden hatten gelegentlich ein wenig für Ethik übrig, aber sie betonten wiederholt, dass Befreiung etwas ist, was jenseits sämtlicher ethischer Werte liegt. Es geht nicht darum, Gutes oder Böses zu tun, der Trick besteht darin, das ganze Spiel zu verlassen – und alles andere auch. Nun sieht die Idee des Karman etwas pessimistisch aus. Das war nicht von Anfang an so. Die Īśa Upaniṣad erklärt, obwohl Fesselung die Norm ist, dass Befreiung für all diejenigen möglich ist, die ihre Bindung an die Welt abbrechen. Wir befinden uns hier am Beginn einer neuen Bewegung: Aus jener Zeit gibt es Belege für wachsende Gemeinschaften von waldbewohnenden Asketen, nackten Aussteigern und wandernden Bettelmönchen aller Art, Leuten, die den Werten der Gesellschaft Lebewohl gesagt haben. Hinzu kamen Menschen, die ihre weltlichen Verpflichtungen erfüllt hatten, und zum Lebensende Befreiung suchten. Während manche Texte das Leben der waldbewohnende Asketen preisen (Chāndogya Upaniṣad 5, 10), plädieren andere für ein spirituelles Leben innerhalb der Gesellschaft. Zur selben Zeit stellt die späte Maitrī Upaniṣad eine völlig pessimistische Ansicht des Karman vor. Hier finden wir die bittere und hoffnungslose Stimmung, die so typisch für den frühen Buddhismus wurde. Um damit anzufangen, ist der Körper faul riechend, substanzlos, voller Kot, Schleim, Urin und Krankheit, gebunden an Wünsche, Ärger, Verwirrung, Begehrlichkeit, ein ‘Karren ohne Intelligenz’. Die Götter selbst können als Ausdrucksformen des Brahman verehrt werden, aber ihre Wohltaten sind vergänglich und sollten verworfen werden. Vereinigung ist nur erreichbar, wenn alles zerstört ist. Die beste Methode, um Frieden zu finden, sind Askese und Entbehrungen; indem er alles Gute und Böse abschüttelt, wird der Weise selbstlos, leer und abwesend. Wesentlich spätere Zusätze zu dieser Upaniṣad beschreiben einige nützliche neue Konzepte wie jene Energiebahn, die der Wirbelsäule entspricht (Suṣumnā) und deren Bahn dem Weg der höchsten Krieger zur Sonne gleich kommt, Meditation über Klang, die Meditation über das daumengroße Ich in der Höhle des Herzens, die Vermeidung von Gedanken plus einige schräge rituelle Elemente. Manches davon ist eine Grundlage zum meditativen Yoga, wie es um das dritte Jahrhundert u.Z. entwickelt wurde, aber alles in allem ist es ganz gewiss keine frohe Botschaft. Diese Einstellung wurde zu einem der vorherrschenden Elemente im indischen Denken. Wenn moderne Menschen von Reinkarnation hören, betrachten sie das meist als eine gute Nachricht. Angeblich glaubt mittlerweile mehr als die Hälfte der Bevölkerung Deutschlands an Reinkarnation, ohne sich viele Gedanken darüber zu machen. Für die Menschen im alten Indien war Wiedergeburt etwas, das dringend vermieden werden sollte.
Neue Glaubensrichtungen: Buddhismus und Jaina
Die Upaniṣaden erwiesen sich als ein Durchbruch in der indischen Philosophie. Während sie die älteren Veden nicht zu entwerten versuchten, hatten sie eine befreiende Wirkung auf viele Denker. Das Konzept von Brahman verringerte die Bedeutung der personifizierten Götter und ermöglichte die Entwicklung einer abstrakten und ausgefeilten Spiritualität, die viel von den früheren Riten und Opferungen ersetzen konnte. Diese Veränderung geschah subtil, nicht durch einen klaren Bruch mit früheren Traditionen. In den Jahrhunderten nach den Upaniṣaden tauchten eine Menge neuer philosophischer Schulen auf. Viele von diesen waren höchst unzufrieden mit der in Schichten aufgeteilten Gesellschaft und dem rigiden Festhalten an den Pflichten der Klassen. Zwei innovative Systeme überlebten bis zum heutigen Tag. Sie wurden von Zeitgenossen gegründet, aber das tatsächliche Datum dieses Ereignisses ist höchst umstritten. Den Tod von Buddha (im Alter von achtzig Jahren) hielt man für eines der wenigen verlässlichen Daten der indischen Vorgeschichte, und viele Quellen stimmten darin überein, dass dieser sich im Jahre 486 oder 480 v.u.Z. zutrug. Neuere Untersuchungen haben Zweifel daran aufgeworfen und gezeigt, dass das Ableben des Erleuchteten ebenso gut im Jahre 350 v.u.Z. geschehen sein konnte. In diesem Falle müssen die Veden, die Upaniṣaden und sogar die arische Eroberung neu datiert werden (Wilhelm in Franz 1990 : 99).
Es wurde schon genug über den Buddha und seine Lehren geschrieben, also verzeih mir, dass ich kein Material wiedergebe, das in jeder Bibliothek studiert werden kann. Für den Augenblick soll es reichen, dass Buddha auf die Grundlage der Upaniṣaden aufbaute, aus denen er auch das Konzept der Reinkarnation übernahm. Der frühe Buddhismus ist voll von upaniṣadischen Ideen. Die Übel des Körpers, die Schlingen der Begierden und Bindungen, die Vergeblichkeit der menschlichen Anstrengung und dergleichen wurden schon Jahrhunderte lang gelehrt, bevor Buddha sie in seine Lehre aufnahm. Beim frühen Buddhismus lag der Schwerpunkt auf Erkenntnis, Achtsamkeit, Entsagung, Befreiung von Bindungen und freiwilliger Armut, wobei hier vieles genutzt wurde, was von den Sehern der frühen Upaniṣaden entwickelt worden war. Neu waren die Ablehnung von strenger, körperverletzender Kasteiung (Tapas) und die Betrachtungen von Leichen, deren Verfall über Tage genau beobachtet wurde, um die Betrachter von der Welt der Begierden zu lösen. Meditative Praktiken waren im Ur-Buddhismus nicht sonderlich beliebt; und als solche Befreiungswege populärer wurden, sprachen sich etliche Buddhisten gegen sie aus, oder legten eben dem Buddha entsprechende Behauptungen in den Mund.
Ein sehr früher buddhistischer Text (Majjhima Nikya, verfasst vor dem 3.Jh v.u.Z.) kritisiert zum Beispiel einen Nicht-Buddhisten dafür, dass dieser sich mit einer Methode abgäbe, den Geist durch Meditation (Jhāna) zu kultivieren. Dieser praktizierte dabei eine Reihe von Techniken wie extremes Fasten, Atem-Anhalten, und Zunge-gegen-den-Gaumen-pressen: wir erfahren, dass Buddha diese Techniken versuchte und davon extreme Kopfschmerzen, Schweißausbrüche, Schmerzen und geistige Verwirrung erlitt (White, 2011 : 54-55). Solche Erfahrungen führten Buddha zu der Überzeugung, dass Befreiung nicht mit körperlichen Schmerzen einhergehen sollte. Schon lange vor Buddhas Geburt hatte eine wachsende Anzahl von verrückten Weisen begonnen, in Waldgemeinschaften zu leben. Viele von ihnen gingen ihrer eigenen Wege; ein guter Beweis dafür, dass Einsamkeit, Hunger, Fehlen von sozialem Druck und pure Entbehrung zu interessanten Bewusstseinszuständen führen können. Eine bedeutende Schule erklärte, dass die Seele und ihr Schicksal nach dem Tod nicht nur unbekannt, sondern auch unerkennbar wären.
Was unbekannt und unerkennbar ist, existiert nicht. Diese provokante These widersprach den Lehren der Upaniṣaden, da sie von einem Prinzip des Nicht-Selbst, dem Anātman ausging, und dabei alle All-Selbst-Konzepte wie das Brahman verneinte. Während für die Verfasser der Upaniṣaden Brahman als das unfassbare, ewige, formlose Selbst die einzige Realität war, gab es in der Theorie vom Anātman überhaupt kein Selbst, kein Ich und keine Realität. Buddha verband die Idee der Reinkarnation mit der nichtexistenten Seele und erklärte, dass es nichts Beständiges oder Anhaltendes welcher Art auch immer gibt. Anders als frühere Weise erklärte Buddha, dass Karman nicht von einer persönlichen Seele, einem Ātman abhängig ist, um seinen Einfluss fortzusetzen. Die Kausalität besteht fort, egal ob es eine Seele gibt oder nicht. Statt einer Seele gibt es eine Gruppe von illusionären und schmerzlichen Zuständen (‘Selbst’), die von Leben zu Leben fortbestehen. Diese Zustände sind das, was Menschen als ihr Wesen betrachten. Schließlich findet der Tanz ein Ende: Das letzte Überbleibsel der persönlichen Identität verschwindet, und das ‘Selbst’ verblasst zum Nichts. Dies ist die Befreiung im ursprünglichen buddhistischen Sinne: das Verschwinden aller Illusionen zusammen mit dem Wesen, welches diese Illusionen empfindet. Ende der Form, Ende der Wahrnehmung, Ende der Show.
Diese essentiell pessimistische Philosophie hatte eine große Anziehungskraft auf Leute, die das Leben, seine Beschränkungen oder auch nur sich selber satt hatten. (Ein Freund schlug vor, ich solle es nicht ‘pessimistisch’ nennen; seiner Ansicht nach ist ‘realistisch’ zutreffender. Ich nenne das ‘zynisch’.) Buddhas Lehren erwiesen sich auch als höchst attraktiv für die Herrscher jener Zeit, denen es gefiel, wenn ihre Untertanen sich zurückhielten und resignierten. Anders als viele andere Philosophen jener Zeit rief Buddha nicht zu einer Veränderung der Gesellschaft auf, sondern verlangte von seinen Anhängern, sie zu verlassen oder zu ertragen. Wir sind hier schon sehr weit entfernt von den Veden. Die Hoffnung auf ein himmlisches Paradies war der Sehnsucht nach dem völligen Verschwinden gewichen. Buddha machte reichlich Gebrauch von dem älteren Begriff Nirvāṇa für das Ziel aller spirituellen Bemühungen. Dieses Wort, oft und vor allem in neuerer Zeit als ‘Befreiung’ oder sogar als ‚Glückseligkeit‘ verstanden, bedeutet ursprünglich Ablauf, Aufhören, Erlöschen, und wurde häufig in Buddhas Lieblingsmetapher verwendet, der von der erlöschenden Flamme einer Öllampe. Wenn das Öl verbrannt ist, verschwindet die Flamme spurlos. Ebenso verschwindet das Selbst, wenn das Karman aufgebraucht ist. Wir haben hier eine Polarität: Nirvāṇa (das Aufhören) gegenüber Saṁsāra (Gehen, Wandel: dem Zyklus der Wiedergeburt). Zusammen mit dem Selbst wird eine Anzahl weiterer Illusionen abgebaut, hauptsächlich solche, die Menschen dazu bringen, Bindungen zu formen. Diese beinhalten Emotionen wie Gier, Hass, Sehnsucht, Begierde, Ignoranz, Liebe, Pflichtgefühl, Freundschaft usw. Wenn alle Fesseln gelöst sind, erlangt die Seele Befreiung (d.h. verschwindet), doch der Körper kann weiter leben, bis er tot umfällt.
Man konnte also in Buddhas System durchaus Befreiung zu Lebenszeit erlangen, nur dass man herzlich wenig davon hatte. Die ganze Sache wurde als vier edle Wahrheiten verpackt, beginnend mit der Behauptung, dass alles Leben Leiden beinhaltet und Verlangen die Wurzel allen Leidens wäre. Kāma, die Gottheit des Verlangens, war zum Inbegriff des Bösen geworden. Diese etwas einseitige Verurteilung des Daseins mag daraus resultiert haben, dass Buddha während seiner jüngeren Jahre in einer wohlhabenden Umgebung gründlich verzogen worden war: für ihn war der Weg zur Befreiung gleichbedeutend mit der schieren Enttäuschung. Ein etwas ausgeglichener Charakter hätte zumindest bemerkt, dass auch die Freude allem Dasein inhärent ist. Aber solche Ansichten wurden erst mehr als ein Jahrtausend später kultiviert, als sich eine Randgruppe revolutionärer Buddhisten dem Tantra verschrieben.
Zurück zum Urbuddhismus: In einer Welt, in der so etwas wie ein Selbst nicht existiert, gibt es offensichtlich wenig Bedarf für Gottheiten. Der historische Buddha betrachtete sie, genauso wie die Menschen und Tiere, als unglücklich an die Illusion gebunden. Anbetung und Opfer hielt er für überflüssig. In diesem Sinne war der frühe Buddhismus niemals eine Religion, und bis zum heutigen Tage betrachten viele Inder den Buddhismus als eine Form des Atheismus.
Der buddhistische Glaube, obwohl ernsthaft und grimmig in seinen frühen Stadien, unterlief im Laufe der Jahrhunderte einer ganzen Menge Veränderungen. Er spaltete sich in zwei Hauptbewegungen und entwickelte sich zu vielen Graden der Verfeinerung, während er sich durch Asien verbreitete. Er unterlief auch vielen Neuinterpretationen. Um richtig populär zu werden, musste der Urbuddhismus wesentlich toleranter, positiver und menschenfreundlicher werden. So wandelte sich das ursprüngliche Ideal, ein Arhat (Würdiger) zu werden, also ein Mensch, der sich aus der Welt der Verblendung befreit, in das Ideal eines mitfühlenden Bodhisattwas, welcher sich weigert, die Welt der Illusionen zu verlassen, solange es noch leidende und verblendete Wesen gibt. Im Geiste dieser neuen Erkenntnis begannen Buddhisten wohltätige Werke zu tun, sammelten für die Armen, errichteten Krankenhäuser, Waisenhäuser, Schulen und ganze Universitäten, was sie auch in vielen fremden Ländern populär machte. In Indien begann der Rückgang des Buddhismus im siebenten Jahrhundert. Während sich der Kult noch immer nach China, Japan, Korea, Südostasien und einige Jahrhunderte später in den Himalaya ausbreitete, begann sein Ursprungsland die Kernlehren des Erleuchteten umzuwandeln. Das siebente Jahrhundert sah die Entwicklung einer neuen buddhistischen Schule im nördlichen Indien, das Vajrayāna (Diamantgefährt), welches stark von den hinduistischen Śākta-Lehren beeinflusst war. Was wir heute Tantra nennen (die Menschen jener Zeit taten es nicht) stellt vor allem eine Verschmelzung verschiedener hinduistischer und buddhistischer Traditionen dar. Der tantrische Buddhismus ist von der reinen und strengen Erkenntnistheorie und Entsagung des historischen Buddha weit entfernt. Zunächst ist er nicht so negativ und pessimistisch eingestellt. Er begann auch, Meditation, Verinnerlichung, Yoga, Visualisierung, Ritual, Drama, Trance-Praktiken, Besessenheit, Wahrsagung, Musik und in manchen Traditionen rituelle Liebe mit einander zu verbinden. Als die Moslems zwischen dem 8. und 13. Jh. nach und nach Indien eroberten, war der tantrische Buddhismus so mit dem hinduistischen Tantra verwoben, dass sie kaum zu unterscheiden waren. Viele Anhänger fühlten sich in beiden Systemen zu Hause. Die Moslems erlaubten keines davon. Da die Buddhisten von Tempeln, Klöstern und Bibliotheken abhängig waren, war es eine leichte Sache für die Eroberer, den Kult zu zerstören. Er gedieh außerhalb seines Heimatlandes weiter. Wenn Du einen modernen Buddhisten sagen hörst, dass Nirvāṇa identisch mit Saṁsāra ist und dass die wichtigste buddhistische Freiheit die Freude ist, dann bist Du Zeuge einer Erkenntnis, die für die frühen Buddhisten mit ihren eskapistischen Vorlieben kaum denkbar gewesen wäre.
Der Glaube des Jaina entwickelte sich in derselben Epoche wie der Buddhismus. Sein Gründer wurde Mahāvīra (Großer Held) oder Jina (Sieger) genannt; sein ursprünglicher Name war Vardhamāna. Diese martialischen Titel bedeuten nicht, dass ihr Träger ein gewalttätiger Mann war. Im Jaina ist der wirkliche Kampf der gegen die Dämonen im Inneren, und der Weg zum Sieg ist die totale Askese. Wie der Buddhismus stand Jaina in einem krassen Gegensatz zur vedischen Klassengesellschaft und den Opferexzessen der Brahmanen. Anders als Buddha glaubte Mahāvīra an die Reinkarnation und die Realität der Seele. Nach seinem Glauben werden alle Seelen wiedergeboren, und alle Wesen und Dinge sind mit einer Seele ausgestattet. Deshalb ist das erste Prinzip der Jainas die Kultivierung von Ahiṁsa (Nichtverletzen): Wenn Du auch nur das kleinste Geschöpf verletzt, verletzt Du Dich selbst und das All-Selbst und erleidest eine Menge schlechtes Karma. Die Ahiṁsa wurde zum Hauptgebot des Glaubens. Keine andere Religion der Welt ist so darum besorgt, die Verletzung von Mitgeschöpfen zu vermeiden. Man kann strenggläubige Jainas daran erkennen, dass sie den Boden fegen, um keine Insekten zu zertreten, und ein Tuch vor dem Mund tragen, um sie nicht versehentlich einzuatmen. In ihrer Praxis müssen die Jainas strenge Askese üben. Wünsche werden ignoriert oder negiert und einfachste Annehmlichkeiten abgelehnt. Die Frage, ob Kleidung getragen werden kann, spaltete die Religion in zwei streitende Fraktionen: die eine in weiße Gewänder, die andere bekleidet mit dem Himmel (nackt). Nicht alle Anhänger des Kultes gingen in solche Extreme. Den Laien war erlaubt, ein weltliches Leben zu führen, vorausgesetzt, sie hielten sich an die wichtigsten Regeln.
Da die Ahiṁsa der Gipfel der Perfektion blieb, waren viele Berufe unattraktiv. Selbst ein Bauer tötet Leben, wenn er den Boden pflügt. Als Ergebnis dessen wurde die Mehrheit der Jainas zu Kaufleuten und erlangte einen bemerkenswerten ökonomischen Einfluss. Viele verdienten mehr Geld, als ihr Glaube ihnen auszugeben erlaubte. Ihr Kult war niemals eine Massenbewegung, weil er zu viel Disziplin und asketischen Idealismus verlangte (sowie die strenge Einhaltung hunderter Regeln), andererseits wurde er aber auch niemals dekadent oder verlor seine frühen Ideale. Das Ideal der Ahiṁsa beeinflusste viele hinduistische Religionen und verschiedene tantrische Bewegungen. Lange Zeit standen Buddhismus und Jainismus in schwerer Konkurrenz miteinander. Doch waren Buddha und Mahāvīra keineswegs die einzigen originellen Philosophen ihrer Zeit. So lange Waldgemeinschaften existierten, weit entfernt vom Einfluss des städtischen Brahmanismus, gab es stets neue Schulen der Erlösung. Dank der buddhistischen Historiker wissen wir von drei anderen Schulen. Wir wissen vom düsteren Gośāla, der einen grimmigen Vorbestimmungsfatalismus vertrat. Nach seiner Lehre sind alle Wesen, wie sie sind, und können sich kein bisschen ändern. Schicksal, Natur und Möglichkeiten sind unerbittlich, freier Wille ist eine Illusion, und Karman funktioniert wie eine blinde Maschine. Seine Anhänger, Ājīvikas genannt, erhielten eine Initiation und verbrachten den größten Teil ihres Lebens mit der Kultivierung einer extremen Askese. Dieser Kult scheint im südlichen Indien bis ins 14. Jh. überlebt zu haben; er beeinflusste die Vaiṣṇavas (Gonda 1960 : 286).