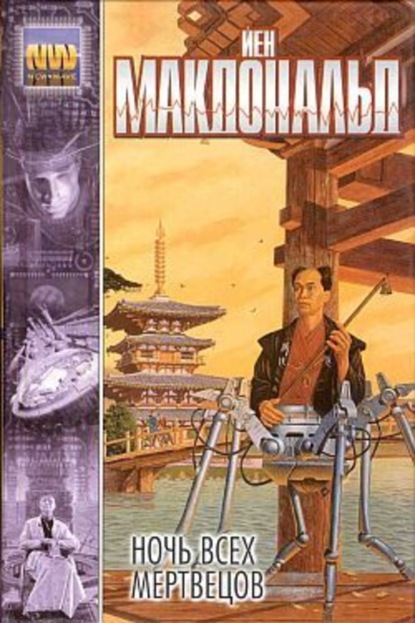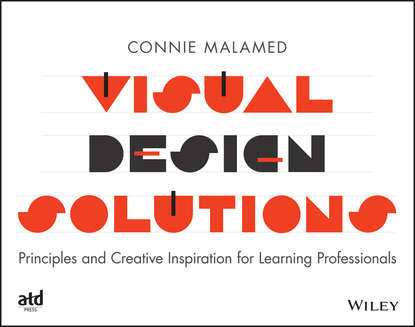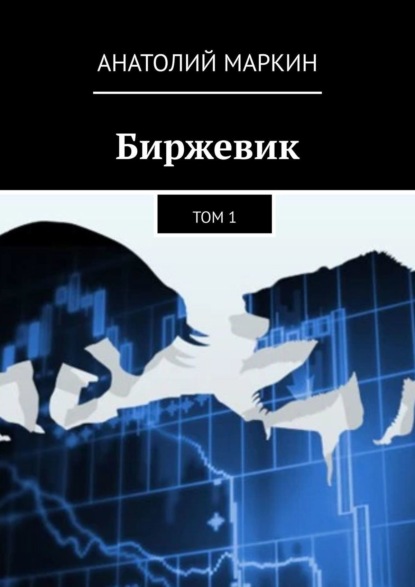- -
- 100%
- +
„so geartet ist, sich um das Seiende zu beeifern, und also nicht bleiben kann bei dem vielen als seiend vorgestellten Einzelnen, sondern weitergehen wird, ohne sich verblenden zu lassen, und nicht eher Befriedigung finden für seine Liebe, bis er die Natur von jedem selbst, was ist, aufgefaßt hat, mit demjenigen in der Seele, womit es geziemt dergleichen zu fassen – es ziemt aber mit dem Verwandten; womit also dem wahrhaft Seienden sich nähernd und sich damit vermischend, und so Vernunft und Wahrheit erzeugend, er erkennen wird und wahrhaft leben und sich nähren und so seiner Schmerzen Ende finden, eher aber nicht“ (Politeia VI 490ab).14
Es ist schwierig bei Platon zu beurteilen, ob er damit eine Hoffnung verbindet oder ob er überzeugt ist, dass sich das Ziel erreichen lässt. Dieser Doppelgestalt der Philosophie gibt Platon immer wieder Ausdruck. Vor allem hat er ihren Begriff ganz neu verortet (vgl. Erler 2006, 68 f.). Die philologische Bedeutung der Wortverbindung von phileo und sophos bedeutet ursprünglich, dass man mit einem Wissensinhalt vertraut ist, weil man häufig mit diesem Umgang hatte, so wie jemand sich mit Pferden auskennt, wenn er viel mit den Tieren zusammenkommt, und dann ein phil-hippos genannt werden kann. Der häufige Umgang mit Wissen der höchsten und geistigen Art, das der Lebensführung dient, und das von den „Weisen“ gelehrt wird, macht nach Platon seinen Träger allerdings gerade nicht zum Philosophen, sondern zum sophos und Sophisten. Denn in den Gegenständen, um welche es Sokrates und Platon geht, gibt es eben kein positives Wissen, das als solches vorhanden ist und weiter gegeben werden kann.
Von „vertraut sein mit“ ändert sich das phileo bei Platon in ein „Streben nach“, in ein „Freund sein von“. Das bedeutet, dass der Philosoph das Wissen nicht hat, sondern danach strebt. Die Doppelnatur der Philosophie beschreibt Platon auch im Symposium. Dort wird die Philosophie mit der Liebe identifiziert, näherhin mit dem eros, was für den Liebesgott und für sein Prinzip steht, dem Streben nach dem Schönen, dessen Best-form die Weisheit ist. Der Eros nämlich sei ein Sohn von Poros, dem Weg, und Penia, der Armut. So bleibt die Philosophie arm, „rauh, unansehnlich, unbeschuht, ohne Behausung, auf dem Boden immer herumliegend und unverdeckt schläft [sie] vor den Türen und auf den Straßen im Freien“ (Symposion 203cd). Da aber auch das väterliche Erbe durchschlägt, ist Eros gleichzeitig „tapfer, keck und rüstig, ein gewaltiger Jäger, allezeit irgendwelche Ränke schmiedend, nach Einsicht strebend, sinnreich, sein ganzes Leben lang philosophierend, ein arger Zauberer, Giftmischer und Sophist“ (ebd. 203d).15 Was die Philosophie sich damit verschafft, zerrinnt ihr aber gleich wieder. Und dieses Wesen überträgt sich auch auf den philosophischen Umgang mit den Menschen. Die Leute mögen es nicht, wenn ihre Vorstellungen als Missgeburt weggeworfen werden.
Das ständige Hinterfragen, zumal wenn es öffentlich geschieht, stört eine mühsam errungene und mit großem Aufwand aufrecht zu erhaltende, öffentliche Ordnung, die sozialen Grundlagen und den Legitimitätsanspruch der regierenden Parteien. Die Selbstverständlichkeit eines einmal eingeschlagenen Weges, der dann nach und nach Verbindlichkeitsansprüche in allen Bereichen fordert, bringt die Philosophie nicht auf. Vielmehr stellt sie sich von vorne herein schon dagegen. Nach Platon sprangen die Sophisten in die Lücken, welche zwischen den unterschiedlichen Verbindlichkeitsansprüchen gähnten, allerdings nicht, um neue Verbindlichkeiten zu begründen, sondern um die Situation für sich auszunutzen. Sie lehrten die Beliebigkeit der Anschauungen, und dass es nur darauf ankomme, darin die Möglichkeiten für das eigene Fortkommen zu erkennen und zu sichern.
Sokrates und Platon genügte das nicht. Sie wollten eine tatsächliche Neugründung der geistigen und sozialen Fundamente errichten, wussten aber, dass das so einfach nicht ist, weil die traditionellen Überzeugungen zerstört waren und keine gemeinsame Basis von Anschauungen mehr bestand; die Individualisierung ist geradezu das Kennzeichen der sophistischen Aufklärung.
Es ist das Verdienst Platons, diesen dynamischen Wissensbegriff entwickelt zu haben. Dabei legt er darauf Wert, dass echtes Wissen sich seiner Voraussetzungen immer wieder neu versichert, um so die Bestände an Wissen im dynamischen Fluss zu halten.16 Während die Sophisten sich pragmatisch darauf ausrichteten, die Ambivalenz der meisten Voraussetzungen dafür zu nutzen, das Wissen so zu gebrauchen, wie es einem selbst gerade am meisten einbringt, verschob Sokrates die Grundlage der Philosophie in den Einzelnen und sein Nachdenken. Die Zielgröße liegt dabei nicht im äußeren Erfolg, sondern in der inneren Zufriedenheit, in der Übereinstimmung mit sich selbst und mit denen, welche die Dinge genauso sehen, also im Weg zu Weisheit und Wahrheit, nicht im Anspruch, alles besser zu wissen.
Das eigenartige Bild von Sokrates, das Hervorbringen von Wissen mit der Hebammenkunst zu vergleichen, verdeutlicht die Grundhaltung der Philosophie: Was hervorgebracht wird, muss erst geprüft werden und notfalls verworfen werden. Was besteht, ist aber nichts Endgültiges, sondern bedarf der weiteren Pflege und Fortbildung.
Bei der Lektüre von Platons Texten gewinnen wir manchmal den Eindruck, er sei überzeugt davon, dass es sicheres, positives Wissen geben könnte. Seinen Sokrates lässt er nach einem Weg suchen, die Methode zur Eruierung dieses Wissens auf das, ihn tatsächlich sehr viel mehr interessierende, Wissen über die Lebensführung zu übertragen. Dabei stellt er fest, dass auch dort kein Wissen generiert werden kann, das keine Zweifel zulässt. Im vollen Bewusstsein, dass uns Menschen gar keine andere Wahl bleibt, als in unserer Lebensführung von bestimmten Überzeugungen auszugehen, erhebt er den Verfahrensweg der genauen Prüfung allen Wissens zur eigentlichen Kernaufgabe der Philosophie. Platon hat damit diese spezifische Ambivalenz der menschlichen Existenz nicht nur gefunden und aufgedeckt, sondern sich dieser auch ohne Scheu und Furcht ausgesetzt und die damit einhergehende Spannung ausgehalten.
Weiterführende Literatur
Ekkehard Martens, Platons Fußnoten zu Sokrates“, in: Schiemann u. a. 2006, 59–69.
Burkhard Mojsisch, „‚Dialektik‘ und ‚Dialog‘: Politeia, Theaitetos, Sophistes“, in: Kobusch u. a. 1996, 167–180.
Rudolf Rehn, „Der entzauberte Eros: Symposion“, in: Kobusch u. a. 1996, 81–95.
Frisbee Sheffield, „Symposium 201d1.204c6“, in: Horn 2012, 125–140; dt. übers. „Das Wechselspiel von Erzählung und Argumentation im Mythos von Penia und Poros in Platons Symposion“ in: Janka u. a. 2014, 283–301.
Orrin F. Summerell, „Der Wollfaden der Liebe. Anmerkungen zu einem Motiv in Platons Symposion“, in: van Ackeren 2004, 69–91.
14Der sogenannte „wahrhaft Lernbegierige“ ist nach Martens gewissermaßen der Sonderfall, denn im Grunde sei Platon davon überzeugt, dass „alle Menschen philosophieren, … alle vom Eros nach dem wirklich Guten beseelt sind“ (Martens 2006, 62). Die angegeben Stelle, Symposion 203b–204c, die Geschichte Diotimas von Eros, gibt diese Lesart aber leider nicht her.
15Über die Ambivalenz des Eros vgl. Rehn 1996, 85–90, 91 f. Zum Symposion insgesamt sehr empfehlenswert Horn 2012, zur Geschichte von Poros und Penia vgl. Sheffield 2012, 125–140 (dt. Übers. in Janka u. a. 2014, 283–301). Für die Herausarbeitung des Zentralmotivs der Liebe vgl. Summerell 2004.
16Diese dynamischen Momente in Platons Spätphilosophie betont vor allem Mojsisch 1996, 168, 171, 176, 179.
3. Das Sich-Wundern (thaumazein) als Ausgangserlebnis der Philosophie
Wahrnehmen, Lernen, Nachdenken, sich ein Problem oder eine Schwierigkeit vornehmen, sich angestrengt mit etwas auseinandersetzen: All das führt zu Wissen und Erkenntnis. Doch mit jedem Ergebnis, das wir dadurch gewinnen, ist oftmals eine sonderbare Erfahrung verknüpft. Wir ersinnen neue Argumente und Begründungen für unsere Meinungen, mahnen Beobachtungen an, verbinden unser Wissen mit anderem Wissen. Und doch: Wir zweifeln daran, wir wollen das scheinbar Gewisse genauer begründen, wir suchen danach, noch genauer zu wissen; und wir wundern uns, dass die bisherige Mühe noch nicht wirklich gefruchtet hat. Unser Anspruch nach vollkommener Wahrheit und absoluter Absicherung dessen, was wir zu wissen meinen, lässt sich nicht einfach aussetzen. Unser Erkenntnisdrang geht meist über das hinaus, was wir überhaupt wissen können. Erst dadurch, dass wir immer weiter fragen, machen wir aber die Erfahrung, dass es ein totales, allumfassendes Wissen nicht geben kann.
3.1 Urteile über das Wahrnehmen und das Erkennen (Theaitetos 151d–155d)
Sokrates hat sich entschlossen, Theaitet bei seiner „Geburt“ zu helfen. Seine ursprüngliche Frage war, was denn Erkenntnis sei. Diese Frage stellt er dem Theaitet aufs Neue und ermuntert ihn, doch eine Antwort zu geben, auch wenn er sich nicht ganz sicher ist. Erkenntnis, so versucht sich Theaitet, ist das, was einer erkennt, letztlich also wohl Wahrnehmung.
Nicht schlecht! meint Sokrates. Da gebe es einen berühmten Sophisten, Protagoras mit Namen, der meint wohl ungefähr dasselbe, auch wenn er es etwas anders ausdrückt. „Er sagt nämlich, der Mensch sei das Maß aller Dinge, der seienden, daß sie sind, der nichtseienden, daß sie nicht sind“ (Theaitetos 152a).17 Theaitet erinnert sich, das auch schon öfter gehört zu haben.
Die Dinge seien also so beschaffen, wie einer sie gerade wahrnimmt. Dem einen erscheinen sie aber so, dem anderen anders. Theaitet stimmt zu. Wenn zwei Menschen im Wind stehen, sagt Sokrates, wird es den einen wohl ziemlich frieren, den anderen aber vielleicht nicht oder nur wenig. Ist jetzt aber der Wind kalt oder erscheint er dem einen nur als kalt, dem anderen aber nicht? Und dass es einem so und so erscheint, liegt entsprechend wohl auch an der Wahrnehmung? Wie jemand also etwas wahrnimmt, so scheint es für ihn auch zu sein. Und weil sich Wahrnehmung immer auf etwas bezieht, das auch da sein muss, so ist sie auch Erkenntnis. Das leuchtet Theaitet alles ein.
Der Wind allein ist für sich genommen gar nichts. Es kommt allein darauf an, wie er einem erscheint, dem einen eisig, dem anderen nicht so kalt. Das scheint wiederum auch überall zu gelten: Nichts ist für sich groß oder klein, schwer oder leicht usf. Alles, was mir heute groß erscheint, kann ich morgen schon für klein ansehen.
So gibt es hier also gar nichts Festes, sondern alles scheint irgendwie in Bewegung zu sein. Offenbar ist das Werden das oberste Prinzip von allem, weil es die Bewegung, an der alles hängt, verursacht. Bewegt sich aber etwas nicht mehr, so scheint es nicht mehr das zu sein, was es zuvor war, als es sich noch bewegte. So entsteht Feuer und Wärme auch mittels Bewegung, nämlich durch Reibung, aber auch das Leben entsteht durch Bewegung. Der Körper wird durch Ruhe und Trägheit geschwächt, durch Bewegung und Leibesübungen aber gestärkt. Auch der Geist, wenn er beschäftigt wird, schärft sich, Gedankenlosigkeit aber ermüdet ihn, so dass er auch das Gelernte vergisst.
Nichts also existiert, es sei denn, es ist irgendwie bewegt und verändert sich dadurch. Die Bewegung ist also immer das Gute, sowohl für den Körper wie für den Geist, die Ruhe aber das Gegenteil davon. Gleiches gilt auch für die Natur, vor allem für die Sonne. Auch diese muss immer in Bewegung sein.
Was, fragt Sokrates, ist aber z. B. eine Farbe, was ist das, was wir weiß oder schwarz nennen? Es kann ja nach dem vorher Gesagten nichts für sich sein. Es muss also irgendetwas sein, das beim Zusammenstoßen der Augen mit der zu diesen gehörigen Bewegung entsteht, denn auch uns erscheinen die Farben nicht nur untereinander wohl anders, sondern jedem einzelnen selbst einmal so, einmal verschieden von diesem Eindruck. Wie kann es aber sein, meint Sokrates, dass wir einmal etwas so und das Gleiche wieder anders wahrnehmen, wenn es sich nicht verändert? Wenn ihm selbst nichts widerfährt, kann es sich im Grunde auch nicht ändern. Was ändert sich aber nun genau? Verändert sich das, wodurch wir etwas messen, berühren oder wahrnehmen? Wie müssen wir uns das genau vorstellen? Und wie verhält sich das mit dem Gemessenen, mit dem Berührten oder mit dem Wahrgenommenen? Welcher Vorgang findet hierbei statt? Wie geschieht es wiederum, dass wir messen, berühren, wahrnehmen?
Ein anderes Beispiel für diese Probleme haben wir z. B. bei Zahlenverhältnissen. Nehmen wir an, wir haben sechs Bohnen vor uns, das sind doch, vergleichen wir sie mit vier Bohnen, die Hälfte mehr; dagegen, wenn wir diese mit zwölf Bohnen vergleicht, sind es nur die Hälfte der Bohnen. Die Anzahl der Bohnen, sechs, hat sich nicht geändert! Einmal aber mussten wir sie als „die Hälfte mehr“ ein andermal als „nur die Hälfte“ bezeichnen. Kann also etwas mehr oder weniger werden, ohne dass es zugenommen oder abgenommen, und ohne, dass es sich geändert hat?
Nachdem, was gerade angenommen wurde, nämlich, dass wir nichts anders wahrnehmen können, es sei denn, es hat sich geändert, kann das offensichtlich nicht der Fall sein. Dass es sich so verhält, müssen wir auf der anderen Seite allerdings annehmen. Wir können freilich beides behaupten, so dass die Zunge nicht widerlegt wird, aber unser Denken mit sich selbst im Unreinen ist, weil wir doch wissen wollen, was wir annehmen sollen. Am besten ist es, man fängt noch einmal von vorne an, das sei doch alles zu verwirrend gewesen, meint Sokrates.
Wir gehen also erstens davon aus, dass sich nichts verändert, weder der Masse noch der Zahl nach, wenn es sich in dieser Hinsicht gleich bleibt. Zweitens gilt: Wenn man zu etwas nichts hinzutun oder wegnehmen würde, würde es weder wachsen noch schwinden. Und drittens glauben wir auch Folgendes: Was nicht war, kann auch nicht sein, ohne geworden zu sein. Das müssen wir alles beachten, wenn wir nicht durcheinanderkommen wollen über die Bohnen und ihre Zahl.
Aber es gibt noch andere Beispiele: Sokrates, der heute größer ist als Theaitet, wird vielleicht nächstes Jahr schon kleiner sein als dieser, ohne dass er doch etwas von seiner Masse oder Größe eingebüßt hätte und nie kleiner geworden wäre. Theaitet ist der Jüngere und wächst noch. Dass dieser dann größer geworden ist, ist ganz natürlich, er hat sich ja verändert und an Größe zugenommen. Sokrates aber verändert sich nicht mehr und dennoch kann man behaupten, Sokrates ist kleiner geworden im Verhältnis zu Theaitet.
Jetzt kennt sich Theaitet, dem es wie in der Mathematik um eine einheitliche Fassung der Begriffe geht, nicht mehr aus. Er sagt: „Wahrlich, bei den Göttern, Sokrates, ich wundere mich ungemein, wie doch dieses wohl möglich sein mag; ja bisweilen, wenn ich recht hinsehe, schwindelt mir ordentlich.“ Ja, sagt Sokrates, Theodoros – das ist der Mathematiklehrer von Theaitet und der Freund von Sokrates – habe eben ganz recht über Theaitet geurteilt, dass dieser ein echter Philosoph, ein wahrer Freund der Weisheit (philos – Freund; sophos – Weisheit; vgl. auch Phaidros 278d) sei. Es gibt nämlich nur einen Ursprung der Philosophie und dieser sei „das Sich-Wundern“, das thaumazein.
3.2 Die Frage nach der Erkenntnis
Wir haben Grund, uns ebenso zu wundern. Die Frage nach der Erkenntnis ist eine der wichtigsten Fragen in der Philosophie, und beiden Gesprächspartner waren mitten in einer Diskussion, die erwarten ließ, dass wir etwas darüber erfahren. Dann bringt Sokrates in einer recht sophistischen Art ein Argument über Werden und Sein der Dinge vor, um darauf hin über seine Relationsbegriffe eine so enorme Verwirrung zu stiften. Die Sache mit den Bohnen und der Größe von Sokrates im Vergleich zu Theaitet ist uns doch vertraut und eindeutig.
Die Bestimmung von Wissen und die von Erkenntnis sind zentral für Platons gesamtes Philosophieren. In seinen früheren Schriften geht es darum, wie wir das Gute erkennen und die Tugenden bestimmen können, und wie die Handlungen aussehen, welche wir als gut bezeichnen. Später hat er noch sehr viel grundsätzlicher nach diesen Gegenständen gefragt. Aus der Frage nach den Möglichkeiten, zu erkennen und begrifflich zu bestimmen, was die Tugend, das Gute oder eine gute Handlung jeweils ist, ergibt sich die allgemeine Frage danach, was Erkenntnis sei:
Der Sinn dieser zunächst ganz einfachen Frage erweitert sich sehr schnell. Die einfachste Antwort darauf hat nämlich nur autoritatives Wissen zur Folge: Wenn ich wissen will, wie oder was etwas ist, dann frage ich jemanden, der sich damit auskennt, oder ich sehe in einem Lexikon nach. Ich erhalte damit einen Wissensinhalt, dessen Wahrheitsgehalt vom Vertrauen in die Quelle abhängt. Wenn mich jemand dasselbe fragt, kann ich den gleichen Inhalt wiedergeben, ich werde aber auf eine Nachfrage, warum das so ist, keine Antwort geben können, denn mein Wissen beschränkt sich auf das, was ich gehört oder gelesen habe und was ich glaube. Das würden wir aber nicht als Erkenntnis oder Kenntnis des Sachverhalts ansehen.
Es geht darum, Wissensinhalte irgendwie zu sichern. Autoritätsabhängiges Wissen beruht jedoch nicht auf Einsicht in die Sache. Wenn wir nun die Bedingungen angeben wollen, um einen beliebigen Wissensinhalt als tatsächlichen auszuweisen, stellen sich sofort neue Fragen: Auf was beziehen sich Wissensinhalte? Sind das nicht ganz unterschiedliche Bezugsmomente? Die Frage nach der Farbe ist eine andere, wie die nach der relativen Größe, und die wieder eine andere als die nach den Zahlenverhältnissen. Platon konfrontiert uns aber gleichzeitig mit noch weiteren Problemen: Was meinen wir, wenn wir sagen: Etwas ist so! Bezieht sich das auf einen Sachverhalt? Nämlich auf einen, von dem wir sagen würden: Dieser besteht tatsächlich oder bezieht sich auf die Wirklichkeit? Oder geht es nur um das sprachlich ausgedrückte Urteil und die aufgeführten Gründe, welche zu diesem Urteil führen?
In einem ersten Versuch zur Klärung der Frage nach der Erkenntnis, hatte Theaitet einige Fertigkeiten aufgezählt: Wenn einer Schuhe machen kann, muss er erkannt haben, was ein Schuh ist, und wie man einen solchen macht. Sokrates wendet dagegen ein: Mit seiner Erklärung von Erkenntnis habe Theaitet vieles aufgezählt: „Gar offen und freigebig, Lieber, gibst du mir, um eines gefragt, vielerlei und Mannigfaltiges statt des Einfachen“ (Theaitetos 146d). Theaitet scheint das so zu verstehen, dass Erkenntnis etwas zusammenbringt, was vorher nur nebeneinander und jeweils für sich verständlich war. Er bringt ein Beispiel von Theodoros, mit dem er sich über Quadratwurzeln unterhalten hatte: Wenn man die Zahlen, aus denen sich ein Produkt zusammensetzt auf eine Linie überträgt und diese im Neunziggradwinkel anordnet, erhält man entweder Rechtecke oder Quadrate. Die Zahlen, welche (gleichseitige) Quadrate ergeben, lassen auch ein ganzzahliges Ergebnis zu, wenn man die Quadratwurzel aus dem Produkt zieht. Die Zahlen aber, welche Rechtecke ergeben, erlauben das nicht. Das arithmetische Problem erhält mit dieser Erklärung eine anschauliche, weil geometrische Lösung. Theaitet hat damit etwas erkannt, aber das, was er erkannt hat, ist wieder nicht die Antwort auf die Frage, was Erkenntnis ist. In Theaitetos 152de, nach der Erklärung mit der Bewegung, dreht Sokrates den Spieß gewissermaßen um:
„Ich will es dir sagen, und es ist gar keine schlechte Rede, daß nämlich ein Eins selbst für sich selbst gar nichts ist und daß du nicht ein Etwas richtig mit einem Namen oder als wiebeschafften bezeichnen kannst, vielmehr, wenn du etwas groß nennst, wird es sich auch klein zeigen, und wenn schwer, auch leicht und so gleicherweise in allem, weil eben nichts ein Eins ist, sei es nun als etwas oder als irgendwie beschaffen; sondern durch Bewegung und Veränderung und Vermischung unter einander wird alles nur, wovon wir sagen, daß es ist, es nicht richtig bezeichnend; denn niemals ist eigentlich irgend etwas, sondern immer nur wird es.“
Nachdem Sokrates also zunächst nach dem „Einen“ der Erkenntnis gefragt hat, behauptet er nun gewissermaßen, dass Erkenntnis für sich nichts sein kann, sondern erst „werden“ muss. Wenn wir das so formulieren, verstehen wir die Frage etwas besser. Platon dynamisiert mit seiner Interpretation vom Werden die Frage. Auf der einen Seite steht die Erkenntnis als begriffener Sachinhalt, auf der anderen Seite steht das Werden von Erkenntnis. Dort die Wahrnehmung als Bezug auf etwas Bestimmtes in der Welt, hier das Wahrnehmen selbst, das ein Vorgang ist.
Die wichtigste Frage aber lautet: Wie sichere ich die Erkenntnis als eine wahre Erkenntnis? Es wird später im Dialog Theaitetos noch um die Frage gehen, auf welche Weise Erkenntnis von einer Meinung unterschieden werden kann. Dabei benötige ich einen Bezugspunkt, der bei der Erkenntnis in der Begründung liegt. Beim Wahrnehmen dagegen fragen wir einfach nach dem Sachverhalt, und ob er in der Wirklichkeit besteht, d. h. ob er wahr ist. Dieser Bezugspunkt der Erkenntnis ist schon in der Antike unterschiedlich bestimmt worden. Parmenides vertrat die Ansicht, alles bezieht sich auf das eine und unwandelbare „Sein“. Platon spielt an unserer Textstelle mit diesen unterschiedlichen Bezugspunkten von Erkenntnis, die sich einmal als Vorgang, als Erkennen, das andere Mal auf den Inhalt, die Erkenntnis und den Wissensinhalt richtet. Hinzu kommt, dass wir das Wissen auf etwas Bestimmtes beziehen. Und zudem fragen wir nach dem Grund oder der Begründung dieses Wissens. Das Verstehen, das Einsehen, die Einsicht und das Wissen bringen aber offenbar etwas zusammen, was in dieser Kombination vorher noch nicht vorhanden war.
Der Mathematikschüler Theaitet wird von Platon gewissermaßen als philosophisch Fortgeschrittener gezeichnet, nicht weil er im Metier des Sokrates besonders sicher ist, sondern weil er bestrebt ist, einen Sachverhalt unbedingt auf den Begriff zu bringen (vgl. Theaitetos 148d). Theaitet ist das Verfahren durch seine Auseinandersetzung mit der Mathematik bereits geläufig. Seine philosophische Unbeholfenheit drückt sich dagegen dadurch aus, dass er mit einer geometrischen Anschauung operiert; allerdings merkt er dabei sofort, dass der Vergleich bei einer begrifflichen Bestimmung der Erkenntnis nicht die ganze Wahrheit aufzeigt. Gleichzeitig lässt Platon seinen Sokrates ein – freilich leicht durchschaubares – sophistisches Verwirrspiel anzetteln. Sokrates hatte doch die Frage danach gestellt, was Erkenntnis ist, um gleich darauf auszuführen, dass es so etwas gar nicht geben kann, weil nichts ist, sondern alles wird. Die Frage auf diese Antwort lautet: Wie erlangen wir Erkenntnis? Diese Frage kann ich aber offensichtlich nicht beantworten, wenn ich nicht weiß, was das ist: Erkenntnis. Die Antwort bleibt uns Platon an dieser Stelle noch schuldig, denn die Definition: Erkenntnis ist Bewegung! würde uns nicht viel weiterhelfen; zudem ist sie in sich „statisch“: Sie drückt einen Zustand aus, gesucht aber war ein Vorgang, ein Prozess.18
In dem Gespräch mit Theaitet hatte Sokrates noch vor seiner Geschichte mit der Hebammenkunst schon einmal gefragt, was Erkenntnis sei. Für Theaitet bestand Erkenntnis dabei noch in jeder Art von Wissen, umfasste also auch das Wissen davon, wie man Schuhe verfertigt oder Möbelstücke usf. Das sind allerdings ganz unterschiedliche Dinge, denn die Frage nach der Erkenntnis will auf eine Bestimmung hinaus, was allen diesen Künsten und Fertigkeiten gemeinsam ist. Ganz ähnlich stellte sich das dar, als Theaitet sein mathematisches Beispiel mit den Quadratwurzeln vorbrachte, bei dem er ein ähnliches Problem hatte, alles auf Eines zurückzuführen, das die Sache näher bestimmt. Insofern ist das mit den Bohnen und der Körpergröße zwar doch ein Problem, aber keines worüber sich Theaitet unendlich wundern müsste. Das Ganze scheint für Platon also eine Spielerei gewesen zu sein, die er sich leistete, um die Sache mit dem thaumazein als Ursprung der Philosophie einzuführen. Zudem nutzt er die Gelegenheit, bereits einige Grundprobleme und methodische Herangehensweisen anzusprechen.
Wäre das nicht weiter motiviert, wäre Platon nicht Platon. Dass diese im ersten Moment etwas hanebüchene Konstruktion zur Grundlage des philosophischen Ursprungs im Wundern geformt wird, ist dann mindestens auffällig. Das Problem mit den Bohnen wird erst zu einer echten Schwierigkeit, wenn man tatsächlich nach einer einheitlichen Bestimmung von etwas fragt. Theaitet, der sich aufs Äußerste bemüht, Sokrates in seiner Argumentation zu folgen, geht, nachdem er es einmal begriffen hat, von dieser Frage nach einer einheitlichen Definition auch aus. Letztlich wundert er sich, weil es sich um einen ganz einfachen Zusammenhang handelt.