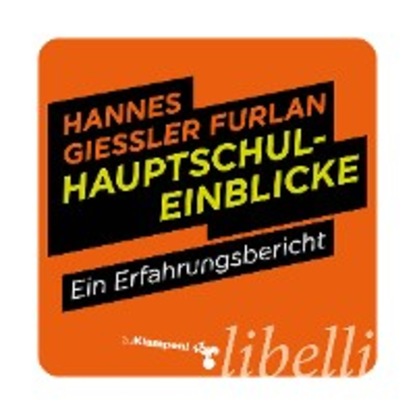- -
- 100%
- +

Hannes Giessler Furlan
Hauptschuleinblicke
Ein Erfahrungsbericht
zu Klampen libelli
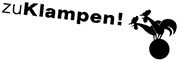
© 2020 zu Klampen Verlag · Röse 21 · 31832 Springe
www.zuklampen.de
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH ⋅ Rudolstadt ⋅ www.zeilenwert.de
Covergestaltung: Stefan Hilden ⋅ München⋅ www.hildendesign.de
ISBN 978-3-86674-853-8
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.dnb.de› abrufbar.
von Christoph Türcke
Hannes Giessler Furlan hatte mit einer Arbeit über »Idee und Realität kommunistischer Ökonomie« in Philosophie promoviert, ehe er in einem westdeutschen Ballungsgebiet an einer Hauptschule die Vertretung für einen erkrankten Lehrer übernahm und dort haarsträubende Erfahrungen mit der »Idee und Realität aktueller Pädagogik« machte. Wie können es hier einige Kollegen jahrzehntelang aushalten?, fragte er sich bald. Er war »nur« für dreizehn Monate dort und hätte diese Zeit entschieden schlechter durchgestanden ohne die Abfassung des Berichts über sie, den er hier vorlegt und der ihm ermöglichte, Abstand zu seinen täglichen Schulerlebnissen zu gewinnen, sie ein wenig zu sortieren und die Verhältnisse, denen er da ausgesetzt war, ohne sie ändern zu können, zumindest etwas klarer zu sehen.
Es ist ja nur ein vereinzelter subjektiver Bericht aus einer von vielen Hauptschulen, nicht verallgemeinerungsfähig und daher wissenschaftlich wertlos: So mögen jene Vertreter empirischer Bildungsforschung urteilen, die den Schulalltag auf das reduzieren, was sich davon in standardisierten Fragebögen und Messungen erfassen lässt, die das Gerippe ihrer statistischen Daten mit der authentischen Schulrealität verwechseln – und das Erfahrungskontinuum von Lehrern, die Tag für Tag an der Schulfront stehen, als lediglich »anekdotisch« und »nicht evidenzbasiert« abtun. Schulverwaltungen und Kultusministerien schauen vornehmlich auf diese Daten, geben ihre Erhebung oft eigens in Auftrag und setzen das Erhobene dann in Anweisungen und Erlasse für Schulen um. Das geschieht weitgehend über die Köpfe der Lehrer hinweg. Ihre Stimme findet im Zusammenspiel von Bildungsforschung und Verwaltung wenig Gehör. Dabei können Lehrer, die ein Gespür und Worte dafür haben, was an dem, was sie täglich erleben, nicht bloß zufällig, sondern exemplarisch ist, weitaus tiefer in die Schulrealität eindringen als Datensätze »evidenzbasierter« Forschung.
Einen solchen Zugang eröffnet der vorliegende Bericht. Er ist nicht evidenzbasiert, aber erfahrungsgesättigt – nicht bloß eine direkte Wiedergabe von Erlebtem, sondern bereits ein Herausdestillieren von Signifikantem daran. Nicht, dass er das Erlebte auf einen gemeinsamen Nenner brächte. Dazu ist es viel zu turbulent und zudringlich, dazu hat es den Autor viel zu sehr angegriffen. Aber er gibt nicht nur eine Momentaufnahme; er lässt erahnen, wohin die Reise an deutschen Hauptschulen geht.
Es mag an der Schule, an der Giessler Furlan tätig war (von Unterrichten kann kaum die Rede sein), krasser zugehen als an anderen. Aber das macht sie nicht untypisch. Es lässt vielmehr deutlicher hervortreten, wohin Hauptschulen generell tendieren: zu Sammelbecken derer, die weitgehend chancenlos sind, in ein halbwegs auskömmliches oder gar selbstbestimmtes Arbeits- und Familienleben hineinzuwachsen, weil es ihnen an elementarem Sprach-, Schreib-, Rechen- und Planungsvermögen oder an den erforderlichen sozialen Kontakten dafür fehlt. Nicht alle Migranten sind chancenlos. Diejenigen, die es schaffen, sich durchzubeißen, sind im Kunst-, Kultur- und Wissenschaftsbetrieb als Beispiele gelingender Interkulturalität sogar besonders gefragt. Aber die Mehrheit der Chancenlosen hat einen Migrationshintergrund und gehört patriarchalen muslimischen Familienverbänden an, die per Satellit die Medienkulisse und Mentalität ihrer alten Heimat mitgenommen haben. Ihr Lebensunterhalt setzt sich im Wesentlichen aus einer Mischung von formeller und informeller Arbeit der Männer sowie Sozialhilfe zusammen. Die Frauen verrichten überwiegend Haushaltstätigkeiten.
Die deutsche Schule, die Mädchen wie Jungen gleichermaßen auf einen flexibilisierten Arbeitsmarkt vorbereitet, indem sie sie in zunehmend deregulierten Klassenverbänden in den Erwerb von Kompetenzen einübt, die auf diesem Markt gefragt sein könnten: sie wird in diesen Milieus nicht als Raum der Offenheit erlebt, wo man sich von autoritären Clanstrukturen, beengenden religiösen Vorstellungen lösen und in ein selbstbestimmtes Leben hineinwachsen könnte, sondern als Raum der Bedrohung, wo sich alles auflöst, was in der deregulierten Welt noch Halt und Orientierung gibt. Gutwillige Lehrer, die sich unter Bildung einen Emanzipationsprozess zu einer eigenverantwortlichen Existenz auf demokratischer Grundlage vorstellen, werden in diesem Raum von den Schülern nicht als Bundesgenossen wahrgenommen, sondern als die schwächsten Glieder des Bedrohungsszenarios. Sie stehen auf verlorenem Posten.
Giessler Furlans Bericht zeigt exemplarisch, wie Chancenlosigkeit und Verhärtung sich in den Hauptschulen wechselseitig verstärken. Nicht wenige der Halbwüchsigen, die er schildert, machen den Eindruck, als hätten sie ausgerechnet in der Pubertät, wo sich gewöhnlich ein eigener Gestaltungsraum allererst öffnet, mit ihrem Leben abgeschlossen. Sie betonieren sich in starren Vorstellungen von Mann, Frau und Familienehre, von Gehorsam und Strafe, Gott und Hölle ein, an denen jeder Einwand, jede Einladung zu gemeinsamem Nachdenken oder gar zur Horizonterweiterung abprallt. Daher auch die Hassliebe, mit der sie sich an ihr Smartphone klammern, über das selbst von den Ärmsten die meisten verfügen. Es ist ein Selbstbehauptungsmittel im Schul- und Öffentlichkeitsraum, ein je eigenes Tor zur Welt. Doch das allermeiste der unermesslichen Möglichkeiten, die es ihnen eröffnet, bleibt für sie nur Gaukelwerk – ebenso begehrt wie unerreichbar. Wer mit seinem Leben abgeschlossen hat, ist um so eher bereit, es für Ungeheuerliches aufzuopfern und sich an denen zu rächen, die für diesen vorzeitigen Abschluss verantwortlich zu sein scheinen. Das Radikalisierungspotenzial einer Hauptschullaufbahn ist nicht zu unterschätzen.
Die islamische Variante der Verhärtung ist derzeit die markanteste in deutschen Hauptschulen, aber nicht die einzige. Auch die Biodeutschen unter den Chancenlosen greifen häufig nach allem, was Halt und Orientierung verheißt: autoritären Personen, starren religiösen oder nationalistischen Glaubensüberzeugungen – und Smartphones. Dabei harmonieren deutschnationale und islamistische Einstellungen gelegentlich gar nicht schlecht. Gemeinsam ist ihnen die fundamentalistische Abwehrreaktion gegen den bedrohlichen deregulierten Schulalltag, oftmals über alle kulturellen Differenzen hinweg, wie es ja auch unter erwachsenen deutschen Rechtsextremen nicht wenige Bewunderer des Islamismus gibt, die lediglich beanstanden, dass dieser auch »zu Deutschland gehören« will, statt »daheim« in Arabien zu bleiben.
Die »neue Lernkultur« des deutschen Schulwesens gibt vor, den Schülern weitgehend selbst zu überlassen, wie sie ihr individuelles Set von Kompetenzen erwerben, das sie realitätstüchtig für den High-Tech-Alltag macht. Lehrer sollen dabei nur noch Materialbeschaffer und Lernbegleiter sein. Wie sehr dieses Konzept, das sich mit Kompetenz- und Selbstentfaltungsterminologie üppig schmückt, darauf angelegt ist, schwächere Schüler abzuhängen, zeigt sich am krassesten im Hauptschulalltag. Hier werden die Schüler sich selbst überlassen, die deregulierten Klassenräume zu Aufbewahrungs- und Konfliktaustragungsorten und die Lehrer zu Aufsehern. Schlichtung und Moderation wird zu ihrer Hauptaufgabe, Unterrichtsgestaltung zur Marginalie. Der soziale Sprengstoff, der sich da in den Hauptschulen ansammelt, fällt durch die Raster der empirischen Bildungsforschung. In Berichten wie dem von Giessler Furlan wird er erahnbar. Vorausschauende Bildungspolitik müsste sich an ihnen orientieren.
Keywords
Wallah, Chillen, Hurensöhne,
Schwuchtel, Jude, Ehrenmann,
Spacko, Lappen, Nackenklatsche,
Zigo, Bratan, fuckt mich ab
Vorbemerkungen
Hauptschule, dreizehn Monate, Vertretung für einen erkrankten Lehrer, in einer abgewirtschafteten westdeutschen 100.000-Einwohner-Stadt. Ich war schon in der Fremde, aber nirgends fühlte ich mich so befremdet wie an dieser Schule, dreißig Kilometer entfernt von der eigenen Haustür. Im Einzelnen war mir nichts neu, in der Ballung aber hat es mich betrübt: der raue Umgangston, die Bildungsferne, die Fixierung aufs Smartphone, das patriarchale Gehabe, die Betonung der Nationalität bzw. Ethnie, schließlich das Prestige der Religion, die Selbstbesessenheit des Islams und der verbreitete Glaube an die Hölle.
Die Aufzeichnungen entstammen meinen Notizen, die ich nach den Schultagen in der S-Bahn niederschrieb, zumeist aus dem Bedürfnis heraus loszuwerden, was mir zusetzte, gelegentlich auch, um Schönes oder Lustiges festzuhalten. Wie im Titel angekündigt, handelt es sich um keine Analyse, sondern um Einblicke – mitunter unbewältigte, lückenhafte und widersprüchliche. So, wie im Folgenden in Worte gefasst und arrangiert, sollen sie die Konstellation verdeutlichen, in der Hauptschullehrer zurechtkommen müssen. Stärker strukturiert und erläutert, als dies in der Realität der Fall ist, werden sie nur stellenweise, insbesondere am Textanfang, um in die Begebenheiten des Hauptschulalltags einzuführen.
Alle Namen habe ich geändert, ihre ethnischen, religiösen und sozialen Anklänge aber belassen. Ach, herrje! – der ethnische, religiöse und kulturelle Hintergrund. Er wird im Folgenden zumeist mitgenannt, alles andere wäre realitätsfern. Viele der Schüler schieben ihn vor sich her, halten sich an ihm fest oder bleiben ihm gedankenlos verhaftet, teils, weil sie sich in Deutschland abgelehnt fühlen, teils, weil sie zur Wahrung ihres Blutes vulgo ihrer Identität erzogen werden (etwa im Geiste jener Rede, die Erdoğan am 10. Februar 2008 an seine »Brüder und Schwestern« in Deutschland richtete). Sofern der nämliche Hintergrund auch bei jenen erwähnt wird, die sich von ihm lösen und als Individuen hervortreten, dann, um diese Emanzipation darzutun – würdigend, was menschenmöglich ist.
Meine Fächer
Hauptsächlich wurde ich für den Nichtkonfessionellen Religionsunterricht, nebenbei auch noch als Lehrer für Geschichte, Erdkunde, Deutsch und Deutsch als Zweitsprache (DaZ) eingeteilt. In der Praxis hatte ich nur fünfzig Prozent festgelegten Unterricht. In der restlichen Zeit diente ich als Springer in unterschiedlichen Fächern, um Krankenausfälle zu kompensieren.
Das Kollegium und die Schulleitung waren untereinander und mir gegenüber hilfsbereit und, was die Bewältigung des Arbeitsalltags anbelangt, begrüßenswert pragmatisch.
Religionsunterricht
Während der Unterricht normalerweise im Klassenverband stattfindet, erfolgt der Religionsunterricht in Kursen. Vier Kurse stehen zur Auswahl: Katholische Religion, Türkischer Islamunterricht, Arabischer Religionsunterricht und Nichtkonfessioneller Religionskurs. Besucht wird Letzterer, für den ich verantwortlich war, mehrheitlich von Orthodoxen und Protestanten, überdies von ein paar Evangelikalen und Atheisten, ferner auch von Zeugen Jehovas, Jesiden, Hindus, Sikhs sowie von vereinzelten Katholiken und Muslimen, die keine Lust auf katholischen oder islamischen Religionsunterricht oder bestimmte Lehrer haben.
Blöcke
Die Neunzig-Minuten-Schuleinheiten heißen Blöcke. Einst wurden sie anstelle von 45-Minuten-Einheiten eingeführt, um die vertane Zeit beim Beginnen und Beenden von Schulstunden zu halbieren. Aber neunzig Minuten sind für viele Hauptschulklassen zu viel, sodass sich Extrapausen innerhalb der Blöcke und Klassenzimmer eingebürgert haben und sich die Unterrichtszeit unterm Strich verkürzt hat.
Erster Tag
An meinem ersten Arbeitstag war ich nur als Beisitzer eingeteilt.
Erster Block: Englisch in der 5b. Der Lehrer blieb ruhig, obwohl die Klasse laut war. Phoebe musste oder durfte fünf Minuten raus, um einen Lachkrampf auszukurieren, mit dem sie sich mitten im Unterricht auf dem Boden gewälzt hatte. Das Englischniveau ist höher als in der fünften Klasse, die ich 1990 in Ostdeutschland besuchte.
Zweiter Block: Geschichte in der 6b. Der Lehrer wurde öfter laut und schrie »Ruhe«. Die Klasse blieb unruhig. Ich durfte auch mal zehn Minuten unterrichten, bin ruhig geblieben, die Klasse unruhig.
Kennenlernen
8d, Religionsunterricht: Ein Islamlehrer fehlte, das Kurssystem scheiterte. Eine Kollegin und ich wurden der 8d zugeteilt. Beide waren wir unvorbereitet, ich schlug der Klasse eine Kennenlernrunde vor. Die meisten stellten sich, wohl dem Vorbild des ersten Schülers folgend, mit Name und Nationalität vor. Türken, Kurden aus Syrien und der Türkei, ein Albaner, ein Tamile aus Sri Lanka, ein Sikh aus Indien, ein Syrer, der Wert darauf legte, einen Vater zu haben, der in Saudi Arabien ein gemachter Mann sei, und eine Schülerin, die meinte, sie wolle wieder zurück nach Bayern, woher sie komme. Daraufhin bekundeten auch andere Schüler, später wieder zurück in ihre Heimat bzw. die ihrer Eltern zu wollen.
Daraufhin ich: »Aber stellt euch vor, ihr verliebt euch hier, etwa in eine Deutsche. Dann bleibt ihr doch hier, oder?«
Gelächter. Der Kurde erklärend: »Die Eltern suchen aus, wen wir heiraten; bestimmt keine Deutsche.«
Die Lehrerin: »Aber ihr dürft doch mitentscheiden?«
Man könnte protestieren, aber nicht so richtig entscheiden, erklärten uns die Moslems und der Sikh.
Die Lehrerin: »Gibt es eine Probezeit? Könnt ihr eure zukünftige Frau vor der Hochzeit unverschleiert sehen? Nicht, dass sie hässlich ist!«
Die Jungs wieherten vor Lachen und klärten uns auf: Die Mutter könne die zukünftige Schwiegertochter unverschleiert zu Gesicht bekommen. Außerdem, wenn etwas mit der künftigen Frau nicht stimme, so sei deren Familie verpflichtet, das vorher mitzuteilen. »Da wird zwischen den Familien schon abgecheckt, ob das Mädchen etwas kann.«
»Was kann?«
»Na Küche, Haushalt und so.«
»Und der Mann, muss der auch im Haushalt was können?«, fragten wir weiter. Die Jungs in der Klasse lachten wieder los und erzählten sich gegenseitig, wie sich ihre Väter verhielten: »Meiner kommt nach Hause und knallt sich sofort aufs Sofa. Bei uns ist das so: Die Männer müssen Geld verdienen und die Frauen den Haushalt machen.«
Auf direkte Nachfrage, was sie später werden wolle, antwortete die ansonsten schweigsame türkische Schülerin knapp: »Hausfrau.«
Meine Kollegin berichtete von Musliminnen, die kein Kopftuch tragen und arbeiten gehen. »Kein Kopftuch? Das darf man als Muslima nicht!«, intervenierte der Syrer mit Papa in Saudi-Arabien lauthals.
Kompetenz
Am dritten Tag erhielt ich von der Schulleitung meinen Stundenplan und erblickte darauf das Fach Gesellschaftslehre (Geschichte/Politik). Um zu wissen, was in welchem Jahrgang zu lehren sei, lud ich mir auf der Homepage der Schulbehörde den entsprechenden Lehrplan herunter und verschwendete Zeit darauf, in ihn hineinzulesen.
Es ist nicht so richtig klar, ob dieser Lehrplan noch ernst gemeint oder schon eine Karikatur jener Beschwörungstänze ist, die in den Schulbehörden und Pädagogikhochschulen seit geraumer Zeit rund um das Wort der Kompetenz dargebracht und immer bizarrer werden. Ich bemühte die Suchfunktion. Auf 62 nicht gerade dicht beschriebenen Seiten fand sich der Wortstamm 194-mal. In allerlei Verbindungen, die die Autoren – allem Anschein nach Nominalstilisten mit Kompositakompetenz – zu bilden in der Lage waren: »Methodenkompetenz«, »Kompetenzerwartungen«, »soziale Kompetenzen«, »Urteilskompetenzen«, »gesellschaftswissenschaftliche Kompetenzen«, »Sachkompetenzen«, »Kompetenzentwicklung«, »Handlungskompetenzen«, »alltagssprachliche Kompetenzen«, »historisch-politische Kompetenzen«, »vertiefte Kompetenz«, »Kompetenzbereiche« und »vernetzte Kompetenzen«. Tatsächlich um Gesellschaft, Geschichte und Politik (im Lehrplan »Inhaltsfelder« genannt) geht es nur ganz dünn am Rande.
So unverfroren macht sich im Bildungswesen das Desinteresse an den Inhalten breit. Letztlich bedeutet das auch für die Fähigkeiten (= Kompetenzen) nichts Gutes, die sich schließlich nicht an sich, sondern in Beziehung zu ihren Inhalten und Bestimmungen entwickeln.
Zusammensetzung der Schülerschaft
Die meisten Schüler erlangen an dieser Schule den Haupt-, ein paar auch den Realschulabschluss. Achtzig Prozent der Schüler (und zwanzig Prozent der Lehrer) haben einen Migrationshintergrund; vierzig bis fünfzig Prozent sind Muslime; sechzig Prozent Jungs.
Tigrans Bühne
10. Klasse, Vertretungsunterricht: Tigran fiel als Erster im Klassenraum auf. Hyperaktiv und attraktiv, wie er war, warf er sich johlend mal auf einen Mitschüler, mal auf eine Mitschülerin, aalte sich auf Bänken und ließ sich kitzeln.
Es klingelte zum Stundenbeginn und ich wollte wissen, welche Berufe die Schüler nach der Schule anstrebten. Krankenschwester, Zuhälter, Maschinenbauer, Drogendealer, Dönerladenbesitzer waren die mehr oder weniger ernst gemeinten Antworten. Wieder fiel mir auf, was schon in anderen Klassen meine Aufmerksamkeit geweckt hatte: Die wenigen Schüler ohne Migrationshintergrund wirken mehrheitlich wie Schlaftabletten, während nicht wenige Schüler mit Migrationshintergrund, etwa Tigran aus Armenien, hyperagil zu sein scheinen.
Dann berichtete mir die Klasse, sie hätten den Lehrer vor mir, der in einer Vertretungsstunde Unterricht habe durchsetzen wollen, mit Papierkugeln beworfen. »Wir hassen Lehrer«, meinte einer. Ich fragte nach, ob es nicht besser sei, Unterricht zuzulassen, wegen Abschlussprüfung und Abgangszeugnis. Und Tigran fragte mich, ob er nach hinten zu einer Mitschülerin dürfe, er habe nämlich Druck. Da war er schon unterwegs, deutete Kopulation an, stürzte sich auf seine Mitschülerin, die fröhlich aufkreischte, während er lauthals bekundete, einen Ständer zu haben. Die Klasse johlte.
Um nicht mit Papierkugeln beschmissen zu werden, beschränkte ich mich auf die Rolle eines Betreuers im Jugendclub. Ich setzte nur Grenzen, wenn es zu laut oder ungestüm wurde, ging im Raum rum und führte freundlich Gruppen- und Einzelgespräche. Man könnte von »vertrauensbildenden Maßnahmen« sprechen, soweit damit weder der prekäre Zustand verleugnet wird, worin sie nottun, noch die Gefahr, seitens der Schüler für immer auf diese pädagogische Methode reduziert zu werden.
Willkommensklassen
Die Willkommensklassen dienen dazu, Schülern, welche die deutsche Sprache nicht beherrschen, diese beizubringen, bevor sie, je nach Talent nach ein oder zwei Jahren, in die sogenannten Regelklassen kommen. Etwa die Hälfte der Willkommensklassenschüler stammt aus Vorderasien und Nordafrika, ein Viertel aus Südosteuropa, ein weiteres Viertel aus dem Rest der Welt. Die Willkommensklasse A besteht aus Anfängern (zwölf- bis sechzehnjährig), die Willkommensklasse B aus Fortgeschrittenen (dreizehn- bis siebzehnjährig). Im Kontrast zu den Willkommensklassen werden die herkömmlichen Klassen Regelklassen genannt.
Haram
Willkommensklasse B: Unvorbereitet erfuhr ich, gleich als Vertretung in den Deutschunterricht in die Willkommensklasse zu müssen. Ich schnappte mir im Lehrerzimmer eine ausgelesene »Bild«-Zeitung und schnitt verschiedene Texte zu verschiedenen Themen wie Fußball, Politik, Lokales, Klatsch und Tratsch heraus. In Arbeitsgruppen sollten die Texte gelesen und vorgestellt werden. Bei einem Text über einen syrischen Flüchtling, der seine syrische Freundin erstochen hat, weil diese ihn hatte verlassen wollen, hatte ich Bedenken: Würden sich die syrischen Schüler durch den Text in ein schlechtes Licht gerückt fühlen?
Weit gefehlt, genau diese drei Syrer (alles Jungen) krallten sich den Text. Sie kannten den Fall aus den sozialen Netzwerken, wie sie mir aufgeregt auf ihren Smartphones demonstrierten.
Nachdem sie den Vorfall sachlich geschildert hatten, fragte ich, was sie davon hielten. Ihre Antwort: »Eine Frau mit einem Messer angreifen? Das ist haram.«
Florinel, ein bulgarischer Junge, setzte aus dem Auditorium mit fester Stimme hinzu: »Ein Mann, der eine Frau angreift, macht sich selbst zu einer Frau.«
Während der Arbeitsgruppenphase in der Willkommensklasse B ging ein Schüler irakisch-kurdischer Herkunft durch die Klasse, um zu gucken, was die anderen AGs für Texte hätten, aber eigentlich, um seinen Bewegungsdrang zu stillen. Weil ich ihn nicht gleich stoppte, verfiel er im Rumlaufen in einen kurdischen Tanz (»Ich tanze Dabke«) und zog alle Aufmerksamkeit auf sich, was es dann schwieriger machte, ihn zu stoppen.
Vlad heißt mich willkommen
6. Klasse, Religionskurs: Der Islamlehrer war krank. Diesmal, im Jahrgang sechs, wurde das Kurssystem aufrechterhalten, indem seine Schüler auf die restlichen Kurse aufgeteilt wurden.
Ich wollte in meinem Kurs jedes Kind kennenlernen und hatte drei Fragen an die Tafel geschrieben. Aus den geplanten zwanzig Minuten Vorstellungsrunde wurden siebzig. Nicht, weil es so gut lief, sondern weil die Mehrheit im Kurs triebhaft oder bewusst keinen Unterricht zuließ.
»Können wir mit unseren Handys spielen?«
»Unser Klassenlehrer erlaubt uns das.«
»Herr Giessler, können Halima, Dani und ich mal rausgehen? Wir müssen etwas Wichtiges besprechen!«
»Herr Lehrer, kann ich mir unten im Schulimbiss ein Getränk kaufen?«
»Es ist der letzte Block, ich habe Durst.«
Nebenbei auch noch dies: Alexander, ein Russlanddeutscher, klein und unschuldig guckend, provozierte hinter meinem Rücken eine eingeschworene Jungengruppe (John, Dominic, Lucian, Faris und last but not least Vlad), die sich nicht zweimal bitten ließ. »Hast du Hurensohn gesagt, hast du meine Mutter beleidigt?« Ein Wort gab das andere. Drohende Gebärden obendrein. Probehalber sprang man schon mal Richtung Gegner auf. Ich drohte nicht mit Aktennotizen; als Anfänger waren mir deren System und Gewicht noch fremd. Aber immerhin behielt ich die Kontrolle, zwar nicht über den Unterricht, an den in den letzten dreißig Minuten nicht mehr zu denken war, aber als Dompteur.
Doch kaum dass es klingelte und alle aufsprangen, kam es noch im Klassenraum zur Prügelei. Ich ging schnell dazwischen, sodass nichts weiter passierte, und hatte somit nicht Feierabend, sondern Diskussionen an der Backe. Alexander behauptete, ihm seien von seinen Kontrahenten zwei Euro entwendet worden, Faris erklärte mir stolz, er sei Klassensprecher und lasse sich von mir nichts sagen, Vlad, der dickste und schwungvollste Kämpfer, den ich hatte stoppen müssen, grinste mich an und hieß mich willkommen.
Aktennotiz
Für außerordentlich schlechtes Benehmen (Unterrichtssabotage, Vandalismus, Prügeleien et cetera) erhalten Schüler eine Aktennotiz. Hat ein Schüler eine bestimmte Anzahl von Aktennotizen überschritten, wird eine Schulkonferenz (Schulleitung, Lehrervertreter, Elternvertreter, Schülervertreter) einberufen und der bezichtigte Schüler samt seinen Eltern vorgeladen; nach wiederholter Schulkonferenz droht dem Schüler der Schulausschluss.
Конец ознакомительного фрагмента.