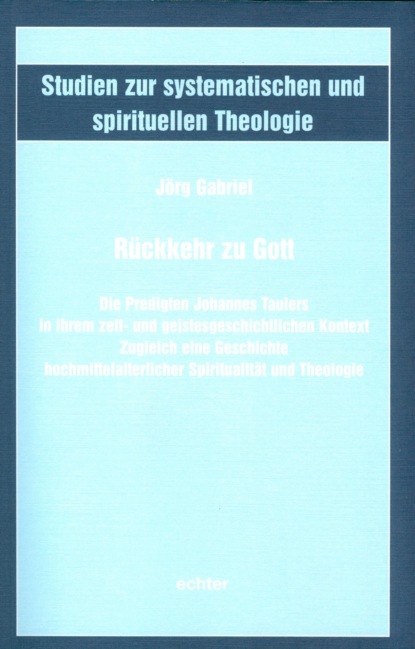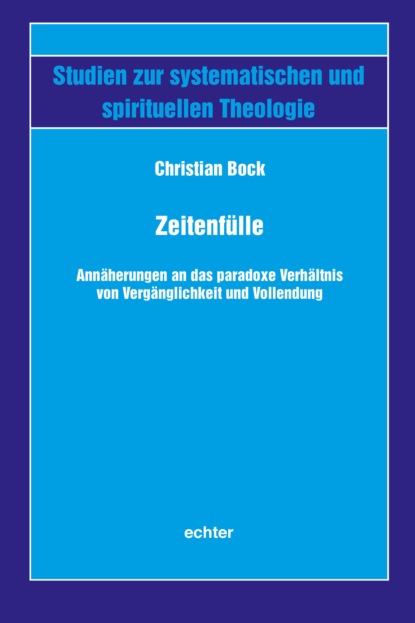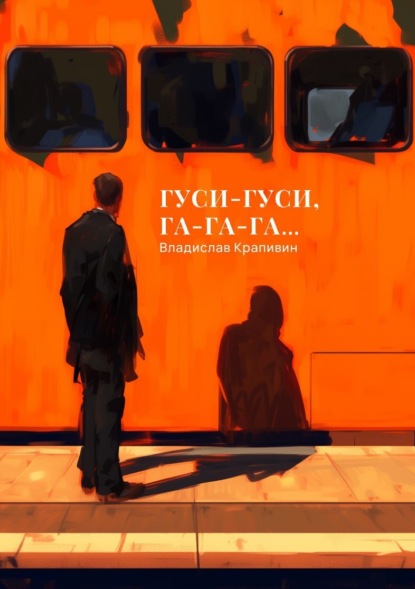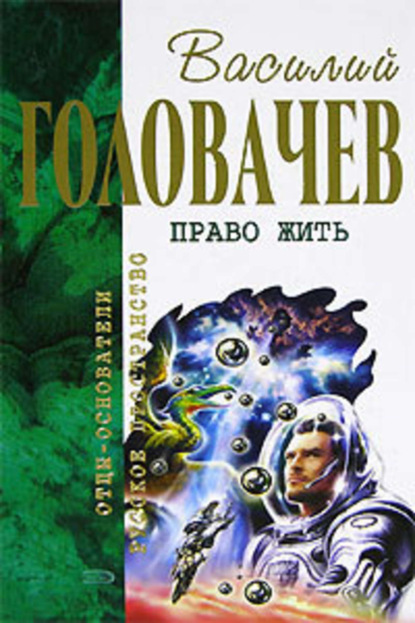- -
- 100%
- +

Jörg Gabriel
Rückkehr zu Gott
Studien zur systematischen und spirituellen Theologie
49
Herausgegeben von
Gisbert Greshake, Medard Kehl
und Werner Löser
Jörg Gabriel
Die Predigten Johannes Taulers in ihrem zeit- und geistesgeschichtlichen Kontext Zugleich eine Geschichte hochmittelalterlicher Spiritualität und Theologie

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
© 2013 Echter Verlag GmbH, Würzburg
www.echter-verlag.de
Druck und Bindung: Druckerei Friedrich Pustet, Regensburg
ISBN 978-3-429-03570-9 (Print)
978-3-429-04684-2 (PDF)
978-3-429-06083-1 (ePub)
Vorwort
Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2009/10 vom Fachbereich katholische Theologie der Ruhr-Universität Bochum als Dissertation angenommen. Herzlich möchte ich allen danken, die an der Entstehung dieser Arbeit durch Wort und Tat beteiligt waren. Ganz besonders danke ich meinem langjährigen Provinzial, Pater Dietmar Weber, der mir immer wieder Mut gemacht hat, und meinen Mitbrüdern der deutschen Ordensprovinz der Kamillianer für die Ermöglichung der Promotion, Herrn Prof. Dr. Markus Knapp für die engagierte und wohlwollende Begleitung, Herrn Prof. Dr. Wilhelm Damberg für wichtige Anregungen, den Herren Professoren Dr. Gisbert Greshake, Dr. Medhard Kehl S.J. und Dr. Werner Löser S.J. für die Aufnahme in die Reihe „Studien zur systematischen und spirituellen Theologie“. Besonders bedanken möchte ich mich aber auch bei Frau Gertrud Tillmanns und bei Herrn Dr. Kurt Viefhaus. Ich widme diese Arbeit meinen Eltern sowie Frau Irmela Richter.
Essen, den 14. Juli 2012 Pater Jörg Gabriel
Inhaltsverzeichnis
EINLEITUNG
Erstes Kapitel: Taulers Leben und Nachwirken
I. Taulers Leben II. Taulers NachwirkenZweites Kapitel: Forschungsstand
Drittes Kapitel: Absicht dieser Arbeit
Viertes Kapitel: Überlieferung und Textgrundlage
I. Überlieferung und Drucktradierung von Taulers Predigten II. Zur Textgrundlage und ÜbersetzungERSTER TEIL
Historische Grundlagen – neue religiöse Bewegungen
Erstes Kapitel: Auslöser – Die Reformen Clunys und Papst Gregors VII.
Zweites Kapitel: Neue Mönchsorden
I. Kartäuser und Zisterzienser II. Die Bedeutung der Zisterzienser für das geistliche Leben III. Die Spiritualität des heiligen Bernhard von Clairvaux (1090 – 1153) 1. Bernhards Predigten über das „Hohelied“ 2. Vom „geistigen Adel“ des MenschenDrittes Kapitel: „Vita evangelica et apostolica“ – Wanderpredigt und die Entstehung neuer Orden
I. Wanderprediger II. Robert von Arbrissels Doppelklöster und Norbert von Xantens Prämonstratenser III. Frauenklöster im ZisterzienserordenViertes Kapitel: „Sektenbildung“ seit dem 12. Jahrhundert
I. Die Waldenser II. Die Katharer III. Die „freien Geister“ 1. Möglicher historischer Ursprung und Verbreitung 2. Die freigeistige Irrlehre im Schwäbischen Ries (1270/73) IV. Das freigeistige Denken im 14. JahrhundertFünftes Kapitel: Laienbruderschaften und die Wende in der Einstellung zu den religiösen Bewegungen unter Innozenz III. (1198 – 1216)
I. Die Humiliaten – Verketzerung und Versöhnung II. Neue Wege in der Bekämpfung von sogenannten Sekten III. Die Dominikaner IV. Versöhnung mit Teilen der Waldenser – die „Katholischen Armen“ V. Die FranziskanerSechstes Kapitel: Die religiöse Frauenbewegung
I. Die Beginen II. Die Frauenklöster und die Frage der „Cura monialum“ im Dominikanerorden III. Ein fruchtbarer DialogZWEITER TEIL
Geistesgeschichtliche Grundlagen – dominikanische Spiritualität und die „deutsche Albertschule“
Erstes Kapitel: Spiritualität des hl. Dominikus und des Predigerordens
I. Wesenselemente dominikanischer Spiritualität 1. Die Predigt 2. Die Kontemplation 3. Die Armut II. Christozentrische Spiritualität III. „Spiritualität der Menschwerdung“ bei Johannes TaulerZweites Kapitel: Die „deutsche Albertschule“ und die Lehre des Intellekt
I. Albertus Magnus (1193 – 1280) 1. Der Einfluss des Averroes auf Albertus Magnus´ Intellekt-Lehre 2. Alberts Intellekt-Spekulation – substantiale Einheit der Seele II. Dietrich von Freiberg (1250 – um 1318/20) 1. Der tätige Intellekt (intellectus agens) – das Göttliche im Menschen 2. Der mögliche Intellekt (intellectus possibilis) – Akzidenz und Substanz zugleich 3. Meister Dietrich: Ein „Schlüssel“ zum Verständnis von Meister Eckhart und zur „deutschen Mystik“ III. Berthold von Moosburg (14. Jahrhundert) 1. Das Unum in der neuplatonischen Philosophie des Proklos 2. Bertholds Lehre des „Unum in nobis“ – das „Eine in uns“Drittes Kapitel: Meister Eckhart – aus der Ewigkeit in die Zeit
I. Gottesgeburt – trinitarische Entfaltung II. Esse est Deus – Sein und Denken im einen und dreifaltigen Gott III. Der Mensch – Seele und Seelenfunken IV. Gelassenheit – Abgeschiedenheit – Armut des Geistes 1. Gelassenheit 2. Abgeschiedenheit 3. Armut des GeistesViertes Kapitel: Heinrich Seuse – Meister Eckharts theologisch-mystische Positionen im „Büchlein der Wahrheit“
I. Vom „namenlosen“ Gott II. Vom dreieinen Gott III. Vom Schöpfergott und vom Dasein der Geschöpfe in Gott IV. Wahre Gelassenheit durch die Inkarnation Christi V. Wie wird der Mensch gelassen und kommt zur Seligkeit VI. Falsche Gelassenheit und ungeordnete Freiheit VII. Äußere Merkmale des in Gott gelassenen MenschenDRITTER TEIL
Rückkehr zu Gott – Johannes Taulers Lebenslehre
Vorbemerkung
Erstes Kapitel: Gottes Ruf in den Ursprung – die Rückkehr des Menschen zu Gott
Zweites Kapitel: Gottes trinitarische Dynamik – Nähe und Ferne
Drittes Kapitel: Gottes trinitarische Dynamik als Bild in der Seele des Menschen
I. Das Bild Gottes im Grund der Seele II. Der Mensch – geschaffen zwischen Zeit und Ewigkeit 1. Der „äußere Mensch“ und die „äußeren Kräfte“ 2. Der „innere Mensch“ und die „inneren Kräfte“ 2.1. Die Vernunft 2.2. Der Wille 2.3. Die Liebe 3. „Drei Menschen“ und doch „einer“ 3.1. Drei „Dinge“ im Menschen 3.2. Der lautere menschliche Geist – Geist, Gemüt und Grund 3.3. Der Grund in der Seele des MenschenViertes Kapitel: Rückkehr in den göttlichen Ursprung – dem Beispiel des trinitarischen Gottes folgen
I. Dem Vorbild des Vaters folgen – Einkehr und Selbsterkenntnis II. Dem Vorbild des Sohnes folgen – Kreuzesnachfolge und Himmelfahrt 1. Kreuzesnachfolge 2. In den Himmel nachfolgen III. Der Heilige Geist – Kraft für die bleibende Verbindung zwischen Gott und Mensch 1. Das Wirken des Heiligen Geistes im Menschen 1.1. Der Heilige Geist „itelt“ („leert“) und „fúllet das ital“ („füllt das Leere“) 1.2. Der Heilige Geist straft 2. Die sieben Gaben des Heiligen Geistes IV. Weitere Hilfen für den Menschen 1. Die Engel und die Gottesmutter 2. Hilfe durch die kirchlichen Sakramente 2.1. Die Beichte 2.2. Die heilige EucharistieFünftes Kapitel: Rückkehr in den einen, fernen Gott
I. Die „Eigenschaften“ des einen, fernen Gottes II. Die Breite, Länge, Tiefe und Höhe Gottes III. Zusammenfassung – Vollreife des LebensSechstes Kapitel: Der Gott nahe, aber sich von Gott entfernende Mensch
I. Welt und Mensch haben sich „verirrt“ – der Mensch ist „krank“ 1. Die pharisäischen Christen 2. Die „Schriftgelehrten“ und die falsche Müßigkeit der freien Geister 3. Die „Krankheit“ des Menschen und ihre Symptome 3.1. Taubheit und Blindheit 3.2. Übertriebene Sorge um vergängliche Dinge – Habgier und Unglaube 4. Zusammenfassung: „Fünf Gefangenschaften“ II. Der Mensch als Sünder – eine Vergiftung infolge der Erbsünde 1. Gewohnheits- und Gelegenheitssünden 2. Vier Arten von SündernSiebtes Kapitel: Die Gottesfreunde
I. Helfer auf dem Weg zurück zu Gott II. Solidarische Liebe in der KircheAchtes Kapitel: Nicht ein Weg, sondern verschiedene Wege
I. Verschiedene Ämter, aber ein Geist II. Gott ruft zu verschiedenen Wegen 1. Dreierlei Leute: Beginnende, Zunehmende, Vollkommene 2. Verschiedene Heilige 3. Vier Maße – zwei Wege III. Mensch und Gott suchen einander – aktives und passives Suchen 1. Das wirkende Suchen – äußerliche gute Werke und Einkehr in den Grund 2. Das leidende Suchen – von Gott gesucht werdenNeuntes Kapitel: Wege zur Gelassenheit
I. Die verschiedenen Bedeutungen des Begriffs Gelassenheit 1. Äußere Gelassenheit 2. Innere Gelassenheit II. Sich loslassen – die Erkenntnis des eigenen Nichts 574 1. Erschaffenes, gebrechliches und lauteres Nichts 576 2. Umkehr auf dem Weg des „Ich bin Nichts“ III. Sich Gott überlassen – das Leiden 1. Frieden im Unfrieden 2. Vom „Alten Bund“ in den „Neuen Bund“ 3. „Myrrhe“ – Bitterkeit, um Gott zu finden 4. Das Ziel: vollkommene Gelassenheit IV. Gott-Leiden – die „Arbeit der Nacht“ 1. Von Gott verlassen – Leiden am finsteren Gott 2. Sich der Finsternis Gottes hinkehren – wesentliche Umkehr und Erneuerung 3. Versuchungen durch den Feind 4. Der Mensch wird gejagt – die DynamikZehntes Kapitel: Übungen zur Gelassenheit – die Tugenden
I. Die Tugenden Jesu Christi 1. Tugendleben als Nachfolge – Demut, Sanftmut und Geduld 2. Die Evangelischen Räte – die Armut des Geistes II. Die Klugheit und die Abgeschiedenheit zur Vorbereitung auf den Empfang des Heiligen Geistes III. Die Liebe als Weg zur Einheit mit Gott 1. Die verwundete, gefangene, quälende und rasende Liebe 2. Die süße, weise und starke Liebe IV. Auf den Berg der Seligpreisungen steigen V. Zusammenfassung: die fünf Tore zur Gesundung des MenschenElftes Kapitel: „Ein Gegenstand, der nicht jedermann angeht“ – der eine Stufenweg in die vollkommene Einheit mit Gott
I. Von den Graden des „mystischen Lebens“ 1. Der erste Grad: der Jubel (jubilacio) 2. Der zweite Grad: die Bedrängnis (getrenge) 3. Der dritte Grad: der Übergang (úbervart) II. „Duc in altum“ – „fahre in die Höhe“ 1. Den Grund in die Höhe erheben 2. Wiederaufstehung in GottSCHLUSSREFLEXION
Taulers christliche Spiritualität im Kontext der heutigen Spiritualitäten
Vorbemerkung
Erstes Kapitel: Spiritualität und Mystik – eine Verhältnisbestimmung
Zweites Kapitel: Ein Dialog von christlicher Mystik und theologischer Lehre
Drittes Kapitel: Spiritualität und Mystik heute
I. Östliche Religionen II. Grundzüge moderner Spiritualitäten III. Dialog mit anderen Religionen und modernen SpiritualitätenViertes Kapitel: Taulers Spiritualität – eine theologische Reflexion
I. Der Ausgangspunkt: Taulers Gottesbild II. Das eine trinitarische Sein Gottes als die eigentliche Wirklichkeit 1. Die theologische Mitte: Trinität und Kreuz 2. Gottes Personalität als Bedingung der Möglichkeit für das Personsein des Menschen 3. Der Grund der Seele als „Personmitte“ 4. Ein dialektisches Verhältnis: Gott und Mensch III. Einkehr und Gelassenheit 1. Der trinitarische Gott – Bedingung der Möglichkeit und Vorbild für Einkehr und Gelassenheit 2. Der trinitarische Gott als Idealbild für vollendetes Personsein 3. Der trinitarische Gott als Vorbild für die „spirituelle Methode“ 3.1. Das Vorbild des Vaters: die Selbsterkenntnis 3.2. Das Vorbild des Sohnes: die Gelassenheit 3.3. Das Vorbild des Heiligen Geistes: die gelebte Liebesgemeinschaft IV. Leben aus dem Glauben in der Einheit mit Gott V. Vor- und Nachteile von Taulers theozentrischem Wirklichkeitsverständnis 1. Geborgen und Aufgehoben in Gottes Sein 2. Verantwortung des Menschen gegenüber Schöpfung und Gott 3. Totale Abhängigkeit von Gott 4. Vereinnahmung durch Gott 5. Zu Taulers EucharistieverständnisFünftes Kapitel: Taulers Spiritualität im Kontext des heutigen Spiritualitätsverständnisses
Sechstes Kapitel: Taulers Spiritualität im Kontext einer modernen Spiritualität
I. Das Denken des „Einen“ in der transkonfessionellen Spiritualität Willigis Jägers II. Rückfragen christlicher Theologen III. Das Denken des „Einen“ bei Tauler und EckhartPraktische (konkrete) Perspektiven