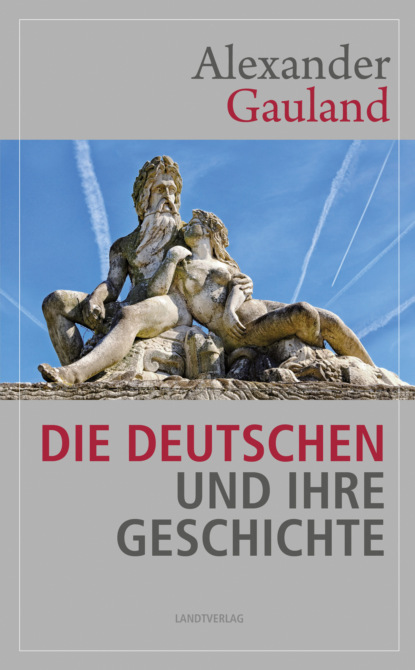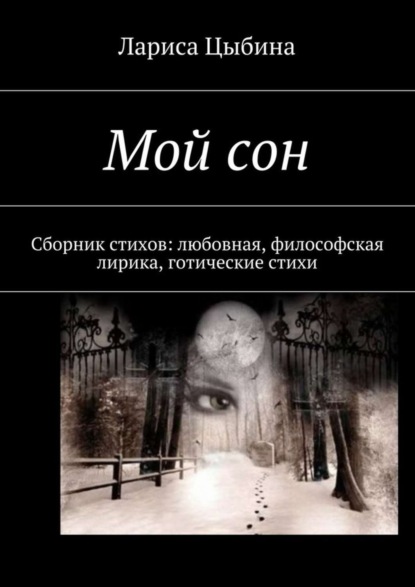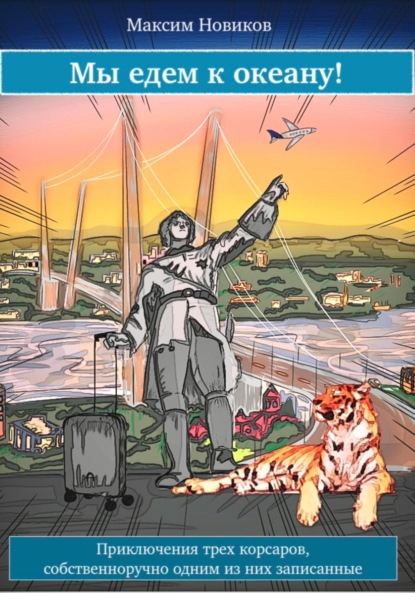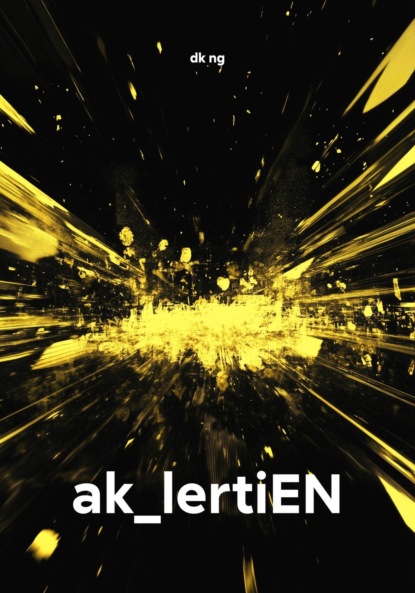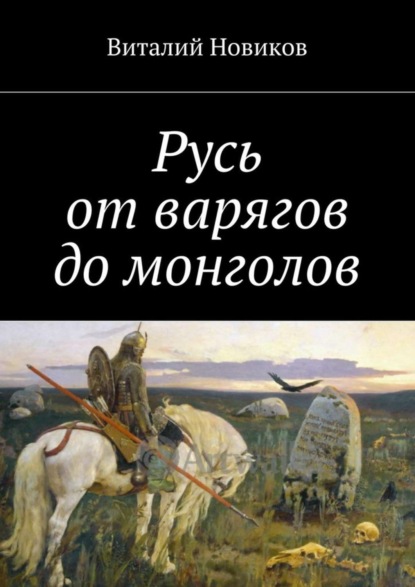- -
- 100%
- +
Das hochmittelalterliche Kaiserreich blieb auch unter den Staufern ein personaler Herrschaftsverband, dessen Oberhaupt eher symbolische als tatsächliche Macht ausübte, dessen Rechtsstellung undeutlich blieb und immer von neuem austariert werden musste, während ihm gegenüber die Reichsstände, die geistlichen und weltlichen Reichsfürsten, ihre Stellung befestigten. Nur im Hausgut herrschte der Kaiser unbeschränkt. Als Barbarossa auf dem dritten Kreuzzug 1190 im Kalykadnus in Kleinasien, der heutigen Türkei, ertrank, war das Reich so ungefestigt, dass zwei Gegenkönige, Philip von Schwaben und Otto IV. aus dem welfischen Haus, das Reich in einen Bürgerkrieg stürzen konnten. Nur die Ankunft eines Genies, des letzten Stauferkaisers, des »Staunens der Welt«, führte das mittelalterliche Kaisertum noch einmal in ungeahnte Höhen. Doch es waren keine institutionell abgesicherten Höhen, es war die Genialität eines Einzelnen und konnte deshalb nicht dauern. Mit dem Tod Friedrichs II. von Hohenstaufen verschwindet ein Zauber aus der deutschen Geschichte. Sein Reich zerfiel, seine Persönlichkeit aber leuchtete bis in die dunkelsten Tage des 20. Jahrhunderts.
Als die nationalsozialistischen Schergen am Morgen des 9. April auf Hitlers persönlichen Befehl Admiral Canaris, General Oster und Pfarrer Bonhoeffer in Flossenburg erhängten, fanden sie in der Zelle von Canaris seine letzte Lektüre – Ernst Kantorowicz: Kaiser Friedrich II., das die Widmung trägt »Seinen Kaisern und Helden das Geheime Deutschland«. In der Figur dieses Stauferkaisers haben sich so gegensätzliche Charaktere wie Hitler und Stauffenberg gespiegelt, und der Streit darüber, wer dabei Recht hatte, hält bis heute an.
Mit Friedrich II. drängt Deutschland noch einmal ins Weite, Große, ins Abendländisch-Christlich-Römische, ist es Subjekt der Weltgeschichte. Danach fällt es zurück ins Enge, Provinzielle, wird Objekt fremder Begierden, und seine Herrscher sind nur noch ein matter Abglanz der Stauferherrlichkeit. Oder um es mit den Worten seines Biographen zu sagen: »Zum einzigen Mal in der Geschichte war damit für das ganze große, vielspältige Deutschland die Lösung des so nie wieder gelösten deutschen Problems geglückt – zum einzigen Mal wurde die adlige Jugend, die ja auch Stifte und Klöster füllte, auf eine Form hin erzogen, die nicht nur in den Grenzen der engsten Heimat, sondern überall in der Welt Geltung hatte – das einzige Mal auch, dass die Deutschen wirklich etwas im besten Sinne Weltmännisches hatten. Da war denn der Boden bereitet für eine große deutsche Plastik, die freilich in dem Augenblick jäh abbrach, als mit dem Sturz des Reiches das Rittertum, von der Welt abgeschnitten, in bürgerlicher Enge verdumpfte oder aber Deutschland verlassend in fremdem Sold kämpfte«.
Nach dem Tode Friedrich Barbarossas führt sein Sohn Heinrich VI. die staufische Weltmonarchie auf ihren Machtgipfel. Durch seine Heirat mit Constanze, der Erbin des Normannenreiches in Apulien und Sizilien, gewinnt er dem staufischen Weltmachtanspruch eine neue Basis. Doch sein früher Tod verhindert ihren Ausbau. Sein Sohn und Erbe Friedrich beginnt seine Laufbahn als verwahrloste Waise, als Spielball deutscher, päpstlicher und lokaler sizilianischer Interessen in der Königsburg von Palermo. Dass der dem Hungertod nahe und von der Barmherzigkeit einiger Bürger lebende Staufersproß neben dem Volgare, der italienischen Volkssprache, Latein, Griechisch, Hebräisch, Arabisch, Französisch und Provenzalisch lernt, ist das erste Wunder, das zweite sein berühmter Zug nach Deutschland, wo er, anfangs nur von wenigen Rittern begleitet, das deutsche Königtum von dem Welfen Otto IV. zurückgewinnt. Unterstützt von seinem päpstlichen Vormund Innozenz III. siegt er – wie später Napoleon auf seinem Adlerflug von Elba nach Paris – nicht durch Macht, sondern durch Charisma, Glück, Charme und Klugheit. Es erfüllt sich der alte Mythos: Immer – so heißt es – müssten die Waiblinger (Staufer) auch die Kaiser sein, die Welfen aber stets deren Vasallen, wenn auch als die ersten und machtvollsten Herzöge. Doch der Preis ist hoch. In Deutschland verzichtet der Staufer auf viele Kronrechte, auf Gerichtshoheit und Münzrechte zugunsten der Fürsten, die zum ersten Mal »Landesherren« genannt werden, und zum ersten Mal wird auch ein Gesetz, der Mainzer Landfriede, in deutscher Sprache verkündet. Fortan ruht »der kaiserliche Thron, dem wir verbunden sind, gleich wie die Glieder dem Haupt, wie dieses auf unseren Schultern und wird gefestigt durch unseren Bau, so dass in erhabener Majestät das Kaisertum aufglänzt und unser Fürstentum jenen Glanz widerspiegelt«.
Der Kaiser war insgesamt nur dreimal in Deutschland. Die Regierung überlässt er dort den mit wenig Geschick agierenden Söhnen, zuerst Heinrich und nach dessen Rebellion Konrad. Das staufische Problem bleibt Italien, wo Friedrich in seinem apulisch-sizilianischen Königreich den ersten modernen Beamtenstaat jenseits der mittelalterlichen Lehnswelt schafft. Mit den Konstitutionen von Melfi weist diese Schöpfung auf die Renaissance und das Modell eines voraussetzungslosen, methodisch aufgebauten Gewaltstaates voraus. Sizilien bleibt die staufische Hausmacht, die der Kaiser dem Papst wie dem Adel entzieht. Doch diese Konstellation birgt Gefahren, in denen die Staufer schließlich umkommen: Das päpstliche Territorium ist von kaiserlichem Land eingeschlossen, und in Norditalien blockieren die aufrührerischen, lombardischen Städte immer aufs Neue die Verbindungswege des Reiches, machtlogisch unterstützt von machtbewussten Päpsten. Es ist ein nur durch kurze Waffenstillstände unterbrochener Kampf zwischen Kaiser, Papsttum und den von diesem unterstützten Städten, der die Kräfte des Papsttums wie des Kaisers übersteigt.
Wenn Europa am Ende in Territorialherrschaften zersplittert und die Renaissance die geistige Macht der Kirche bricht, dann ist das die Folge dieses gnadenlosen ununterbrochenen Kampfes. Bei Cortenuova siegt Friedrich über die Lombarden 1237 in der bedeutendsten mittelalterlichen Schlacht, zehn Jahre später erleidet er vor Parma die schwerste Niederlage seines Lebens und büßt den Nimbus der Unbesiegbarkeit ein. Und je länger der Kampf dauert, desto regelloser, böser wird die Auseinandersetzung. Erst in dieser Phase des Kampfes, in der der Papst Innozenz IV. die Ermordung des Kaisers plant und selbst seine engsten Vertrauten zu Verrätern werden, greift der Kaiser zum Mittel des Terrors und rechtfertigt so die Vorwürfe von Zeitgenossen und Nachgeborenen, die im Kaiser den Antichristen und in seiner literarischen Verherrlichung durch den Juden Ernst Kantorowicz einen Kniefall vor dem ästhetischen Faschismus sehen wollen.
Doch es ist etwas anderes, ob ich die Welt mit Feuer und Schwert überziehe, um sie meiner Macht, meinem Willen und meinen Vernichtungsphantasien zu unterwerfen oder ob ich in höchster Not zur Verteidigung meiner legitimen, nach der mittelalterlichen Vorstellungswelt von Gott herrührenden Rechte auch zu grausamen Mitteln greife. Der Kaiser war zwar, wie Jacob Burckhardt beobachtet hat, der erste moderne Mensch auf dem Thron, aber eben auch überzeugt von seiner Göttlichkeit als Kaiser. Und während er in Sizilien seine Untertanen zu Hörigen herabdrückte, sah er sich selbst christusgleich und seinen zufälligen Geburtsort Jesi in den Marken als ein neues Bethlehem: »Denn aus ihr ist der Herzog hervorgegangen, des Römischen Reiches Fürst, der über dem Volk herrsche und es schütze und nicht gestatte, dass es fürder fremden Händen untertan sei.«
Am besten illustriert wohl eine Anekdote des Kaisers Weltsicht. »Der Kaiser Friedrich ging einmal auf die Falkenjagd, und er hatte einen ganz ausgezeichneten Falken, den er mehr als eine Stadt schätzte. Er ließ ihn auf einen Kranich los; der aber stieg hoch. Der Falke flog noch viel höher als er. Er sah unter sich einen jungen Adler. Er stieß auf ihn, dass er zu Boden stürzte, und hielt ihn so lange, bis er tot war. Der Kaiser lief hin in der Meinung, es sei ein Kranich; er fand wie es war. Da rief er zornig seinen Scharfrichter herbei und befahl ihm, dem Falken den Kopf abzuhauen, weil er seinen Herren getötet habe.«
Was in den grausamen Kämpfen mit Papsttum und Städten matt zu werden begann, der Glanz der kaiserlichen Persönlichkeit, bewährte sich noch einmal auf dem Kreuzzug, den er als Gebannter unternahm. Durch einen zehnjährigen Vertrag erhielt das Abendland Jerusalem zurück, mit Ausnahme des heiligen Bereiches von Omar-Moschee, Felsendom und Tempel Salomos. Ohne einen Schwertstreich, allein aufgrund seiner Persönlichkeit, gewann der Kaiser, was noch keiner vor ihm erreicht hatte. Dass der Papst dem Sultan eine Möglichkeit eröffnete, den Kaiser zu fangen und zu töten, belegt den abgrundtiefen Hass der Kirche auf den Erfolg des Staufers. Dass der Sultan diese Chance verschmähte und den Kaiser davon in Kenntnis setzte, zeigt eine andere Welt des Islam, an die wir uns gelegentlich erinnern sollten. Kein Wunder, dass der Kaiser nach dieser Erfahrung an die Könige und Fürsten Europas schrieb: »Lange genug war ich Amboss, jetzt will ich Hammer sein.«
Das Schicksal ist grausam zu den aus lichten Höhen herabstürzenden Staufern. Der Kaiser muss noch erleben, wie sein Lieblingssohn Enzio gefangen genommen wird. 23 Jahre wird er hinter Kerkermauern verbringen und dort den grauenhaften Untergang des staufischen Hauses durchleben: Der Kaiser stirbt 1250, König Manfred verliert die Krone Siziliens und 1266 in der Schlacht bei Benevent das Leben; zwei Jahre später wird der letzte Staufer, Konradin, auf dem Marktplatz von Neapel enthauptet. Nichts bleibt als der Spruch, mit dem das Volk von Palermo einst dem Dreijährigen bei der ersten Krönung zugejubelt hatte: »Christ ist Sieger, Christ ist König, Christ ist Kaiser« und der geometrische Traum von Castel del Monte, seinem persönlichen Sanssouci, halb Morgenland, halb Abendland. In Deutschland beginnt die kaiserlose, die schreckliche Zeit. In Italien dämmert die Morgenröte der Renaissance herauf.
650 Jahre später erscheint in Deutschland ein Roman, in dem der jüdische Schriftsteller Leo Perutz beschreibt, wie ein alter Baron mit Hilfe eines Rauschmittels einen durch die Jahrhunderte verborgen gebliebenen Nachfahren des Kaisers auf den Thron führen will. Doch die Bauern rufen nicht »Hosianna«, sondern »Kreuziget ihn« und zünden das Gutshaus an. Wenige Tage später wird Adolf Hitler Reichskanzler und das Buch verbrannt. Wer von den Bewunderern des Kaisers auf eine echte Erneuerung eines tausendjährigen Reiches gehofft hatte wie der Dichter Stefan George, erlebt den Triumph des Verbrechens. Zehn Jahre später wird Stauffenberg den vergeblichen Versuch machen, das Ideal des Bamberger Reiters durch die Tötung des Tyrannen zu erneuern. Noch einmal, ein letztes Mal, erhellt hier der staufische Zauber die deutsche Geschichte.
Der antirömische Protest 1 – Luther gegen Karl V.
Als die Kurfürsten nach dem Interregnum 1273 einstimmig den schwächsten der Vasallen Friedrichs, den Grafen von Habsburg, zum deutschen König wählen, ist das wie ein Atemholen. Das Reichsgut ist verschleudert, Italien und Burgund sind verloren und die Mitte des Kontinents ist inzwischen wirtschaftlich und kulturell hinter dem Westen, also England, Frankreich, Kastilien und Portugal, zurückgeblieben. Das Fehlen einer Hauptstadt und archaische Verwaltungsstrukturen behindern die weitere Entwicklung. Grundlage des Wohlstandes ist noch immer das Land, auch wenn die Bauern nur wenig davon besitzen. Drei Stände machen die Gesellschaft aus, Pfaffen, Ritter und Bauern, oder wie es in einem bischöflichen Mahnschreiben heißt: »Dreigeteilt ist das Haus Gottes, das man als Einheit glaubt: Die einen beten, die anderen kämpfen und andere arbeiten. Diese drei sind vereint und leiden keine Spaltung.« Das Schwert soll den Landmann schützen, doch es beginnt, ihn zu knechten. Die alte Ordnung reicht nicht mehr hin. Handel und städtisches Bürgertum beanspruchen ihren Platz, und die Hanse, ein Städte- und Kaufmannsbündnis, füllt das Machtvakuum, das der Untergang der Staufer hinterlassen hat. Ihr Schwerpunkt liegt im Norden und Osten, eben da, wo die kaiserliche Gewalt am schwächsten ist. Ihre Macht zehrt am Reich.
Rudolf I. wendet Aufmerksamkeit und Kraft notgedrungen vom italienischen Süden ab und dem Südosten des Reiches zu. So gewinnt er in der Auseinandersetzung mit König Ottokar von Böhmen Österreich und die Steiermark, und seine Nachfolger erringen auch das böhmische Kernland. Italien entrückt dem Reich noch mehr, nachdem mit der Schweizer Eidgenossenschaft ein neuer Riegel zwischen den Reichsteilen entsteht. Noch ist die Krone nicht bei den Habsburgern quasi erblich, und so wechseln in den nächsten zweihundert Jahren die Dynastien. Den Habsburger Kaisern folgen Luxemburger Kaiser, unterbrochen von einem Nassauer und einem Bayern, der das letzte Mal den Versuch unternimmt, mit Romzug und eiserner Langobardenkrone das staufische Erbe anzutreten und die Ghibellinen, die Parteigänger des Kaisers, in den oberitalienischen Städten zu stärken.
Doch das bleibt Romantik, ohne realpolitische Substanz. Die Zukunft des Reiches liegt diesseits der Alpen, im Südosten und im Osten, wo die noch von den Staufern privilegierten Deutschordensritter das spätere Preußen gründen. Und auch im Westen gelingt den Habsburgern und Luxemburgern die Ausbreitung ihrer Territorialmacht am Oberlauf von Rhein, Neckar und Donau. Das erste Mal entsteht auch so etwas wie eine Hauptstadt in Prag, wo Karl IV. 1348 die erste deutsche Universität gründet.
Aber schon wetterleuchtet am Horizont eine neue Spaltung der abendländischen Christenheit. In den Hussitenkriegen, die nach der Verbrennung des Ketzers Jan Huß ausbrechen, beginnen die späteren Schrecken des Dreißigjährigen Krieges schon Gestalt anzunehmen. Es ist in erster Linie ein Religionskrieg, aber auch eine nationale Auseinandersetzung zwischen Tschechen und Deutschen. Der letzte in Rom vom Papst gekrönte Kaiser, Friedrich III., legt durch seine Heiratspolitik schließlich die Grundlagen der neuen spanischdeutschen Weltmonarchie. In seiner langen, von 1440 bis 1493 dauernden Regierungszeit handelte er nach dem später zum geflügelten Wort werdenden Motto: Andere führen Kriege, du aber, glückliches Österreich, heiratest.
Auch die Verfassung des von nun an »Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation« gewinnt in diesen Jahren feste Gestalt. Die 1356 als Reichsgrundgesetz erlassene Goldene Bulle regelt die Königswahl durch die drei geistlichen Kurfürsten (Mainz, Trier und Köln) und die vier weltlichen, den König von Böhmen, den Pfalzgrafen und die Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen. Die Wahl soll künftig immer in Frankfurt, die Krönung in Aachen erfolgen. So ist das Reich ohne die Hausmacht seiner regierenden Kaiser zwar kaum noch Machtfaktor, aber immer noch Friedensordnung. Noch ist nicht entschieden, ob am Ende eine neue Staatlichkeit oder der Zerfall stehen werden. Diese Frage entschied erst die Reformation zugunsten des Zerfalls. Doch zuvor versuchte ausgerechnet ein mittelalterlicher Kaiser, der letzte Ritter, der Habsburger Maximilian, das Reich zu reformieren und ihm neue innere Festigkeit zu geben. Noch war es nicht zu einem rein metaphysischen Körper verkümmert, und die Einführung eines zentralen Reichsregiments als Exekutive der Reichsstände hätte sein Schicksal wenden können. Ein ewiger Landfriede, die Errichtung des Reichskammergerichts und die Einteilung in zehn Reichskreise zum Zwecke der Reichsverteidigung waren ein Anfang, um die monarchia universalis zu modernisieren, doch auch hier war die Kirchenspaltung mehr Abbruch als Aufbruch.
Das Heilige Römische Reich umfasste an der Schwelle zur Neuzeit, also etwa um 1400, die Mitte des europäischen Kontinents. Seine eher vage Grenze erstreckte sich laut Hagen Schulze »Von Holstein die Ostseeküste entlang bis etwa zum hinterpommerschen Stolp – hier begann das Herrschaftsgebiet des souveränen und reichsunabhängigen Deutschen Ordens – zog sich dann fast genau auf derselben Linie, die nach dem Ersten Weltkrieg Deutschland und Polen trennen sollte, gen Süden, umfasste Böhmen und Mähren sowie das Herzogtum Österreich und erreichte bei Istrien das Adriatische Meer. Die Reichsgrenze sparte Venedig und sein Hinterland aus, zog sich, die Toskana umfassend, nordwestlich des Kirchenstaates quer durch Norditalien und erreichte nördlich von Civitavecchia das Tyrrhenische Meer, dem sie bei Nizza wieder nordwärts entstieg. Sie dehnte sich westlich Savoyens, der Freigrafschaft Burgund, Lothringens, Luxemburgs und der Grafschaft Hennegau und erreichte an der westlichen Schelde, zwischen Gent und Antwerpen, die Nordsee. Manche Gebiete, etwa Norditalien, Savoyen, die Freigrafschaft Burgund und die aufrührerische Schweizer Eidgenossenschaft gehörten nur noch nominell dem Reich an, andere gehörten entschieden nicht zu jenen Kerngebieten, die damals als ›teutsche Lande‹ bezeichnet wurden: In Brabant und Teilen der Herzogtümer Lothringen und Luxemburg sprach man Französisch und in den Ländern der Wenzelskrone, also in Böhmen, Mähren und Schlesien, war deutsch im wesentlichen die Sprache der Städte – das Landvolk, aber auch Teile der Stadtbevölkerung sprachen tschechisch, in Schlesien auch polnisch.«
Und in dieses explosive Völkergemisch, das weit davon entfernt war, Nationalstaat zu sein, das keine Staatsnation hatte und kein Staat war, fiel jetzt der Funke der Glaubensspaltung. Ihr Beginn sieht die Konfrontation zweier Männer, die verschiedener nicht sein konnten: des Habsburgers Karl V., seit 1519 mit dem Geld der Fugger erwählter römischdeutscher Kaiser, und des Augustiner-Mönches Martin Luther. Wenn Friedrich von Hohenstaufen der erste moderne Mensch auf dem Thron war, so Karl V. der letzte mittelalterliche Kaiser. Doch anders als bei Friedrich II., dessen wenige steinerne Porträts meist apokryph sind, besitzen wir von Karl die Bilder Tizians, die uns einen meist in schwarz gekleideten, entrückten, einsam in der Eiseskälte seiner hohen Berufung verharrenden Menschen zeigen, unbeweglich wie ein Idol, wie sein Großvater Maximilian erschreckt ausgerufen haben soll. Der Kulturhistoriker Egon Friedell, der die Habsburger nicht mochte, hat in den Bildern Tizians den Fluch dieses Geschlechts entdecken wollen, kein Herz besitzen zu dürfen. Doch es war wohl eher der Schmerz über die verlorene Einheit der Christenheit und die am Ende in seiner Abdankung gipfelnde Einsicht, dass alles umsonst war, »verlorene Siege«, wie die Erinnerungen eines deutschen Heerführers aus dem Zweiten Weltkrieg überschrieben sind.
Karl war von seiner Persönlichkeit wie von seiner Stellung her der klassische Konservative, ein verantwortungsethischer Traditionalist, unfähig zu begreifen, was in Luther vorging und was er wollte. Er hat bis zuletzt gezögert, die Reformation und den Protestantismus gewaltsam zu unterdrücken, und er hat das zugesagte freie Geleit für Luther zum und vom Reichstag in Worms gehalten, denn er wollte – wie er sagte – nicht auch schamrot werden wie sein Vorgänger Sigismund, der Jan Huß unter Bruch dieses Versprechens festnehmen und verbrennen ließ. Als bei Pavia 1524 die französische Armee vernichtet und der französische König Franz I. gefangen genommen wurde, verbot der Kaiser alle Jubelfeste, da der Sieg gegen Christen erfochten sei, und ordnete Prozessionen und Bittgottesdienste an. In vierzig Druckzeilen hat Karl V. den deutschen Ständen auf dem Reichstag in Worms sein Credo verkündet: Verteidigung des katholischen Glaubens, der geheiligten Zeremonien und heiligen Bräuche, wie es seine Vorgänger gehalten haben, »vivre et mourir à leur exemple«. Reformen ja, aber nur im wörtlichen Sinn als Rückführung auf die geheiligten Bräuche.
Auf der anderen Seite dieser welthistorischen Auseinandersetzung finden wir einen mittelalterlichen Mönch, keinen gebildeten Humanisten wie Erasmus, keinen geschmeidigen Diplomaten wie den päpstlichen Legaten Cajetan, sondern einen frommen Bauern, den nur eine Frage umtreibt: Wie gewinne ich einen gnädigen Gott, wie finde ich Erlösung und Seelenheil? und der es wörtlich meint mit dem biblischen »Was hülfe es mir, wenn ich die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an meiner Seele?« Das Reich, die Türkengefahr, die Franzosen, Habsburg, die Wirkung seiner Lehre auf den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft – all das ist Luther gleichgültig, denn Politik interessiert ihn nicht, und Geschichte ist ihm unwichtig. Als die Bauern unter Hinweis auf ihn und seine Lehre politische und soziale Forderungen stellen, also die urchristliche Botschaft beim Wort nehmen, antwortet er mit seiner Schrift »Wider die räuberischen und mörderischen Bauern« und fordert, »dass sie erwürgt werden, wie tolle Hunde« – ein erstaunlicher Mangel an Empathie wie an geschichtlichem Verständnis.
Im Jahre 1511 reist Luther über Oberitalien nach Rom, doch er findet kein einziges Lobeswort für die Schönheit der Kunstwerke oder die Ehrwürdigkeit der antiken Bauten. Am Kölner Dom und am Ulmer Münster interessiert ihn ausschließlich die schlechte Akustik und am Rom der Päpste das darin verbaute Geld aus Deutschland. In der Persönlichkeit Luthers manifestiert sich schon, was später den Protestantismus ausmacht – das Wort und die Musik. Es fehlen der Sinn für Schönheit und Anmut, was Nietzsche zu dem Verdikt veranlasste: »Die Deutschen haben Europa um die letzte große Kulturernte gebracht, die es für Europa heimzubringen gab – die Renaissance«, und Gottfried Benn ähnlich hart urteilen ließ: »Die Reformation, das heißt das Niederziehen des 15. Jahrhunderts, dieses riesigen Ansatzes von Genialität in Malerei und Plastik zugunsten düsterer Tölpelvisionen – ein niedersächsisches Kränzchen von Luther bis Löns! Protestant, – aber Protest immer nur gegen die hohen Dinge.«
Das lutherische Aufbegehren ist reinste Gesinnungsethik, die Folgen für die Welt und das Reich interessieren ihn nicht: »Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde – denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, da es am Tag ist, dass sie des öfteren geirrt und sich selbst widersprochen haben –, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wider das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir, Amen!«
Luther, so sieht es Egon Friedell, »war in seiner seelischen Grundstruktur noch eine durchaus mittelalterliche Erscheinung. Seine ganze Gestalt hat etwas imposant einheitliches, hieratisches, steinernes, gebundenes, sie erinnert in ihrer scharfen und starren Profilierung an eine gotische Bildsäule. Sein Wollen war von einer genialen dogmatischen Einseitigkeit, schematisch und gradlinig, sein Denken triebhaft, affektbetont, im Gefühl verankert: Er dachte gewissermaßen in fixen Ideen. Er blieb verschont von dem Fluch und der Begnadung des modernen Menschen, die Dinge von allen Seiten, sozusagen mit Facettenaugen betrachten zu müssen«.
Er ähnelte dem Kaiser mehr, als er wusste: Auch er wollte zurück zur mittelalterlichen Frömmigkeit und der Entartung und Verweltlichung ein Ende bereiten, auch er bezweifelte den seichten Optimismus der Humanisten und sah in den irdischen Dingen den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse, nur war sein Wirken revolutionär, wo das des Kaisers konservativ war. Und noch etwas trennte ihn vom Kaiser: »Die menschlichen Dinge bedeuten ihm mehr als die göttlichen« hat er über Erasmus gesagt, was als Tadel gemeint war; über den Kaiser gesprochen, ist es ein Lob. Denn Luthers Unbedingtheit, sein »Hier stehe ich, ich kann nicht anders« vererbte sich weiter in der deutschen Geschichte und hatte Folgen, die ein kluger Beobachter der deutschen Dinge in den Satz kleidete: »Das deutsche Volk nimmt die ideellen Dinge nicht als Fahne wie andere Völker, sondern um einige Grade wörtlicher als sie und die realen um ebensoviel zu leichtsinnig«; oder wie Goethe es in Dichtung und Wahrheit formulierte: »Uns war es darum zu tun, den Menschen kennen zu lernen; die Menschen überhaupt ließen wir gerne gewähren«.
Dazu passt, dass Luther mit der Bibelübersetzung im Idealen aufgebaut, was er mit der Reichszerstörung im Realen eingerissen hat. Denn nach dem Ende der Religionskriege gab es zwar kein funktionsfähiges politisches Deutschland mehr, aber eine Sprachnation als Grundstein für ein neues deutsches Haus, sozusagen ein »inneres Reich« aus idealistischer Philosophie und der späteren Weimarer Klassik. Luther hat aus der sächsischen Kanzleisprache und dem Idiom seiner Nachbarn eine neue kraftvolle und ausdrucksstarke Hochsprache geformt, die noch gesprochen werden wird, wenn die evangelischen Landeskirchen längst Geschichte sein werden.