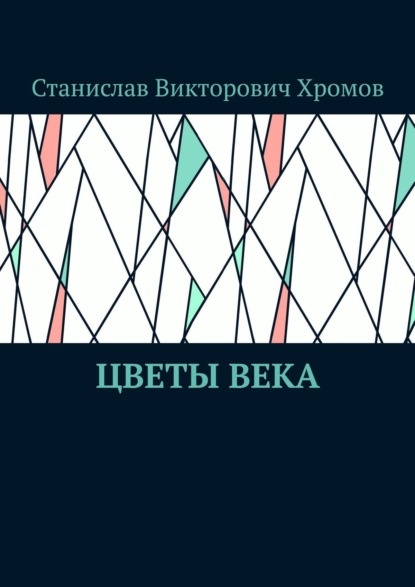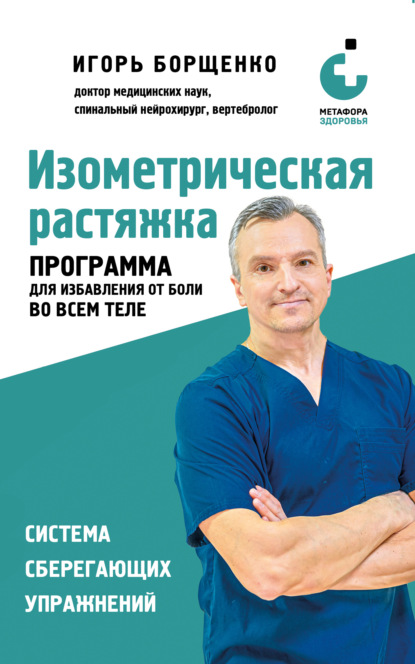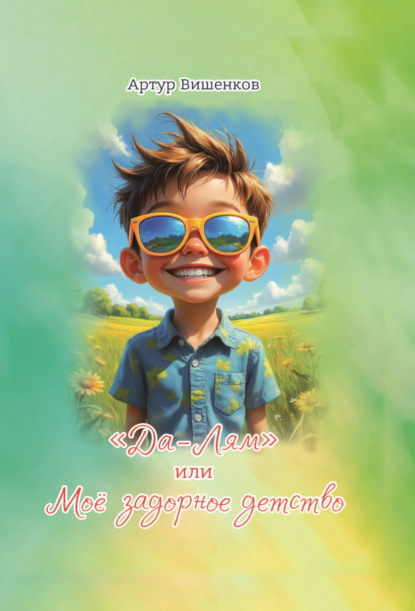Paganini - Der Teufelsgeiger
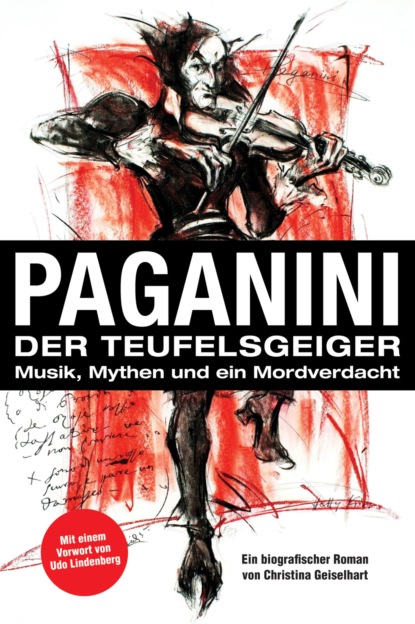
- -
- 100%
- +
„Du überforderst das Kind, Antonio. Es wird wieder krank werden und womöglich sterben.“
„Sei still, dummes Weib! Krank wird er in der verseuchten Gasse, wenn er sich mit liderlichen Spitzbuben herumtreibt.“
„Niccolò mag keine Spitzbuben.“
„Und eines sage ich dir: Wird er nicht Musikant, so wird er Bettler. Dann ist es schon besser, er stirbt in jungen Jahren!“
Teresa wand sich entsetzt von ihm ab. Solange es sich um seine Einsätze handelte, kannte Antonio keine Gnade. Und auf Niccolò setzte er nicht nur Geld, sondern auch seine Zeit, seine Energie und sein Können.

In den kommenden Monaten lernte Niccolo eifrig und wagte er es, Müdigkeit zu zeigen, strich ihm der Vater das Mittagessen. Der Alte kannte kein Mitleid, denn er unterstellte dem Knaben eine zähe Natur. Zweimal hatte er den Tod von der Bettkante gewiesen. Der schmächtige Kleine trotzte den porösen Wänden, aus denen feuchte Blasen drangen und Schimmel bildeten, er trotzte den sonnenarmen, stickigen Räumen und dem Gestank des osmanischen Klos im Treppenhaus, der das gesamte Haus verpestete. Tapfer absolvierte er ein klägliches Pensum an Schulstunden, um Schreiben, Lesen und Rechnen zu können, lernte dabei etwas über die Geschichte seines Landes und erfuhr von seinem Lehrer, einem Freund des Dottore, dass nicht nur in Genua italienisch gesprochen wurde, sondern auch in den Kirchenstaaten, in den Herzogtümern Toskana und Parma, im Königreich Sizilien, auch in der Republik Venedig. Dieser Lehrer verriet Niccolò auch, warum die Straßen in allen Teilen des großen Landes schlecht waren, überall Räuberbanden lauerten und es schlimmste Armut, Dreck und Gleichgültigkeit gab. „Weil die Österreicher und andere Eroberer überall ihre Finger drin haben“, erklärte der Erzieher. Den Jungen kümmerte dies nicht. Er freute sich auf das Ende des Unterrichts und das Spiel auf seiner Geige. Er übte mit feurigem Ernst, dennoch ließ er ab und zu die Geige ermattet sinken. Sieben bis acht Stunden täglich erschöpften ihn. Manchmal war er so schwach und taumelig, dass er schwankte. Sein Vater kannte kein Mitleid. Er zog ihm die Ohren lang, bis der Kleine aufschrie und wieder kerzengerade stand.
„Wie oft hast du die Etude vom Blatt gespielt?“
„Fünf Mal, Padre!“
„Was höre ich?“ Er schlug dem Jungen ins Gesicht. „Das ist zu wenig.“ Er schlug ein zweites Mal, weil Niccolò die Ohrfeige reglos hinnahm. „Gib zu, dass es zu wenig ist. Hörst du nicht? Bist du taub?“
Zögernd schüttelte Niccolò den Kopf. Die Geige hing plötzlich an seinem Arm, als sei sie zentnerschwer. Der Bogen glitt ihm fast aus der Hand. Der Vater schlug ein drittes Mal zu.
„Natürlich bist du taub. Ich hab dir unzählige Male befohlen, sie so lange zu spielen, bis du sie aus dem Effeff beherrschst.“
„Das habe ich getan, Padre.“ Der Junge duckte sich, denn drohend schwebte die Hand des Vaters über ihm.
„Und die Tonleiter? Hast du sie gespielt?“
„Auf jeder Saite habe ich sie gespielt, Padre!“ Wohlweislich bedeckte Niccolò seine Wange.
„Wie oft auf jeder Saite?“
„Zehnmal, Padre!“
„Die Etude von Tartini hast du fünfmal gespielt und die Tonleiter zehnmal auf einer Saite, ja?“
„Genau, Padre!“ Niccolò reckte sich vorsichtig. Er war mit sich zufrieden. Nicht so der Vater. Seine Augen traten aus ihren Höhlen.
„Du wagst es, mir Unfug zu erzählen?“
„Ich habe gespielt, bis ich sie beherrschte, Padre! Genau wie Sie mir befohlen haben.“
„Du lügst!“, schrie der Alte und schlug Niccolò auf den Kopf.
„Du behauptest also, du könntest diese schwierige Übung nach so kurzer Zeit fehlerlos spielen? Behauptest du das?“
Niccolò nickte sehr zaghaft, nicht ohne dabei seinen Kopf mit der Hand, die den Bogen hielt, zu schützen.
„Zeig es!“
Zitternd schob Niccolò die Geige unters Kinn und setzte ganz langsam den Bogen an.
„Beeile dich, du Nichtsnutz!“ Antonio zerrte an ihm herum. „Los, los, mach endlich. Zeig es mir, du Lügner!“
Und Niccolò spielte die Etüde von Tartini so langsam, als wolle er jeden Ton auskosten. Er spielte sie fehlerlos, hätte sie gerne ausgeschmückt, traute sich aber nicht. Der strenge Ausdruck im Gesicht des Vaters milderte sich nur wenig. Ein höhnisches Grinsen flackerte in seinen Augen.
„Das ist nicht schlecht. Aber ich wünsche sie schneller, du kleiner Schwindler. Und das wirst du nicht können, weil du zu wenig geübt hast. Wer mit so dünnen Fingern nur fünfmal diese Etude spielt, kann sie noch lange nicht, selbst wenn er begabt ist. Du bist ein Besserwisser und Aufschneider.“
Niccolò spielte sie etwas schneller. Die Miene des Vaters verzog sich kaum. Er spielte sie noch schneller. Die Augen des Vaters traten nicht mehr hervor, aber weiteten sich, und im Moment, als Niccolò sie so emsig intonierte, dass Antonios träge Augen den flinken Fingern kaum folgen konnten und der Junge ans Ende der Etude einen blitzschnellen Lauf der chromatischen Tonleiter setzte, sperrte der Vater auch den Mund auf.
„Wie alt bist du, verdammt noch mal?“
„Verzeihen Sie, Padre, aber ich weiß es nicht mehr. Ich kann es mir nicht merken, weil wir die Geburtstage nicht feiern.“
„Wozu soll ich den Geburtstag eines Taugenichts feiern?“
Niccolò sah ängstlich zu seinem Vater hoch. Die zusammengepressten Lippen und der drohende Blick verliehen diesem etwas Furchterregendes. Wie um ihn gnädig zu stimmen, spielte Niccolò nun mehrere Tonleitern, einmal von der G-Saite, einmal von der E-Saite ausgehend, aber verzierte sie mit Trillern. Die Töne waren lupenrein und klangen harmonisch. Signore Paganini ließ Milde walten, denn in seinem Kopf arbeitete es. Der Genueser rechnete. Er kalkulierte, überschlug, addierte und zog ab. Als die Kasse in seinem Kopf klingelte entspannte sich sein Gesicht und er sagte:
„Was sich bezahlt macht, sollte gefeiert werden. Wann ist dein nächster Geburtstag?“
„Im Herbst, Padre!“
„Im Herbst, im Herbst“, schrie Antonio, „was für eine Antwort! Jetzt haben wir November und es ist immer noch Herbst. Wann im Herbst?“
„Es ist noch nicht sehr kalt, aber auch nicht mehr so warm und die Blätter fallen von den Bäumen. Der Himmel ist grau und in der Wohnung muss man heizen.“
„Dummes Geschwätz!“, brummte der Vater. Dann hob er die Stimme und brüllte: „Signora Paganini? Weib, komme es auf der Stelle!“
Teresa erschien in einem grauen Tageskleid. Wie üblich hing Paola an ihrem Rockzipfel. „Was wünscht Signore Paganini von seinem Weib?“
„Wann kam dieser Lümmel zur Welt?“
„Im Herbst vor …“, sie zählte an ihren Fingern ab, murmelte die Zahlen und fuhr fort,“ … vor acht Jahren.“
„Das heißt, der Junge ist heute acht Jahre alt?“
Teresa nickte und schickte sich an, hinauszugehen.
„An welchem Tag im Herbst ist der Kerl geboren?“
Nun schaute Teresa betreten. Antonio sah, wie es in ihrem Kopf arbeitete.
„Ich vergesse die Zahl immer wieder, weil wir seinen Geburtstag nicht feiern.“
„Geht mir zum Teufel mit eurem Geburtstagsfeiern. Bin ich ein Goldesel? Ich will verdammt noch mal endlich den Tag seines Geburtstags wissen oder muss ich dazu das Stammbuch suchen? Hier in diesem unordentlichen, schmutzigen Haus?“
Während er schrie, stand Niccolò geduckt daneben, Geige und Bogen hingen an seinem Körper herunter, links die Geige, rechts der Bogen. Teresa runzelte die Stirn und dachte angestrengt nach.
„Es war Ende des Herbstes. Der Himmel war grau, es regnete ein wenig und der Wind …“
„Neiiiiiiin, das hab ich schon mal gehört. Per favore! Man suche mir das Stammbuch.“
„27. Oktober!“, schoss es da plötzlich aus Teresas Mund.
„27. Oktober!“, wiederholte Antonio erleichtert. „Na endlich. Der Junge wurde also vor einem Monat acht Jahre alt. Das ist ausgezeichnet. Wer mit acht Jahren so flink spielt, der wird mit 10 Jahren ein ausgezeichneter Kirchenmusikant sein und Geld verdienen. Noch feiern wir deinen Geburtstag nicht, denn du hast ja bis jetzt nichts verdient, aber nächstes Jahr wird gefeiert. Versprochen.“
Niccolò durfte hinausgehen. Teresa folgte ihm, die scheue Paola am Rockzipfel.
5
Sechs Monate später musste sich Antonio eingestehen, dass er dem Jungen nichts mehr beibringen konnte, und suchte Maestro Giacomo Costa auf. Der dreißigjährige Genueser spielte die erste Geige bei Kirchenmusikstücken und schien Antonio genau der Richtige. Niccolò sollte ein angesehener Kirchenmusiker werden. Unter Costas Anleitung wuchsen Niccolò Flügel. Seine Finger füllten sich mit Leben –
was ihnen beim Unterricht seines Vaters nicht ganz gelungen war – ,
sie strafften sich, bogen sich. In seinen Fingerkuppen pochte wild das Blut, so dass sie wie Hämmerchen auf die Saiten niederstürzten. Sein linker Arm wuchs und wuchs und endete an der Spitze seines Geigenbogens. Im April 1791, knapp neunjährig, spielte er beim Gottesdienst das Konzert für Violine und Orchester Op. 17 von Pleyel. Von da an übernahm er Costas Rolle als erster Geiger bei Kirchenstücken. Antonio konnte seine Freude über den Erfolg nicht vollständig auskosten, denn noch kam kein Geld herein, außerdem beschwerte sich Giacomo Costa. Der Junge sei wohl begabt und unschlagbar in seinem musikalischen Ideenreichtum, sein Kopf allerdings, der sei nicht nur groß, er sei auch stur. Niccolòs Bogenführung sei haarsträubend und widersetze sich jeglicher seriöser Methode des Geigenspiels. Antonio versprach Costa, den Jungen mit ein paar Backpfeifen zur Vernunft zu bringen. Vermutlich sei ihm der Erfolg in seinen großen Kopf gestiegen.
Als er am späten Nachmittag zu Hause eintraf und Niccolò folgsam beim Geigenüben vorfand, milderte sich die unterwegs angestaute Wut keinesfalls, nein, sie steigerte sich noch, da er nicht begriff, was an Niccolòs Bogenhaltung falsch sein sollte. Seine Geige zeigte in spitzem Winkel nach unten, als sei ihr Steg ein Opfer der Erdanziehung, und sein rechter Arm, der den überlangen Bogen führte, streifte dabei fast seinen Körper. Was konnte an einer Haltung falsch sein, die so kraftvolle, reine Töne produzierte?
„Leg dein Instrument weg!“, herrschte er den Jungen an. Verständnislos starrte der Kleine auf den Vater. Was ist geschehen, dass der Vater das Gegenteil von dem wünschte, was er üblicherweise mit strengster Härte verlangt, schien er sich zu fragen. Kaum lagen Geige und Bogen sicher auf der wurmstichigen Kommode, machte Antonio zwei dröhnende Schritte und schlug Niccolò schallend auf die rechte Wange. Sein Kopf flog nach links, da schlug Antonio noch mal so kräftig auf die linke Wange. Der Kopf flog nach rechts.
„Ich hab alles richtig gemacht!“, stotterte der Kleine zwischen den Ohrfeigen.
„Du wagst es, mich anzulügen?“ brüllte der Vater. Sein Zorn war nun aufs höchste angestachelt. Heftig atmend packte er den Jungen, riss ihm die Hosen herunter und drosch auf den armen, dürren Hintern ein, bis dieser so krebsrot war wie Niccolòs Gesicht in Zeiten des Scharlachfiebers und bis Teresa rasend vor Empörung ins Zimmer stürzte.
„Francesco Antonio Paganini, warum verprügelst du unseren armen Sohn so schrecklich? Was hat er getan, dass du ihn klopfst und drischst wie Waschweiber ihre schmutzige Wäsche am Waschtag?“
„Er führt den Bogen falsch und wirft sich damit Steine in den Weg einer erfolgreichen Zukunft.“
„Ich halte ihn richtig“, krächzte der Sohn, worauf Antonio zu neuen Schlägen ansetzte. Teresa warf ihren kleinen, doch korpulenten Körper zwischen die beiden und zeterte dabei ohrenbetäubend. Wie ein Schutzwall baute sie sich vor ihrem Kind auf. Sie schleuderte Antonio Schimpfwörter, untermischt mit Fragen und Klagen, ins Gesicht. Antonio erreichte Niccolòs Hintern nicht mehr und hätte auf seine Frau dreschen müssen, was ihm seine Erziehung untersagte. In seiner Familie wurden Frauen nicht geschlagen. Inzwischen hatte sich Niccolò in eine enge Nische im Treppenhaus geflüchtet, wo ihn Antonio nicht fassen konnte.
„Was ist an Niccolòs Bogenführung falsch?“, schrie Teresa.
„Weiß ich nicht!“, schrie Antonio zurück, während er den Kleinen mit den Augen suchte.
„So ein Unsinn! Wer sagt, sie sei falsch?“
„Costa sagt es und Costa weiß es. Und ich will, dass der Junge spielt, wie es Costa verlangt.“
„Warum soll der Junge anders spielen als er spielt, wo er doch besser spielt als alle Schüler Costas, die so spielen, wie es Costa verlangt? Seid ihr denn alle dümmer als ich? Ihr, die ihr lesen, schreiben und rechnen könnt!“
„Halt den Mund, Weib! Du verstehst nichts.“
„Mein Herz versteht mehr als dein gelehrter Kopf. Wenn du den Jungen noch einmal schlägst, zerschlage ich die Geige an deinem gelehrten Kopf. Dann kann er die Geige weder falsch noch richtig halten.“
Der Ärger über sein Weib, gepaart mit dem Ärger über Niccolò, trieb ihn aus dem Haus. Er ging zum Landungsquai. Eine elende Gegend. Egal. Sie entsprach seinem momentanen inneren Zustand. Missgestaltete Häuser standen dicht gedrängt, verwahrlost und armselig. An den offenen Fenstern hingen schlammfarbene Kleidungsstücke zum Trocknen und aus den Wohnungen strömte modriger Geruch, der sich in den gewaschenen Kleidern festsetzte. Antonio strebte die Makkaroni- und Polentastände an, wo er Giorgio Servetto zu treffen hoffte. Seit in Frankreich der radikale linke Flügel der demokratischen Partei herrschte und vielen Adeligen, ob gut oder böse, die Guillotine drohte, nagten leise Zweifel an Giorgios Gesinnung. Er fürchtete, Fillipo Buonarotti beabsichtige, Italien auf ebenso blutrünstige Weise zu revolutionieren. Und so grübelte der einstige Musikstudent darüber, ob er nicht das schwierige Geschäft der Revolution anderen überlassen und in aller Ruhe sein früheres Leben wieder aufnehmen sollte. Heute als Hafenarbeiter, morgen als Geigenlehrer oder auch als Polenta- oder Fischverkäufer.
Der junge Servetto saß auf dem Boden hinter einem Polentastand und starrte gedankenverloren an den flatternden, Staub und Dreck verteilenden Tauben vorbei, die ihre Schnäbel gierig in die Fleischabfälle stießen, als er plötzlich Antonio erkannte. Er grüßte ihn und winkte ihn heran.
Eine Weile saßen sie schweigend nebeneinander und betrachteten das rege Treiben. Die Händler feilschten mit krächzenden Stimmen oder zeterten unzufrieden einem davoneilenden Kunden nach. Giorgio war wie es den Anschein hatte, nicht zum Arbeiten hier. Er grübelte und träumte, nebenbei teilte er Antonio seine Bedenken mit.
„Irgendwie möchte ich weiterhin unserer Sache dienen, denn auch ich wünsche die Fremdherrschaft zum Teufel. Allerdings muss das Ganze besser organisiert werden und darf nicht in ein Blutbad ausarten. Bis jetzt sind wir ein Haufen unzufriedener Intellektueller, Bürger, verbitterter Adeliger, Landarbeiter und hie und da stößt sogar ein Priester dazu. Das genügt nicht. Uns fehlt eine gemeinsame solide Basis und Hilfe in den maßgebenden Parteien. Wir haben noch nicht einmal einen Namen.“
Antonio antwortete nicht. Seine Augen schweiften über die farbige Vielfalt von Gesichtern und vertieften sich in den Anblick eines jungen Mädchens.
„Wie wäre es, wenn du dich nach einer jungen Frau umsähest, Giorgio? Du bist dreiundzwanzig und solltest an eine Familie denken!“, sagte er unvermittelt.
„Mit meinen unsicheren Einkünften?“
„Arbeite wieder als Geigenlehrer. Das bringt was ein. Du spielst doch ordentlich Geige, oder?“
„Ich habe sie zehn Jahre lang gelernt und kenne mich aus.“
Sein Satz lieferte Antonio das Stichwort und dieser konnte seine Frage stellen, wobei er mit funkelnden Augen auf den Sohn schimpfte. Kaum hatte er Luft abgelassen, richtete sich Giorgio auf und zwinkerte Antonio von oben herab zu. Warum er nie daran gedacht habe, ihn als Lehrer einzustellen, wollte er wissen.
„Weil du Geld brauchst, und ich dich teuer bezahlen müsste. Costa macht es fast umsonst, da er Niccolò für eine Sonderbegabung hält, die unbedingt gefördert werden muss. Aber genug davon! Beantworte mir meine Frage.“
„Bene!“ Giorgio zwinkerte. „An der Bogenführung ist nichts falsch, Antonio!“ Er fischte Tabak aus der Hosentasche, zerrieb ihn auf dem Handrücken und zog ihn durch die Nase. Bevor er weiter sprach, atmete er tief durch. „Lass den Jungen einfach in Ruhe. Wie es aussieht, schwört sein Lehrer Costa auf die französische Methode, weil der Geiger dabei ein elegantes Bild abgibt und sie vom berühmten Sevcik zum Nonplusultra erhoben wurde. Angeblich spielt man dabei auch besser.“
„Ich hab mich um all das nie gekümmert. Wie sieht das Ganze denn aus, verdammt? Kannst du mir das erklären?“
„Das Gewicht des Körpers ruht auf dem linken Bein, der rechte Fuß wird leicht nach vorn versetzt. Die Geige hält man zwischen Kinn und Schulter liegend, ohne Stütze der linken Hand, der Ellbogen nach innen, damit die Finger mit Kraft niedersausen …“
„Das ist mir bekannt. Nur, Niccolò hebt immer eine Schulter etwas höher, so dass er schief aussieht, der Gimpel! Doch was ist mit dem Bogen?“
„Der Daumen liegt leicht gebogen am Anfang des Frosches, das Ende des Zeigefingers gebogen auf dem Holz, sozusagen zum Ausbalancieren. Während des Spiels ruht die Violine im rechten Winkel zum Körper, das heißt, man hebt den rechten Arm so weit an, bis sich der Bogen mit den Saiten auf gleicher Höhe befindet. Capito?“
Antonio wackelte mit dem Kopf, zuckte mit den Schultern, murmelte, er habe bei Niccolò nie auf diese Details geachtet und nie wäre ihm seine Haltung oder Bogenführung absonderlich vorgekommen. Im Gegenteil, auf alten Gemälden und Lithographien hielten die Geiger ihr Instrument immer mit einer leichten Neigung nach unten.
„So lehrt die italienische Schule des 18. Jahrhunderts, doch das ist veraltet. Inzwischen gilt die verfluchte französische Schule, auf die Niccolò offensichtlich pfeift. Diese Franzosen wollen sich überall breitmachen, auch in der Musik, und Niccolò sträubt sich mit Recht dagegen. Sie entspricht ihm nicht. Er hat seine eigene Methode gefunden dank der er genial spielt. Was willst du mehr, Antonio? Fördere ihn, statt an ihm rumzumäkeln.“
Ein wenig bereute er nun, den Jungen wegen jeder Kleinigkeit so schrecklich verprügelt zu haben. Seine Frau hatte recht gehabt, den schmalbrüstigen Kerl zu schützen. Sie hatte oft recht, obwohl sie ein einfältiges und dummes Weib war und seit der Geburt von Paola ziemlich hässlich geworden. Durch ihre Haare zogen Silberfäden, ihre Haut war bräunlich-gelb gescheckt, aber am schlimmsten sah sie aus, wenn sie zeterte. Jedes Kind hatte einen Zahn gekostet, und da Teresa mittlerweile sieben geboren hatte, fehlten ihr sieben Zähne, zwei davon in der vorderen oberen Reihe. Maria benedetta, hatte Teresa ein gutes Herz. Vielleicht liebte sie sogar ihren Mann. Jedenfalls liebte sie alle ihre Kinder, auch die gestorbenen. Die lebenden hütete sie wie eine Henne, bekochte sie gut, sang ihnen Lieder vor und salbte sie mit Olivenöl ein. Nur schade, dass sie von Hausarbeit nichts hielt. Dreck und Unrat verklebten die Winkel, Staub bedeckte die Möbel, Schimmel die Wände, schmierige Schlieren verunreinigten die Böden, Flecken die Fenster. Diese Wohnung ähnelte einem Hühnerstall. Und in diesen Hühnerstall kam Antonio als geschlagener Gockel auf allen Vieren zurück. Er würde sich seine Niederlage nicht anmerken lassen, stattdessen wollte er Niccolò bald mit einer neuen, besseren Geige überraschen.

Vater hat mich nie mehr wegen meiner Haltung geschlagen. Auch nicht wegen irgendetwas anderem. Noch immer ist er streng, manchmal gibt es eine Backpfeife, aber er ist nicht mehr ganz so finster und böse. Als letzten Winter ein englischer Admiral unsere schöne Stadt belagerte, wurde er sogar freundlich. Er versammelte uns Kinder im Wohnzimmer und erklärte, was die Engländer in Italien suchten. Er sagte: Sie wollen mehr Land, mehr Macht und mehr Geld. Ähnlich den Österreichern, bloß dümmer. Sie wollen, dass wir alle englisch reden, ihr scheußliches Bier trinken, ihre Ideen annehmen und ihren Regen. Er sagte, wegen der Engländer könne er mir die neue Geige nicht zu Weihnachten schenken. Die Engländer hinderten ihn an seinen Geschäften, sagte er, aber sie würden ihn und mich nicht daran hindern, viele Konzerte zu geben. Schon wenige Monate später kamen die Franzosen und verscheuchten den englischen Admiral. Darüber waren wir nicht besonders froh, denn es hieß, junge Genueser Männer müssten in den Krieg gegen Frankreich ziehen. Vater ist zwar nicht jung, aber auch nicht alt, und er ist nicht so böse, dass wir ihn ins Pfefferland wünschen. Auch Mama mag ihn trotz seiner scharfen Stimme und den buschigen Brauen, die schwarz wie das Gefieder eines Raben über den funkelnden Augen wachsen. Er blieb also bei uns und so konnten wir unsere Pläne verwirklichen. Ich studiere weiterhin bei Costa, dabei hasse ich den Mann täglich mehr. Er schiebt immerzu meine Geige in eine horizontale Lage und tut mir dabei weh. Er zupft an meinem rechten Arm, als sei er eine Saite, und rammt ihn nach oben. Er schlägt auf meine Schultern, drückt sie mit seiner schweren Pranke, weil ich die Gewohnheit habe, sie hochzuziehen. Er schüttelt mich, stampft mit dem Fuß auf, wenn ich die Geige sinken lasse, rauft sich die Haare, wenn ich Auftakte mit dem Niederstrich, Niederschläge mit dem Aufstrich vortrage. Er staunt allerdings darüber, wie gekonnt ich den Bogen zwischen Daumen und Zeigefinger halte. Leicht wie eine Feder, doch kraftvoll wie ein Pfeil, sagt er und fügt an, dass mir Gott einen überlangen kleinen Finger verpasst habe, damit ich den Bogen sorglos im Gleichgewicht halten könne. Ein Quälgeist, der die Quälerei meines Vaters zeitweise übertrifft. Denn während Vater milder wird, zwingt mir Costa nun ein Pensum von zehn Stunden Übungen täglich auf. Das macht mich außerordentlich müde und manchmal wird mir schlecht, ich schwanke und falle hin. Aber immer so, dass meiner Geige nichts geschieht. Da bin ich sehr vorsichtig, denn ich liebe sie irgendwie. Ich schlafe mit ihr ein und wache mit ihr auf. Sie ist meine Gefährtin, obwohl mir ihre Stimme nicht besonders gefällt. Es ist wie mit Menschen. Manche haben einen Geruch, der abstößt, und manche haben Stimmen, die klirren. Ich hätte Vater anvertrauen können, dass der Klang meiner Geige mir Kopfschmerzen verursachte, ließ es aber sein, um seinen Zorn nicht zu reizen. Ich habe ihm aber gesagt, dass meine Vorträge in der Chiesa di San Filippo Neri im Mai und in der Chiesa Nostra Signora delle Vigne im Dezember weitaus schöner ausgefallen wären, hätte ich eine bessere Geige gehabt. Er zitierte als Antwort eine Zeitung, die von einem „wohlklingenden Konzert“ schrieb. Ich entgegnete, dass die meisten Genueser über jene Durchschnittsohren verfügten, in denen ein verstimmtes Klavier wohltemperiert klinge. Er antwortete mit einer Backpfeife. Nun gut. Jedenfalls wollte er vom Kauf einer Geige vorerst nichts wissen. Zu teuer! Nicht nötig! Ein Talent könne zaubern, sagte er. Ein talentierter Musikant hole aus einer krächzenden Geige himmlische Melodien.
Das brachte mich auf die Idee, mein Konzert im Teatro S. Agostino mit Vogelgezwitscher zu beenden. Ich wartete den Jubel und das Getrampel des Publikums verneigend und lächelnd ab und schob, sobald ein wenig Ruhe eingekehrt war, meine Geige erneut unters Kinn. Applaus ließ das Haus von neuem erbeben. Die Zuhörer hofften auf eine Zugabe im klassischen Sinn. Mich aber ritt ein Kobold. Statt einer klassischen Zugabe imitierte ich den Gesang einer Nachtigall. Ich schloss die Augen. Im Saal herrschte unwirkliche Stille und ich fühlte die Nacht um mich aufsteigen. Eine helle, strahlende Nacht, in der die Nachtigall ihren Geliebten ruft. Als ich die Augen öffnete, fürchtete ich die Reaktion des Publikums und als ich zu meiner Rechten die schwarzen Augen meines Vaters blitzen sah, fürchtete ich sogar um mein Leben. Der Erlös dieser Veranstaltung nämlich sollte mir mehr Türen öffnen, höhere Studien ermöglichen, die mein Vater nicht zahlen konnte. Er hatte sogar einen Artikel in der Gazetta di Genova veranlasst, der die Leute zum Kommen zusammentrommelte. Und da waren sie nun, viele neugierige Genueser, die mein Konzert rasend beklatschten und denen ich als Dank zum Abschluss Vogelgesang präsentierte. Würden sie es mir verübeln? Die seltsame Ruhe, die eintrat, nachdem ich meine Geige abgesetzt hatte, machte mich nervös. Ich tänzelte verlegen hin und her, da streifte mein Blick meinen Vater. Er lächelte. Nein, mehr noch. Er lachte und mit ihm lachten plötzlich alle. Und diese amüsierten Lacher schickte der Sturm wie kleine Wellen den großen Wellenbrechern voraus. Sekunden später erzitterte das Teatro unter dem Beifallsgetöse des Publikums. Ich hatte gewonnen. Vater erwog nun wenigstens den Gedanken an eine gute Geige. Und dieser Gedanke ging in ihm um. Er erkundigte sich, besuchte Musikhandlungen, ließ sich in die Geigenmacherzunft einweihen, aber zögerte.