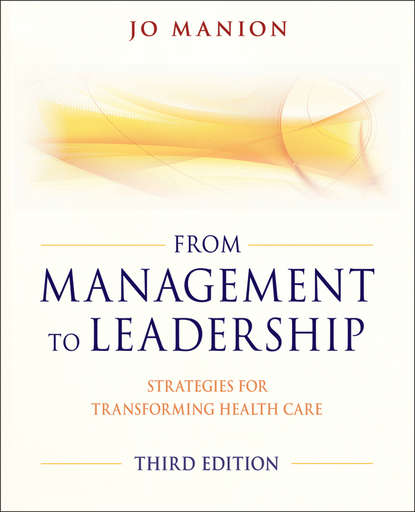Paganini - Der Teufelsgeiger

- -
- 100%
- +

In den letzten Jahren ist viel passiert. Das üble Gelbfieber griff rasend um sich. Nach mehreren Konzerten in Lucca und Livorno floh ich aus der Gegend Hals über Kopf. Wann werden wir vor diesen Krankheiten sicher sein? Ich weiß nicht, wie weit die Forschung in der Medizin ist, aber es scheint, als hinke sie der Entwicklung in der Musik nach, obwohl wir gerade da noch sehr der Tradition verhaftet sind. Das Volk liebt stets und immer die Opera buffa. Es langweilt sich in längeren, anspruchsvollen Konzerten, darum will ich kurzweilig sein. Die Gefahr, vor einem gähnenden, schläfrigen Publikum zu spielen, gehe ich nicht ein. Darum überrasche ich. Das fällt mir durchaus nicht schwer. Im Gegenteil. Ich fiebere danach, mit meiner Geige die ungewöhnlichsten musikalischen Akrobatiken zu erproben. Pizzicato, Doppelgriffe, Sprünge, drei- und vierstimmige Sätze und was auch sehr verblüfft, ist die chromatische Skala in den allerhöchsten und dabei klarsten Tönen. Dank dem unübertroffenen Gespür für mein Instrument sowie meiner Antenne für die Stimmung im Saal, leuchtet schlagartig ein Alarmsignal in meinem Kopf, sobald es den Zuhörern zuviel wird, und flink spiele ich ein melodisches Adagio. Dann sitzen die Männer atemlos und mit offenem Mund, dann funkeln die Augen der Frauen so großartig, dass mir die Tränen kommen.
Es gibt auch Zeiten, da lege ich meine Geige wochenlang, gar monatelang zur Seite, selbst die neue, wunderbare Guarneri del Gesù vom Mäzen Livron. Lange bevor das Gelbfieber ausbrach, erlag ich dem Reiz einer Dame, die ich niemals hätte berühren dürfen, denn sie ist die Frau meines Wohltäters und noblen Verehrers.
Mein schlechtes Gewissen hindert mich daran, seinen Namen zu nennen, andererseits waren die Monate in Emilias Armen so fruchtbar für mein Leben und für meine Kunst, dass mein Gönner darüber Freudensprünge machen müsste. Emilia hat mich die hohe Kunst der Liebe gelehrt. Meine Geliebte ist eine reife Frau von dreißig Jahren und hat ein Kind geboren, dass eines Tages still in ihren Armen starb, während sie es stillte. Ein sonderbarer Tod! Glücklicherweise gibt es die Adoptivtochter, die arme Waise mit dem venezianischen Haar, deren Namen ich vergessen habe. Emilias Haar ist üppig und dunkel, in der Mitte gescheitelt und zu einem dicken Zopf geflochten, den sie zur dichten Schnecke am Hinterkopf rollt.
Ich lernte sie auf einer dieser fürchterlichen Soireen ihres Gatten kennen, bei denen sehr viel geschwafelt und wenig ernsthaft disputiert wird. Hin und wieder schmerzte mir davon der Kopf bis an die Grenzen der Erträglichkeit. Emilia erwischte mich, als ich mich in einem Zimmer ihrer Residenz verkriechen wollte. Sie bot mir ein anderes Gemach an. Ihres. So fing alles an. Sie machte nicht viel Federlesens. Bald pendelten wir zwischen der Villa in Genua und ihrem Schlösschen in der Toskana hin und her.
Offiziell kam ich zu ihr, um sie die Gitarre zu lehren. Das tat ich dann auch, aber hinterher. Ihr Mann war damals nach Paris gereist, um sich für die Krönung Napoleons einzukleiden. Davon wurde allerorts geredet, es hieß, sogar der Papst werde auf einem Esel über die Alpen reiten, um dem Ersten Konsul die Krone aufzusetzen. Es war Januar und ich dachte, sollte der Papst mit dem Esel über die Alpen und ganz hinauf nach Paris reisen wollen, durfte er nicht länger zögern, sonst käme er ja zum Fest zu spät. Andererseits drohte ihm die Gefahr, in Schnee und Eis zu erfrieren, weshalb es vernünftiger schien, im Frühjahr loszuziehen und in Gottes Namen zu spät zu kommen. Lieber spät als tot. Im Übrigen machte ich mir keine Sorgen um den Papst, eher sorgte mich die Rückkehr des Ehemannes. Sein Schatten eilte ihm schon voraus und verfinsterte mein strahlendes Glück. Denn in Emilias Armen ging für mich die Sonne auf. Ihr Untergang musste so lange wie möglich hinausgeschoben werden. Meine Angst allerdings war sehr übertrieben. Emilias Mann hatte mittlerweile den Italiener abgestreift. Ein Franzosenherz schlug in seiner Brust. Ja, er wollte Bürger Frankreichs werden, seit den Jakobinern ein ehrenwerter Titel. Sein Held Napoleon verkörperte für ihn die neue Welt. Endlich war einer von ganz unten gekommen und hatte sich stolz dorthin gesetzt, wo Jahrhunderte lang Könige saßen und regierten. Hatten die Jakobiner noch die Köpfe abgeschlagen, so ließ Napoleon sie an ihrem Platz, verpasste ihnen allerdings neue Gesichter. Nachdem er in Marengo die Österreicher niedergezwungen hatte, in Turin eingezogen war und mit den Bourbonen in Neapel, mit den Spaniern in Madrid und mit den Engländern in Amiens Friedensverträge unterzeichnete, verehrte ihn Emilias Mann als großen Friedensstifter. Das erzählte sie mir, während ich, von ihrem leuchtenden Körper völlig betäubt, erschlafft neben ihr auf dem seidenen Bett lag. Nach der Liebe bedeckte sie sich gerne mit einem durchsichtigen Schleier, der dann ordentlich verrutschte, wenn sie gestikulierend redete und sich dabei ereiferte. So durfte ich ihren herrlichen Busen, den weißen Bauch, in dessen Nabel ein Diamant glitzerte und die elfenbeinfarbenen Arme ungeniert betrachten. Sie hatte einen Arm angewinkelt und den Kopf in die Hand gestützt, während der andere hin und wieder hochschnellte. Dabei bemerkte ich, wie sehr mich der Kontrast ihrer hellen Haut mit dem schwarzen, gekräuselten Haartuff in ihren Achselhöhlen bis in die letzten Fasern meines Körpers erregte. Ich bedeckte sie mit Küssen und bettelte um eine weitere Lektion in kunstvoller Liebe.
„Erst wenn du mir erklärst, was man unter einem Flageolettton versteht.“
Zuerst fiel mir die Kinnlade herunter, dann griff ich an meine Brust und schließlich lachte ich schallend.
„Aber, liebe Emilia. Was ist für eine nüchterne Frage in diesem sinnlichen Augenblick.“
„Unsinn! Meine Frage ist sehr sinnlich. Wie schaffst du es zum Beispiel unendlich viele wohlklingende Töne in rasender Geschwindigkeit aus einer Saite zu locken? Deine Hand saust über die Saiten wie der Wind. Man sieht nicht, was sie treibt. Und diese Flageoletts führst du in allen Lagen deines Instrumentes aus, niemand hat das je zustande gebracht, es grenzt …“
„Gnade, Emilia!“ Ich lag wieder auf ihr. Sie verschluckte das letzte Wort und entspannte sich. Ein süßes Lächeln verklärte ihr Gesicht. „In deinen Armen bin ich nichts weiter als ein glücklicher Hund, der um mehr Liebe winselt.“
„In meinen Armen bist du ein ganzer Mann, der aus seiner Geliebten das Letzte holt.“
Vor der Gitarrenstunde erklärte ich Emilia in wenigen Worten einige Begriffe. Wir waren angezogen, hatten unsere Haare gekämmt, sahen sauber und unschuldig aus. Ich kann ehrlich behaupten, dass ich mit zweiundzwanzig noch unschuldig aussah, und Emilia kleideten ihre dreißig Jahre wie ein Brautjungfernkleid. Sie ließ den Diener Tee und etwas Gebäck bringen. Als er verschwunden war, fragte ich:
„Was wird er deinem Mann verraten?“
„Dass du hier warst und mich die Gitarre schlagen lehrtest.“
„Dein Mann wird die Gitarre an mir zerschlagen.“ Neugierig wartete ich auf ihre Reaktion.
„Hast du Zeit, Shakespeare zu lesen?“
Statt einer Antworte formte ich meine Lippen zu einem Kuss. Emilia errötete.
„Du hast sehr große schwarze Augen, in denen ein heißes Feuer lodert“, flüsterte sie und neigte sich vor. „Mit diesem Feuer wirst du die Welt erobern.“
So ein schönes Kompliment verdiente endlich die Antwort auf die von ihr zuvor gestellte Frage.
„Ich denke, du hast eine Ahnung davon, was ein Flageolett sein könnte?“
„Certamente, amore mio! Es sind die leisen Obertöne deiner Geige. Du machst sie hörbar, indem du die Saite an einem Teilpunkt mit sehr viel Fingerspitzengefühl abdrückst. Der erklingende Flageolettton ist eine Oktave höher als die Saite.“
„Brillante, tesoro mio! Dennoch solltest du wissen, dass ich außer den einfachen Flageoletttönen auch solche in Doppelgriffen der Terz, Quinte, Sexte ausführe und dass man ja auch natürliche Töne mit Flageoletttönen in Oktavengängen zusammenklingen lassen kann.“
„Ich bin erstaunt darüber, wie begeistert du von deiner Arbeit sprichst. Du liebst deine Musik.“
„Würde ich es nicht tun, wäre ich nicht hier, wäre ich nirgends, existierte ich nicht. Meine Musik bin ich.“
„Ist es nicht Hassliebe? Sicherlich hat sie dich oft gequält!“
Darauf fiel mir nicht sogleich eine Antwort ein. Natürlich lagen mir böse Worte über meinen Vater auf der Zunge. War die Schinderei, der er mich unterworfen hatte, wirklich nötig gewesen? Ich liebe die Musik, ich liebe die Mandoline, die Gitarre, die Geige. Meine Liebe gehört niemandem sonst als diesen Instrumenten und der Musik. Was wäre die Welt ohne Musik? Was wäre mein Leben ohne sie? Vater hätte mich nicht mit Essensentzug zu strafen brauchen, wenn ich statt zehn nur acht Stunden geübt hätte, denn ich habe der Musik den Platz eingeräumt, den sie für ihr Wachstum benötigte. Im Zusammenleben mit mir blieb der Musik nichts anderes übrig, als sich mit mir gemeinsam auszudehnen und zu wachsen. Schritt für Schritt Genua erwecken, aus seinem mittelalterlichen Schlaf reißen, als rebellische Melodie in sein Ohr schleichen, bis ins Innerste, dort aufräumen, die in Ketten schmachtenden Gefühle befreien. Dann weiter, Schritt für Schritt, Ton um Ton, hinaus in die Weite des italienischen Landes.
16
Das Gelbfieber in Livorno griff weiter um sich. Lucca sperrte vorerst die Grenzen und verbot allen Verkehr mit Livorno und Mailand blockierte die Einfuhr von Waren jeglicher Art aus der Toskana.
Niccolò machte es sich über die Wintermonate im Haus in San Biagio bequem. Seine Mutter Teresa kochte Genueser Speisen und servierte ihm einen Montferrat. Nicht immer war der Himmel grau und die Luft feucht und so wagte Niccolò einige Spaziergänge zur schönsten Bucht von Genua am Cap Santa Chiara. Wenn er dann auf der Anhöhe stand, in einen dicken Mantel gehüllt, den Kragen über die Ohren geklappt, die langen, gewellten Haare widerborstig im Wind, träumte er von Emilia. Vor seinem geistigen Auge sah er sein Konzert in ihrer Residenz. Er auf dem Podest, begleitet von einer Harfenspielerin, Emilia im Festsaal eine applaudierende begeisterte Zuhörerin. Er erinnerte sich nun, wie sie sich beim ersten Mal dem Podest näherte, ihren Arm zu ihm hochhob, diesen schönen, elfenbeinfarbenen Arm, seine Hand ergriff und sie länger drückte, als es nötig gewesen wäre. „Niccolò Paganini!“, hatte sie überschwänglich gerufen. „Wien hatte Amadeus, wir haben Niccolò!“ Wie immer beschämte ihn der Vergleich mit Mozart. Er war es, dem die Welt die schönste Musik zu verdanken hat. Niccolò könnte sich allenfalls in seinem Glanz sonnen, wenn er eine Variation zu einem seiner göttlichen Werke schaffen würde. Vielleicht kommt der Tag, dachte Niccolò und machte sich in Gedanken schon an die Arbeit.
So entstand in den kalten Wintermonaten des Jahres 1804 die Sonata concertata für Gitarre und Violine. Er saß allein am Fenster des lichten Hauses in San Biagio, die Geige griffbereit, die Gitarre an einem Gurt um seine Schulter, als er sie vollendete. Das Knistern des Kaminfeuers echote in seinen Ohren, Klanggirlanden, harmonische Tonbögen erregten sein Herz. Er widmete das Werk seiner Emilia.
Von nun an traf er sie nur noch offiziell. Ihr Ehemann war mittlerweile so gesalbt aus Paris zurückgekehrt, als wäre er selbst gekrönt worden. Niccolò erfuhr von Napoleons ungehörigem Verhalten in der Kathedrale Notre Dame. Vor aller Welt habe der Konsul dem Papst die Krone aus der Hand genommen und sich selbst gekrönt. Warum hatte er den Papst bloß kommen lassen? Von Rom hinauf nach Paris, weit über die Alpen? Damit alle Welt begreift, dass die Kirche ihre krönende Macht verloren hat, antwortete Emilia.

Lucca hatte inzwischen die Quarantäne aufgehoben. Im Januar des folgenden Jahres kehrte Paganini mit seinem Bruder nach Lucca zurück. Die Quilici boten den Brüdern an, so lange in ihrem Haus zu wohnen, wie es ihnen beliebte. Eleonora war gereift, und in Niccolò erwachte sogleich der Wunsch, sie zu berühren. Emilia hatte in ihm ein Feuer geschürt, das nun aufloderte. Natürlich durfte er das junge Mädchen nicht anfassen. Er durfte ihr Gitarrenstunden geben, ihre Fortschritte verfolgen, ihre Fehler verbessern und dabei ihren runden Arm und ihre weißen Finger versetzen. Das war alles und das war nicht genug. Niccolò litt Qualen beim Anblick des üppigen Mädchens und zwang sich, nur an die Arbeit zu denken. Konzerte, Komponieren und Gitarrenunterricht füllten seine Zeit nicht vollständig aus. Immer blieb Zeit für Gedanken, Wünsche, Drang, Unruhe. Nicht nur aus diesem Grund, sondern weil er tatsächlich regelmäßige Einkünfte wünschte, bewarb er sich um die Anstellung als Konzertmeister im Orchester von Lucca. Seine Kunstfertigkeit hatte sich herumgesprochen und er war nicht größenwahnsinnig wie Napoleon, wenn er sich ausmalte, sein außerordentliches Talent könnte das Orchester von Lucca ja nur weiterbringen. Das Amt für Innere Angelegenheiten schrieb ihm Folgendes:
Dem Signor Niccolò Paganini
Der oben genannte Paganini ist unter die Musiker des Nationalen Orchesters in der Eigenschaft eines Ersten Geigers aufgenommen, ohne dass dadurch die Rechte des derzeitigen Leiters, Professor Romaggi, eingeschränkt werden … Er erhält, beginnend mit dem heutigen Tag, eine monatliche Summe von zwölf Scudi und wird verpflichtet sein, zwei aus Lucca stammende Schüler aufzunehmen …
Am 22. Januar 1805 wurde Paganini eingestellt. Das Orchester war ein bunter Haufen unterschiedlich begabter Musiker, der Niccolò bei weitem nicht das Wasser reichen konnte, doch niemand bekam dies zu spüren. Niccolò stellte seine Begabung unter den Scheffel, während er seine Kollegen gewandt korrigierte, sie beriet, ermunterte, aber niemals tadelte. Er half jedem Musiker, was auch immer er für ein Instrument spielte, egal welches Problem ihn peinigte. In nur wenigen Lektionen stellte er eine falsche Bogenhaltung richtig, obwohl die seine ganz und gar nicht der üblichen entsprach, statt trocken und pedantisch unterrichtete er seine Schüler spielerisch, vermittelte ihnen Freude an der Arbeit und respektierte auch den schlechtesten unter ihnen. Er war unfehlbar in seiner Technik und konnte wie Mozart eine Tonhöhendifferenz von einem Achtelton wahrnehmen. Dank seiner Fürsprache wurde auch Carlo im Orchester aufgenommen. Dieser ließ, kaum hatte er eine Bleibe gefunden, sein Frau Anna nachkommen.
Indessen wohnte Paganini weiterhin im Hause der Familie Quilici. Allerdings war er so beschäftigt, dass er den Bewohnern meistens nur flüchtig begegnete, wenn er gerade durch den Flur auf sein Zimmer hastete. Seine schmale Gestalt blieb dennoch nie unbemerkt. Und sobald ihn jemand erwischte, packte er ihn an der Jacke und zog ihn zu einem Schwätzchen in ein Zimmer.
„Paganini, Sie sind ein Genie! Italiens Mozart, dio mio! Sie leisten Unglaubliches in diesem wahrhaft durchschnittlichen Orchester. Durch Sie werden die Hanswurste über Italien hinaus bekannt werden!“, plapperte die Hausherrin. Oder Signor Torre, den er im Cellospiel unterrichtete, sagte: „Sie sind keine Spur neidisch, fahren kaum aus der Haut, obwohl die Schüler so rechte Nieten sind.“ Paganini nickte verzweifelt, denn er wollte nichts anderes als seine Ruhe. Im Februar ergab sich hin und wieder ein gemeinsames Abendessen, doch Niccolò hatte Mühe, an turbulenten Tagen gleichzeitig das gute Essen, die Ruhe und Eleonoras Anblick zu genießen.
In den folgenden Monaten begann er die Komposition „Alla Ragazza Eleonora“, unterwies mehrmals wöchentlich seine Schüler, übte und arrangierte täglich unter anderem Werke von Rode, Kreutzer und seine eigenen. Nebenbei trat er bei Privatkonzerten auf. Er steckte also über beide große Ohren in Arbeit. Und mitten hinein in diese fruchtbare Phase platzte Elisa Baciocchi, die Schwester Napoleons.
17
Napoleon war 1798 erfolglos aus Ägypten zurückgekommen, fackelte nicht lange und putschte gegen das regierende Direktorium in Paris. Er ließ sich zum Ersten Konsul ernennen, gewann an innerer Größe, wurde daraufhin auch tatsächlich zwei Zentimeter höher und brach auf, sich die halbe Welt zu Füßen zu peitschen. Er schlug die russisch-österreichischen Truppen bei Austerlitz, die preußische Armee bei Jena, marschierte in Berlin ein und beabsichtigte mit der Kontinentalsperre die Engländer zu isolieren, weil sie so dreist gewesen waren, ihn bei Trafalgar zu schlagen und die Seeherrschaft an sich zu reißen. Auch in Italien war er nun allgegenwärtig, aber das Land hatte sich nicht ganz mit ihm abgefunden. In Genua, in der Villa Di Negros zerstritten sich die Bonaparte-Anhänger. Di Negro verteidigte ihn, der Dottore neigte dazu, ihn zu verteufeln, Giorgio fürchtete den Zusammenbruch der Carbonari, sollten sie nicht von einer starken Hand geleitet werden. Der wirklich fähige Mann, Buonarotti, saß in der Schweiz und hatte die Filadelfi gegründet, dank deren Hilfe er den Norden Italiens unterwanderte. Derweil Emilia an Niccolò dachte und fürchtete, er habe sie längst vergessen.
Die Meinungen über Napoleon waren gespalten, die einen misstrauten ihm, die anderen glaubten an ihn. Di Negro hielt den Korsen für einen intelligenten Mann mit großem strategischen Feingefühl. Ihm lag nicht nur an Siegen, er strebte auch kulturelle Entwicklung an. Im Land hatte sich seit den Medici, die Michelangelo, Raffael, Leonardo da Vinci gefördert hatten, nicht viel getan. Das Land musste lernen. Und warum nicht von den Franzosen?
„Weil sie sich während der Schreckensherrschaft wie Barbaren aufgeführt haben!“, mischte sich Emilia ein. „Stell dir vor, nur weil du blaues Blut hast, wird dir der Kopf abhackt?“
„Das blaublütige Gesindel hat bekommen, was es verdient.“ Sämtliche Augen richteten sich auf Andrea, den sechzehnjährigen Sohn Buonarottis. Zum ersten Mal beteiligte er sich an der Diskussion. Andrea wollte Margherita beeindrucken. Sie saß immer dabei, sagte kein Wort, blickte mit ihren großen grünen Augen jedem ins Gesicht und ließ dabei zärtlich ihre Finger durch das glänzende Haar gleiten. Sommersprossen schmückten ihre kleine Nase. Ihre Haut schien aus Porzellan, ihr Ausdruck abwesend. Doch sie war sehr präsent. Kein Satz schien ihr zu entgehen. Wer sie genau betrachtete, entdeckte Goldpunkte in ihren Augen und konnte direkt sehen, wie es hinter der weißen Stirn arbeitete. Margherita verfolgte nicht nur die erregten Debatten, sie verfolgte in Gedanken die verschlungenen Wege jenes Mannes, der schon vor Jahren tiefe Gefühle in ihr ausgelöst hatte.
„Napoleon ist nicht Robespierre. Was mir nicht behagt, sind die höheren Steuerabgaben, weil jedes Franzosenmaul von uns gefüttert werden muss.“
„Von den Abgaben baut Napoleon Schulen, Universitäten, kulturelle Zentren, Giorgio.“
„Du hast recht, Giancarlo! Und du bringst mich auf eine Idee. Um in einem Italien ohne revolutionäre Plattform unser Ziel zu erreichen, brauchen wir einen Verbündeten unter den Royalisten.“
„Wir brauchen eine offizielle Liberale Partei, Giorgio, das ist wirksamer. Was meinst du dazu, Andrea?“ Di Negro hatte die nachlassende Aufmerksamkeit des jungen Mannes bemerkt. Er war ganz in den Anblick Margheritas versunken. Sie sah tatsächlich aus wie ein Edelstein. Die Sonne zauberte Diamanten in ihr Haar, so dass es herrlich funkelte. Andrea war wie geblendet und antwortete nicht, worauf die Versammlung laut hinauslachte. Auch Margherita lachte. Beschämt erwachte der junge Mann aus seiner Verzückung, stand abrupt auf und verließ gekränkt den Raum.
„Oh, oh, oh!“, machte Di Negro. Seine Kameraden kümmerten sich nicht weiter um den Jungen, sondern knüpften an das unterbrochene Gespräch an.
„Eine liberale Partei? Ausgezeichnet! Doch keinen Napoleon, bitte schön! Er ist mit Vorsicht zu genießen. Einmal liebt er die Bevölkerung, andererseits verkündet er, er regiere nicht mit dem Pöbel. Und plötzlich sitzt er im hermelinbesetzten Mantel aus purpurnem Samt auf dem Thron und will die Welt erobern. Der macht sich über uns lustig.“
„Nicht ganz, Signori!“ Emilias Seidenkleid raschelte. „Vielleicht habt ihr noch nichts vom Gesetzbuch gehört, das der neue König von Italien jüngstens erlassen hat. Es nennt sich Bürgergesetzbuch und schafft die Privilegien der Pfaffen und Blaublütigen ab. Eine Menge Klöster werden geschlossen und geistliche Orden aufgehoben. Deren Besitz fällt dann den Landgemeinden zu, und das ist richtig so, denn mit der Frechheit der Kirchen, den Himmel und weite Flächen auf Erden beanspruchen zu wollen, muss es ein Ende haben.“
„Liebe Freunde, hören wir auf, über unseren Bonaparte herzuziehen!“, rief Di Negro. „Der Gedanke, die vereinte, große Republik Italien zu gründen, hatte ihn schon damals fasziniert, als er Sardinien niederwalzte und nach der Schlacht von Lodi Parma, Mailand und Modena im Handumdrehen einsteckte. Angeblich hat er dem neapolitanischen Botschafter Folgendes ins Ohr geflüstert: Man wird nie aus Lombarden, Piemontesern, Toskanern, Genuesern, Napolitanern und Römern ein einziges Volk machen können … und doch ist es eine wunderbare Idee. Wollen wir mit diesen Worten unsere heutige Zusammenkunft beschließen?“
Einstimmiges Gemurmel. Margherita verließ als Nächste den Raum.
Sie suchte Andrea und fand ihn im dritten Stockwerk an einem der hohen Salonfenster, das einen schönen Ausblick auf Genuas Hafen hatte. Bevor sie näherkam, betrachtete sie ihn. Seine schlanke Gestalt zeichnete sich als Schattenriss im einfallenden Licht ab. Eine Hand stützte sich auf eine der Säulen, die den Fenstern vorstanden. Eine elegante, schmale Hand. Die Hand eines Blaublütigen, dachte Margherita.
„Andrea?“
Beim Laut der Stimme zuckte die schlanke Gestalt zusammen und drehte sich um.
„Margherita!“ Er löste sich vom Anblick der Stadt. Sie ging auf ihn zu, während er wie gelähmt stehen blieb und sie anstarrte.
„Die Männer sind dumm. Sie widersprechen sich, reden durcheinander, stellen ihre Argumente auf den Kopf, verlieren den Faden. Sie denken an nichts anderes als Politik. Gibt es nicht schönere Dinge? Die Natur, die Malerei, die Musik zum Beispiel?“ Nun stand sie vor Andrea, der mit hochrotem Kopf anfügte: „Die Liebe …“ Margheritas Gesicht wurde durch ein zauberhaftes Lächeln verschönt und Andrea meinte, direkt in die Sonne zu blicken. Das junge Mädchen musterte ihn spöttisch.
„Warum wirst du nur immer bei jedem Wort, das ich sage, rot bis hinter die Ohren? Das steht dir schlecht. Du bist ein anmutiger junger Mann. Sehr gerne mag ich den Leberfleck unter deinem rechten Auge. Es ist das Tüpfelchen auf dem I.“ Sie kicherte. Andrea errötete schon wieder, diesmal bis zum Hals. Diese Zwölfjährige verhielt sich wie eine gebildete Dame und verteilte ungehemmt Komplimente. Das machte ihn sehr verlegen. Margherita schüttelte lachend den Kopf: „Gehen wir ein wenig im Garten spazieren!“ forderte sie ihn auf und hakte sich bei ihm unter.
18
Nicht nur in Di Negros Salon zerbrach man sich den Kopf über Napoleons Anwesenheit, auch das Volk misstraute dem neuen König von Italien. Doch ungeachtet der blutigen Aufstände im Hinterland der Toskana und der umliegenden Gegend, wo Franzosen und deren italienische Anhänger von bewaffneten Priestern beschossen und von Bauern mit Mistgabeln durchbohrt wurden, breitete sich seine Herrschaft unausweichlich bis nach Rom aus. Und großzügig verteilte er die Regentschaften über die von ihm annektierten Staaten an Familienmitglieder. Lucca wurde aus der Ex-Republik Toskana ausgegliedert, zum Fürstentum erklärt und seiner Schwester Elisa zugeteilt. Sie durfte sich auch Prinzessin des Fleckchens Piombino nennen, womit sie den Neid ihrer Schwester Pauline Borghese anstachelte. Diese hatte dafür den Vorteil, sehr viel hübscher auszusehen als Elisa. Ja, Pauline wurde „La bellisima“ genannt und war so schön, dass der Bildhauer Canova nicht anders konnte, als ihre Anmut in Alabaster zu verewigen. Die herbe Elisa hingegen ähnelte ihrem Bruder, was die dunkle Haarfarbe, den korsischen Teint und die hängenden Lider betraf, ihr Gesicht war kantig, ihr Mund streng, fast herrisch. Als sie am 14. Juli in ihrer goldglänzenden, von sechs edlen Pferden gezogenen Staatskarosse in Lucca einzog, empfingen sie zwar ein winkendes Volk und eine strahlende Sonne, aber auch Zurückhaltung und Kälte. Elisa nickte zufrieden nach allen Seiten, selbst zum Himmel, aber sie blieb auf der Hut. Noch war der König von Italien umstritten. Noch verbargen sich unter dieser Masse freudigen Volkes die Gegner, die italienischen Partisanen, die ehemaligen Jakobiner. In ihnen gärte la furia francese. Und was bezweckte Napoleon eigentlich damit, sich in der Mailänder Kathedrale zum König von Italien krönen zu lassen, raunte es in den Reihen. Ein großes Reich will er. Ein Reich wie das von Attila oder Carlo Magno.