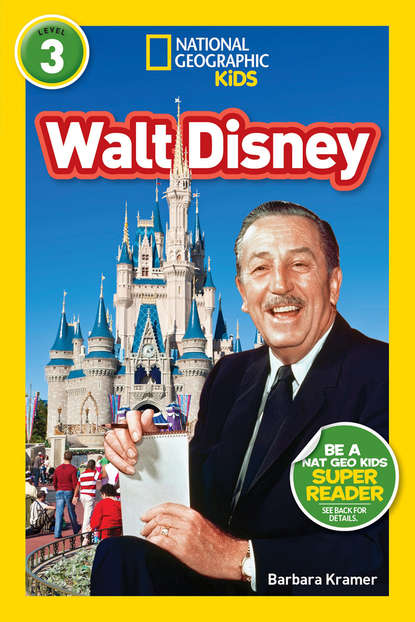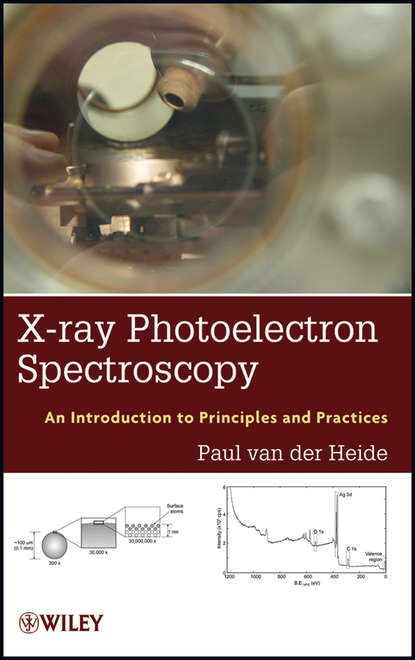SIN SOMBRA - Hölle ohne Schatten

- -
- 100%
- +
Viel mehr als diesen Wahlspruch bekam er nicht zu hören. Bruder Manuel blieb ohne Aufschluss. Er musste sich darauf verlassen, dass ihm noch ein wenig Zeit verblieb.
Über den Tag hatte er ein Treffen für die Zeit des ersten nächtlichen Silentiums vereinbart, der ersten Schlafenszeit, die kurz vor Mitternacht endete. Er konnte sicher sein, dass ihn dann niemand behelligte.
Es war Alberto, dem er begegnete. Alberto war der Ausfahrer der klösterlichen Notdurft, insofern damit vertraut, dass das Kloster ein nur allzu menschlicher Ort war. Auch ansonsten wusste er um die Gewöhnlichkeit der hier beheimateten Menschen, um ihre Bedürfnisse und zuweilen unchristlichen Anliegen.
Alberto schaffte alles ins Kloster und alles aus ihm heraus. Hauptsache, seine Auftraggeber waren zufrieden und es sprang für ihn etwas heraus, damit er sich und die Seinen durchbekam.
Immerhin war er so gläubig, dass er bei Erhalt jeder über den üblichen Lohn hinausgehenden Gabe eifrig das Kreuz schlug.
Der liebe Gott musste mit ihm sein, sonst hätte er ihm keine so schöne Möglichkeit verschafft, auf vielfache Weise wenig zwar, aber genügend hinzu zu verdienen. Und wenn manches Geschäft auch nicht sauber war, sein Hauptgeschäft war es auch nicht und gehörte doch zum Alltag und selbst zur heiligen Welt.
Diesen Reim machte er sich zu dem Ganzen und blieb so ohne Gewissensnot.
Bruder Manuel, dem hatte er schon einige Male geholfen, und alles war bei pünktlicher Bezahlung still vonstatten gegangen und still geblieben. Deshalb nahm er von ihm nun auch gerne einen weiteren Auftrag an.
Zwei Kinder herauszubringen, darunter Pepa, die er kannte. – Kein Problem!
»Mich dann auch noch.«
»Oho!«
Ein Mönch selbst, ein weiterer Bruder, der sich aus dem Kreis der Erleuchteten verabschiedete, und das unerlaubt. Das würde sicher mit einer Befragung enden. Er konnte natürlich nichts zu dem Verschwinden all der Brüder sagen.
Brauchte nur sein alltägliches Gesicht aufzusetzen, in dem sich von früh an eine große Ahnungslosigkeit von dem Lauf der Welt bemerkbar machte.
Nein, er würde nichts mit dem Verschwinden des Mönches und auch nichts mit dem Verschwinden der Kinder zu tun haben. Nein, er würde auch nichts gesehen und gehört haben, das im Zusammenhang mit den Geschehnissen stand.
Alberto meinte es erst einmal gut mit all denen, die ihn für eine Unternehmung in Anspruch genommen hatten, und die, die ihn hinterher vielleicht für eine Befragung in Anspruch nahmen, die mussten zurückstehen.
Alles Tun hatte schon irgendeine Berechtigung, und all die Fragerei hinterher kam doch eh zu spät und brachte nichts.
Das war seine einfache Denkart. Keine Worte, einfach nur machen! So würde er es jetzt auch halten.
Bruder Manuel hatte seine Gründe, diesen Ort zu verlassen, und dass er Pepa mitnehmen wollte, das leuchtete ihm ein.
Um das andere Kind machte er sich keine Gedanken. Es war alles in Ordnung, so wie Bruder Manuel es sich ausgedacht hatte.
Schnell waren die notwendigen Absprachen getroffen. In zwei Tagen bei Neumond sollte es so weit sein.
Wie immer schaute Alberto auch bei diesem Gespräch treuherzig drein, um alle etwaigen Zweifel, was seine Zuverlässigkeit anbelangte, zu zerstreuen.
Alberto hielt, was er versprach. Stets und immer! Es würde ihm nie jemand etwas Schlechtes nachsagen können.
Das war das Versprechen, das heilig gehaltene, für seinen toten Vater Felipe.
Ihm verdankte er alles. Auch sein Vater war schon Ausfahrer der klösterlichen Notdurft gewesen und hatte sich geehrt gefühlt.
Von ihm hatte Alberto alles, was er für sein Leben wissen musste, gelernt und abgeschaut.
Nicht fragen, nichts sagen, nur tun!
Albertos Abfahrt vom Kloster wurde von gierigen Augen, die alles genau verfolgten, begleitet.
Alberto träumte von saftigen Schinkenbeinen mit schwarzen Füßen dran, die er unter die Decke seines kleinen Hauses hängen würde. Die Unruhe eines Pferdes, das sich ganz in der Nähe aufhielt, holte ihn aus seinem Traum. Er hielt sein Gespann an und lauschte in die nahezu stockfinstere Nacht. Nichts war zu hören und doch spürte Alberto, dass eine Wahrheit sich vor ihm verbarg.
»Alberto ist hier! Wer etwas von ihm will: er wartet gern!«
Tat es, aber alles blieb still.
»Dann nicht.«
Mit einem Seufzer setzte Alberto seine Fahrt fort und träumte bald schon wieder von saftigen Schinken.
Es war die letzte Fahrt in seinem Leben vom Klosterberg hinunter ins nah gelegene Dorf.
*
»Du hast gesagt, du machst mich gesund!«
»Ja, das hab ich gesagt. Ich habe schon viel gelernt. Im Klostergarten wächst für jede Krankheit ein Kraut!«
»Auch für meine?«
Gabriel hatte schnell Vertrauen zu Pepa gefasst. Ihre Unbekümmertheit und ihre Zuneigung hatten ihm die Scheu genommen.
Er hatte es selbst an sich bemerkt, dass er wieder gesprächig geworden war.
Wie lange hatte er schon nicht mehr richtig geredet?!
Keiner, der mit ihm sprechen wollte, keiner, mit dem er sprechen wollte. Bis dieses Mädchen sich einfach an den Bettrand zu ihm gesetzt und mit ihm zu reden angefangen hatte.
Ein wenig hatte Gabriel noch gezögert … gezögert, ihr von dem Fehlen der einfachsten Fähigkeit, die jedem belebten und unbelebten Wesen gegeben war und ihm allein auf der ganzen weiten Welt fehlte, zu erzählen.
Nur zu gerne ließ er sich von spielerischen Aktivitäten, die freilich an die Bedingung der weiteren Bettruhe geknüpft waren, ablenken. Dabei vergaß er auch schnell die ständig am Eingang zur Krankenstation präsente Wache, die alles im Auge behielt.
»Wir haben schon vielen Schwachen geholfen!«
»Ich meine etwas anderes, Pepa!«
Gabriel verspürte große Unsicherheit. Er wollte Pepas Nähe nicht verlieren; sie musste aber auch erfahren, wie es um ihn stand.
Eine Zeit lang hatte er noch gedacht, sie würde selbst herausfinden, dass er keinen Schatten warf, dass kein Licht den dunklen Kumpanen zu erschaffen vermochte.
Gerade am Abend, wenn sie sich mit der Kerze ihm näherte, um nach ihm zu sehen, hätte sie es doch bemerken müssen.
Manchmal forschte er auch in ihrem Beisein nach seinem fehlenden Begleiter, aber selbst dies hatte ihr die Augen nicht aufgehen lassen.
Der Himmel oder aber auch der Teufel mochten dies noch nicht zulassen.
»Von welcher Krankheit sprichst du?«
Pepa schaute Gabriel mit großen Augen an.
»Schau!«
Gabriel führte seine Hand nah an den Schein der Kerze heran, die auf dem Hocker neben seinem Bett stand und ihnen das Licht für ihre abendliche Begegnung spendete.
Er achtete auf seine Bewegung, gleichzeitig auf Pepas Blick und darauf, wie sie sich verhielt, ob sie zuckte oder in Stille verharrte.
»Siehst du es?«
Es war wie wenn alle Gesetze der Welt von einem Augenblick zum nächsten nicht mehr gelten sollten.
»Uihh!«
Gabriel notierte überrascht, dass Pepas Erstaunen sich nur in dem einen Laut ausdrückte und sie ansonsten ganz still blieb.
Sie hatte die Kraft, sich das Unglaubliche weiter anzusehen.
Gabriel selbst war auch von dem Moment fasziniert. Es war jemand da, der weiter an seiner Seite blieb, der ihn nicht alleine ließ, der nicht in Angst und Schrecken verfiel.
Er wurde auch eines Wunders gewahr. Pepa und er, wie gebannt schauten sie auf die Fläche, welche seine Hand durch das züngelnde Licht der Kerze mit ihrem Schatten hätte bedecken müssen. Aber sie lag genau so hell da wie der sie umgebende Bereich.
Gabriel hörte auf zu atmen. Er war gespannt auf Pepas weitere Reaktion. Aus den Augenwinkeln notierte er, wie sie den Kopf zu ihm hindrehte.
»Du bist ein Wesen des Lichts, Gabriel! Du bist ein Engel!«
Da war sie ausgesprochen, die kindliche Ansicht, in der aber doch so viel Glaube, vielleicht sogar Erkenntnis lag. Eine Erkenntnis, wie sie sich vielleicht nur einem Kind erschließen konnte.
Und dieser Glaube, dieses Wissen womöglich, hatte genauso viel Berechtigung wie die schon hundertfachen Äußerungen, dass der Teufel seine Finger im Spiel haben musste.
Gabriel wurde von seinen Empfindungen überflutet.
Er, ein Engel, von Gott direkt beauftragt, mit Botschaften, um die er selbst noch nicht wusste, ausgestattet, er, das kleine um alles beraubte Kind ein so wichtiges Wesen im Wirken der himmlischen Mächte.
Er war unvorstellbar schön, dieser Gedanke.
Eine so einfache, aber alles überstrahlende und übertreffende Erklärung.
Eine Erklärung aber auch, die ihm den Boden unter den Füßen wegzog, die ihm in dem gleichen Augenblick, wie sie ihn beglückte, das tiefe schmerzliche Gefühl zuströmen ließ, nicht mehr zu den Menschen zu gehören, die Heimat aller Heimaten zu verlieren, und wenn er sie auch nur gegen eine größere, höher angesiedelte eintauschte, die zu spüren und zu begreifen er aber nicht in der Lage war.
»Ich kann kein Engel sein.«
Gabriel stemmte sich gegen die schmerzliche Empfindung, ausgegrenzt zu sein.
»Engel werden bestimmt nicht krank!«
»Dir fehlt nur Kraft!«, erwiderte Pepa. »Auch Engel brauchen Energie!«
In dieser Nacht, am Vorabend weiterer abenteuerlicher Geschehnisse, schlief Gabriel sehr unruhig, die widerstrebenden Gefühle des Tages hatten sich Zutritt zum Reich seiner Träume verschafft.
Allein Pepe, der grau getigerte Kater von Pepa, ließ sich nicht beeindrucken und lag zu seinen Füßen als Knäuel fest schlafend auf der Schlafdecke von Gabriel. Pepa hatte ihn zurückgelassen, damit er sich nicht einsam fühlte.
Auch Bruder Manuel war von Unruhe ergriffen und nutzte sie, um in seiner Zelle ein langes Gespräch mit Gott zu führen.
Allein Pepa, die unmittelbar davor stand, all das, was sie mit dem Begriff Heimat verband, zu verlieren, schlief tief und fest.
Das Kloster stand einsam auf kahler Anhöhe unter einem sternenübersäten Himmel, der die Großartigkeit der Welt verriet.
Doch der Frieden trog.
Schon hatte sich ein dunkler Ring um die heiligen Mauern gelegt.
Ein Ring aus finsterer Entschlossenheit.
Die Santa Casa hatte ihn geschmiedet.
*
Der Tag, der für die Rettung des Kindes ausgewählte, war angebrochen. Das erste Stundengebet zur Prim im Kreise seiner Mitbrüder verrichtete Bruder Manuel mit tiefer Nachdenklichkeit.
Über zwanzig lange Jahre hatte er hier nun gelebt und bis vor wenigen Tagen noch keinen Gedanken an das Verlassen des Klosters zu dieser Zeit verloren.
Eine Station von nur wenigen auf seinem einfachen Weg.
Wie viele Stationen würde es noch geben? Welche weiteren Pläne hatte der Herr mit ihm?
Die Ungewissheit der Zukunft breitete sich über ihm aus. In seinen Gliedern fröstelte ihn.
Aber der Glaube an Gott richtete ihn wieder auf.
Auch war noch vieles zu bedenken, damit der erste aller Pläne aufging und ihnen die Flucht gelang.
Die Wache am Eingang der Station zu überlisten, erschien ihm nicht als sonderliches Problem. Längst schon war es in Bruder Manuels Absicht gereift, ihr ein Pulver, aus Schlafmohn und der Baldrianwurzel gewonnen, in den Becher Wein zu schütten, der schon zur täglichen Gewohnheit geworden war.
Am ersten Abend bereits, als Gabriel verlegt worden war und die Wache sich in Blickweite postiert hatte, war Bruder Manuel mit einem Becher Wein auf sie zugegangen.
»Hier, nimm! Diese Arznei erhält jeder hier!«
Die anfänglichen Zweifel waren schnell gewichen, da es immer nur bei diesem einen Becher Wein am Tage blieb – die spanischen Mönche hassten entgegen anderweitiger Gebräuche den Vollrausch – und sich wegen der Pflichtwidrigkeit des Nachgebens und Schwachwerdens keine nachteiligen Folgen eingestellt hatten.
Den ganzen Tag versuchte Bruder Manuel, seine Aufregung zu unterdrücken.
Er kümmerte sich um die Brüder, die auf der Station lagen, wie er es immer tat, mit ein wenig Zeit zum Zuhören, mit ein wenig Zeit zum gemeinsamen Beten und zum Erteilen des Segens, und verabschiedete sich im Stillen von jedem einzelnen.
Am Nachmittag nach dem Chorgebet zur neunten Stunde, als er nach Alberto Ausschau hielt, wurde er noch unruhiger.
Alberto kam für gewöhnlich im Laufe des Vormittags. Bruder Manuel hatte eine Erklärung dafür gestreut, warum Alberto heute erst am Nachmittag erscheinen würde, hatte etwas von einem anderen Geschäft berichtet, von dem Alberto erzählt habe.
Der Vikar, der Vertreter des Priors, hatte ihn bei diesen von ihm aufgeschnappten Worten nur ungläubig angeschaut. Bruder Manuel hatte darum kein gutes Gefühl.
Die Sonne hatte längst schon ihren Gang ins tägliche Grab angetreten, die Schatten, je mehr es sich für sie öffnete, wurden immer länger und mächtiger und die Luft immer kälter. Alberto war noch immer nicht da.
Wo steckte er nur? Es musste etwas vorgefallen sein!
So kannte Bruder Manuel ihn nicht.
Es gab keine schlimmere Pein als die Ungewissheit. – Mit Gott an seiner Seite war sie Bruder Manuel nicht vertraut.
Aber war Gott jetzt noch an seiner Seite oder hatte er sich abgewendet, weil ihm das, was er vorhatte, missfiel?
*
»Ich habe Angst, Gabriel!«
Spät am gestrigen Abend hatte Pepa von Bruder Manuel erfahren, dass es notwendig geworden war, dass er und damit auch sie und Gabriel dazu das Kloster verließen.
»Aber warum denn?«
Pepa hatte sich vehement gesträubt, sich mit dem Gedanken an den Verlust ihrer Heimat anzufreunden. Sie hatte im Klostergarten frisch ausgesät und die kleinen Triebe schon durch die dunkle Erde, die sie feucht hielt, schimmern gesehen.
Was sollte jetzt aus ihrem Werk werden? Und was sollte aus Pepe werden?
Bruder Manuel hatte es unterlassen, Pepa den Ernst der Lage überdeutlich vor Augen zu führen, und deshalb verschwiegen, dass ihr Leben in höchste Gefahr geraten war.
»Was hast du nur getan?«
Bruder Manuel war mehr als ein Vater für sie. Sie sah ihn fast als Heiligen an, vielmehr als andere hätte er solch eine Ehre verdient gehabt, als den besten Menschen, den Gott ihr schicken konnte, mit den Jahren zunehmend begreifend, dass sie ohne ihn nicht mehr am leben gewesen wäre.
Umso schlimmer nun die Überraschung, dass man ihm hier nicht mehr gut gesinnt war, dass er sich vielleicht etwas Böses zu Schulden hatte kommen lassen.
»Du musst nicht traurig wegen mir werden!«
Bruder Manuel hatte Pepa mit Augen angeschaut, die sich still mit Tränen füllten.
»Ich will Gabriel helfen, weil er ein guter Junge ist und Gott ihn liebt!«
»Ich habe ihn auch lieb!«
»Das weiß ich, Pepa, und deshalb musst du mir jetzt vertrauen, dass ich das Richtige tue, und mithelfen, dass wir Gabriel in Sicherheit bringen!«
»Aber sag, Bruder Manuel, es kann ihm doch keiner böse sein! Er ist doch ein Engel!«
Wenn Bruder Manuel noch die letzte Sicherheit für sein Tun gefehlt haben mochte, nun hatte er sie.
»Was erzählst du da, mein Kind?«
»Vielleicht glaubt es mir endlich jemand: Gabriel ist ein Engel. Er muss ein Engel sein, denn die werfen keinen Schatten!«
Das naive Gedankengebilde von Pepa hatte etwas grandios Überzeugendes, so als sei das Kind auf den Kern einer großen Wahrheit gestoßen.
»Es ist nicht zu glauben, was du da sagst, kleine Pepa, aber ich will es trotzdem tun!«
Bruder Manuel rang nach Fassung … vergebens. Er fing zu schluchzen an, ließ den Tränen endgültig freien Lauf.
Ein Wunder, das Wunder seines Lebens!
Und er hatte es nicht bemerkt. Es war nicht in Worte zu fassen.
Er war auch von einem Wunder ausgegangen, aber mehr von einem Phänomen und nicht von einem göttlichen Wunder in Gestalt eines kleinen Engels.
So also konnte solch ein Himmelswesen zu den Menschen kommen. Er hatte sich Engel immer so vorgestellt, wie die großen Maler der Renaissance sie dargestellt hatten und es überliefert war.
Und doch hatte Gott den richtigen Weg gewählt.
Nur die, die reinen Herzens waren, wie dieser Junge selbst, würden ihn als Engel erkennen. Alle anderen, die den wahren Glauben zu besitzen vorgaben, aber doch nur den Teufel in ihren Herzen trugen, sie würden diesen Engel nicht erkennen, sondern lediglich ein dunkles Werk des Satans.
Endlich vermochte Bruder Manuel wieder die Lage, in welcher sie sich befanden, mit durchdringender Schärfe seiner Gedanken zu vergegenwärtigen.
Er löste sich von Pepa, die er umschlungen und fest an sich gedrückt hatte.
»Mit wem hast du schon darüber gesprochen?«
»Nur mit Gabriel selbst. – Aber ich versteh es nicht. Hier, so nah bei Gott, muss ein Engel doch willkommen sein!«
»Es wäre schön, Pepa, wenn es so wäre. Aber was weißt du um die Kirche und um die Menschen, die ihr dienen? Viele hier und anderenorts denken, dass Gabriel böser Mächte Werkzeug ist. Und wenn sie herausfinden, dass ich ihm geholfen habe, in Sicherheit zu gelangen, werden sie wütend sein. Deshalb muss auch ich gehen, und du kommst mit!«
Noch immer hatte Bruder Manuel es unterlassen, Pepa aufzuzeigen, dass auch sie selbst vom Tode bedroht war.
Eine weibliche Seele in einem Mönchskloster, undenkbar. Und dazu noch bei den Kartäusern, einem Orden, der keine Verbindung mit der Weltlichkeit suchte, der abseits der Weltenlichts das Licht der Göttlichkeit aufspüren wollte und hier jedoch nicht fand. Ein Frevel ohnegleichen, ein Frevel gegen den Ordensglauben, wie so viele andere ungesühnte Frevel, ein Frevel dieser aber, der unabdingbar verfolgt und gesühnt werden musste.
Nicht nur der Inquisitor, auch der Prior würde sich erheben und die Anklage formulieren.
Pepas junges unschuldiges Leben würde in einem hell leuchtenden Flammenmeer, auf einem Scheiterhaufen von Holz enden … auf einem Scheiterhaufen auch, der durch die engstirnige Lust auf Rache fernab aller so oft bekundeten Nächstenliebe aufgebaut war.
*
Von Alberto war noch immer nichts zu sehen. – Der Vikar! Was wusste der Vikar?
Er hatte ihn mit einem auffälligen Blick bedacht, als er geäußert hatte, Alberto würde heute erst später zur Verrichtung seines Geschäftes erscheinen.
Bruder Manuel mochte den Vikar nicht, der dem alten, der ihn noch selbst zum Brudermönch ausgebildet und eine gute Seele hatte, gefolgt war.
Unter seiner Leitung und der des Priors war die Geborgenheit, die Aufnahme seiner Seele und seines Geistes, die er früher hier vorgefunden hatte und die ihn erst das Gelübde der immerwährenden Ordenszugehörigkeit, die ewige Profess, hatte ablegen lassen, verloren gegangen. Alles Augenmerk im Kloster schien sich nur noch auf die Zucht von Andalusiern zu konzentrieren. Sogar Maria Theresia hatte schon Interesse signalisiert, die hier gezüchteten edlen Pferde in ihren Besitz zu bekommen.
Der Gemeinsinn jedoch war abhanden gekommen, alle Begegnungen wirkten nur noch wie leere Rituale.
Der Prior und der Vikar hatten in ihrer elitären Eigensucht fast nur noch mit sich selbst zu tun und versäumten es zunehmend, den Pflichten nachzukommen, die ihnen das Amt aufgab. Der Pferdehandel, er nur schien noch das Einzige zu sein, wofür sie lebten.
Kein Geleit mehr verspürend war er vielleicht gerade dadurch auf seinen eigenen Weg geraten.
Bruder Manuel hatte viel darüber nachgedacht, warum er zum Abweichler geworden war. Sicher, ganz sicher, war das auch gottgewollt, um ein kleines Licht, ein Hoffnungslicht, für die Welt zu entzünden.
Der mangelnden Verbindung zu der Bruderschaft, der verschuldeten greifbaren Distanz zu ihr verdankte Pepa aber auch überhaupt erst die Möglichkeit, hier in dieser Kartause ihre Heimat zu finden.
Ein Schweigen, ein eisiges Schweigen, und kein gottgefälliges, erfüllte die Räumlichkeiten des Klosters. Gewinnsucht stand in der vorderster Reihe.
Vorgegebene Verhaltensweisen ohne inneren Halt, mechanische Verrichtung aller Pflichten und Gleichgültigkeit, was die Bedürftigkeit der Brüder anbelangte, vornehmlich die seelische. Und was diese außerhalb ihres Pflichtenkreises für ein Leben führten, war nicht von Interesse und blieb unbeachtet.
Eine unsägliche Diskrepanz aufgrund der unterschiedlichen Herkunft auch.
Der Prior entstammte einer hochwohlgeborenen Familie. Chancenlos, ein besonderes Erbe antreten zu können, war ihm eine Kirchenlaufbahn angetragen worden.
Eine Fehlstellung seines rechten Fußes hatte ihn darüber hinaus, was das Weltliche betraf, zum Außenseiter gemacht. Sein Weg war geebnet.
Aus kühler Berechnung, aus nichts anderem, hatte er den Weg ins Kloster gewählt und gut protegiert es mühelos verstanden, nach oben zu kommen.
Und er hatte es auch verstanden, an der Macht zu bleiben und das Amt des Priors über die vorgesehenen zwei Jahre zu behalten.
Ein eklatanter, seit Menschengedenken nicht vorgekommener Verstoß gegen eine wichtige Ordensregel der Kartäuser. Begründet mit der Besonderheit, dass just zu der Zeit, als der Wechsel anstand, niemand sonst sich für die Nachfolge im Amte hatte finden lassen und das Abweichen von der Regel auch nur vorübergehender Natur sei.
Eine die Grenze zur Lächerlichkeit überschreitende Begründung.
Tatsächlich war es nur die Folge der Einflussnahme der edlen Familie des Priors. Reliquienbeschaffung, zugesicherte, und persönliche Annehmlichkeiten für die Bruderschaft hatte die Fortführung des Amtes für den Prior leichthin möglich gemacht.
Bei der Visitation des Klosters durch andere Prioren floss der Missstand, wenn sie nicht auch käuflich waren, freilich mit in die Liste der Beanstandungen ein, aber es änderte sich nichts, weil andere, noch höher Gestellte im Orden sich kaufen ließen.
Wenigstens hätte bei der Auswahl des Stellvertreters mehr Geschick an den Tag gelegt werden können. Doch enttäuscht wurde, wer darauf gehofft hatte, ein Mann des Ausgleichs, der in der Lage gewesen wäre, der Herde ein guter Hirte zu sein, würde das Amt des Vikars anvertraut bekommen.
Und wer glaubte, dass die dunkle Zeit begrenzt war und endlich nach zwei Jahren einer anderen weichen würde, wurde erneut enttäuscht.
Ebenso der Vikar, von dem Prior hochgebracht und weiter unterstützt, klebte unter demselben Vorwand an seinem Amt. Weltliche Bestrebungen zudem hielten ihn dort sicher in der Position. Auch er war ein Spross aus adligem Geschlecht, und so wurde mit Protektion von außen die Ordensregel ebenso für ihn ausgesetzt.
Es hätte dem Kloster zum spirituellen Vorteil gereicht, wenn ein einfacher Mönch aus den Reihen der Brüder das Amt des Vikars besetzt hätte. Damit hätte die Unzulänglichkeit des hochgestochenen Priors, der allem entrückt war, abgemildert werden können. Durch die getroffene Auswahl aber zeigte sich diese Unzulänglichkeit umso mehr.
Längst schon stand die Kartause nicht mehr in religiöser Blüte und wenn man sich auch bei der Zucht der Kartäuser-Pferde anschickte, in der Weltlichkeit Beachtung zu finden, so harrte doch das Kloster immer auffälliger der Erneuerung im Geiste.
Mehr als ein Zufall war es, ohne dass Bruder Manuel darum hätte wissen können, dass Gabriel hier gefangen gehalten wurde.
Ebenso wie die Sippschaft des edlen Sion de Albanez gehörte auch die Familie des Priors zu der Linie des Herzogs von Medina Sidonia. Ein Netzwerk, ein gut funktionierendes. Alle Schaltstellen der Macht waren in dieser Provinz miteinander verknüpft.
Die Familie der Medina Sidonia war die erste, die in Spanien zu einem Herzogstitel gelangt war. Vor Hunderten von Jahren fand ihr Name zum ersten Mal Erwähnung. Durch die Reconquista war sie zu steigendem Einfluss gelangt. Der 7. Herzog von Medina Sidonia war sogar Kommandeur der berühmten Spanischen Armada gewesen, die dem Katholischen Glauben zum Sieg verhelfen wollte und gen England segelte, um dort von den seefahrenden Männern Elisabeths der Großen vernichtet zu werden.
Auch diesmal war die Kirche in Gefahr, nicht durch eine ketzerische Hure auf einem Königsthron außerhalb des Landes, sondern durch eine Ausgeburt des Satans, die als unschuldig daherkommendes Kind im Innern des Landes ihr zersetzendes Werk zu verrichten gedachte.
Wenn ihr Tun und Handeln damals auch nicht von Erfolg gekrönt gewesen war, so musste es doch diesmal sein, ehe das Land abermals verloren ging.