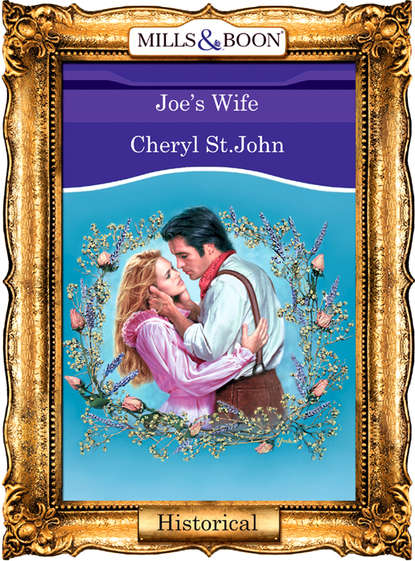SIN SOMBRA - Hölle ohne Schatten

- -
- 100%
- +
Von der rechten Seite nähern sich auch Schritte.
Zusammengeduckt erwarten Gabriel und Pepa ihr Schicksal. Jeden Moment können sie entdeckt werden. Jetzt bloß keinen verräterischen Laut von sich geben. Das kleinste Geräusch kann ihr Verderben sein.
Die Männer ziehen vorbei. Weitere Anspannung. Noch sind sie nicht in Sicherheit.
Ein, zwei Minuten später aber konnten sie aus ihrem Versteck herauskriechen, ohne Gefahr zu laufen, gehört zu werden.
»Rasch fort jetzt!«
So brachen sie in eine unbekannte Welt und in eine ungewisse Zukunft auf: ein zehnjähriges Mädchen, das in ihrem ganzen Leben nur den Innenhof eines Klosters als die Welt da draußen erlebt und kennengelernt hatte und ein geschwächter Junge, der furchtsam ahnte, dass der Weg zur Heimat ein endlos langer sein würde. Zwei Geschicke, miteinander verwoben, mit nichts ausgestattet, dem Untergang näher als dem Dasein und deren einziger wohlwollender Begleiter die kindliche Hoffnung sein konnte.
Die Hoffnung, die schwache, die Geborgenheit zurückzufinden, mit welcher sie aufgewachsen waren.
*
Der Tag brach ohne Dämmerung an, so als müssten die Spuren von allem, was in der tiefen dunklen Nacht geschehen war, sehr rasch bei hellem Lichte betrachtet und geprüft werden.
Das Kloster lag in der aufsteigenden Sonne wie eine unerschütterliche Festung.
Allein das herrenlose Gespann von Alberto, das nahe dem Tor im Innenhof stand, störte das gewohnte Bild. Die Mönche verrichteten ihr Gotteswerk wie an jedem anderen Tag.
Unmenschlichkeit unter dem Deckmantel der Frömmigkeit.
Alfonso de Torquemada, der die ganze Nacht mit Beten und Grübeln zugebracht und kein Auge geschlossen hatte, durchschritt das Tor und schaute unablässig von der Stelle, an der dieser verräterische Mönch sein teuflisches Werk vollbracht hatte, bis hinüber nach Jerez de la Frontera in die Weite der Landschaft, die jetzt zu dieser frühen Stunde klar war und nicht in der flirrenden Hitze verschwamm.
Geieraugen, die sich in die tote Landschaft bohrten und sie verschlangen, nicht aber den geringsten Funken menschlichen Lebens aus ihr herauszupressen in der Lage waren.
*
Joaquin, der Sohn des alten Luis, kam trotz seiner nachlassenden Kräfte aus dem Staunen nicht heraus.
Soeben hatte er seine tägliche Mahlzeit erhalten. Eine kalte Suppe, auf der ein paar Fettaugen schwammen, mit hartem Brot dabei, das erst durch Einweichen genießbar wurde. Er hatte sich schon gewundert, warum so lange an der Tür gearbeitet wurde, bis sie sich endlich geöffnet hatte.
Die Erklärung hierfür war einfach, aber nicht zu begreifen.
Die Wache, welche das Essen gebracht hatte, war, das hatte er selbst in seinem geschwächten Zustand bemerkt, total betrunken und tat sich mit allem schwer.
Obendrein war sie redselig, was den Alkoholgenuss noch umso mehr offenbarte.
Das hatte Joaquin so noch nicht erlebt. Er war es gewohnt, dass kein Wort gewechselt wurde, ein hartes Schweigen herrschte, und dass die Stille nur durch das Knarren der aufgehenden und sich schließenden Tür und durch die Betätigung des schweren Riegels unterbrochen wurde.
Und dass hier in dieser strengen Hölle eine Nachlässigkeit solch einer Art Einkehr fand, damit hatte Joaquin schon gar nicht gerechnet. Alles was sich ihm bisher dargeboten hatte, war militärische Genauigkeit.
Jeder Schritt und jede Bewegung schienen vorgegeben.
Tagtäglich hatten sie sich wiederholt.
Und nun kam die Wache betrunken daher. Unglaublich!
Und was noch eklatanter war und seinen Puls zum Rasen brachte: die Wache hatte vergessen, den Riegel wieder vorzuschieben.
Konnte das überhaupt sein?
Spielten seine Sinne ihm vielleicht einen bösen Streich?
Er ließ sich die Ansammlung der Geräusche, die eben seine Ohren erreicht hatte, mehrmals durch den Kopf gehen. Keine Frage: Das Geräusch, welches das Vorschieben des Riegels verursachte, war nicht dabei gewesen.
Er schlich zur Türe und lauschte in die Stille.
Nichts zu hören? – Oder etwa doch? Ein Schnarchen vielleicht?
Er lauschte noch angestrengter an der Zellentür. Ja, es war ein Schnarchen.
Offensichtlich schlief die Wache da draußen auf dem Gang ihren Rausch aus.
Vorsichtig schob er seine Finger zwischen das Gemäuer und die Zellentür, um zu prüfen, ob sie offen stand.
Welch ein Wunder? Sie bewegte sich.
Unfassbar! Die Tür war offen!
Joaquin bekreuzigte sich und dankte allen Heiligen, insbesondere dem heiligen Rochus, dem Schutzpatron der Gefangenen, der vor Hunderten von Jahren selbst im Gefängnis gestorben war.
»Heiliger Rochus, danke für dieses Wunder!«
Was aber tun?
Er würde mehr als eine Tür und mehr als eine Wache überwinden müssen.
War das Ganze vielleicht auch nur eine Falle?
Er konnte sich nach allem, was geschehen war, keine Erklärung geben. Er hatte doch ein Geständnis abgegeben. Sie hatten das zu hören bekommen, was sie wollten.
Wochenlang, eine gefühlte Ewigkeit, hatte er in diesem dunklen Loch verbracht, und niemand hatte sich um ihn und seinen Vater gekümmert, außer dass man ihnen durch Wasser und karge Mahlzeiten das Leben erhielt. Die ersten Tage schien er allein in diesem Trakt des Gefängnisses, der unmittelbar am Ozean liegenden Burg des Heiligen Sebastian, untergebracht zu sein. Für einen jungen Mann, der gerne unter seinesgleichen war und schon immer die Gemeinschaft geschätzt hatte, die pure Hölle.
»Man wird dich totschweigen, Amigo! Ganz langsam wird es geschehen!«
Diese Worte, die einer der Wachleute herablassend an ihn gerichtet hatte, verstärkten sich rasch zu einer ihn immer mehr beherrschenden Empfindung.
Stück für Stück verlor er sein Leben.
Er vermisste die Wärme der andalusischen Sonne, selbst die bisweilen unerträgliche Hitze, die Helligkeit des aus der Höhe kommenden Lichtes, die Geborgenheit seiner Heimat, die Nähe seiner Freunde, das Gefühl der Freiheit, auch wenn sie beschränkt und von der Willkür seines Gutsherren immerzu bedrängt war. Ja, er vermisste sogar seine harte Arbeit, die gerade das zum Überleben Nötige abwarf.
Hier fand er nichts vor, das ihm das Überleben sicherte, am wenigsten die Hoffnung.
Sie würden ihn, obwohl er nach seinem Empfinden gerecht gehandelt hatte, mit dem Tod dafür bestrafen, dass er Gabriel befreit und ihm zur Flucht verholfen hatte. Und doch würde er das Selbe wieder tun. Es war eine Frage der Ehre.
Er war erstaunt gewesen, wie schnell ihm die Männer von Sion de Albanez auf die Spur gekommen waren.
Als er den Jungen nach seiner Befreiung Essen und frisches Wasser in sein Versteck gebracht hatte, waren sie aufgetaucht. Er konnte Gabriel gerade noch aufsitzen lassen und das Pferd zum davongaloppieren antreiben.
Der verräterische Staub, den es in seinem Lauf mit dem verzweifelt um sein Gleichgewicht bemühten Jungen auf dem Rücken verursachte, hatte sich erst gerade wieder verzogen, da waren sie auch schon da. Eine Übermacht, gegen die er trotz seiner wenig ängstlichen Natur keine Chance hatte.
»Wo ist der Junge?«
Für Joaquin waren keine Fragen mehr offen, außer wie sie es herausgefunden hatten, an der richtigen Stelle zu suchen.
Er fühlte, wie sich der Strick um seinen Hals legte. Ihm würde kein Leugnen helfen. Dennoch versuchte er es, auch um Gabriel einen Vorsprung zu verschaffen, der ihm Sicherheit brachte.
»Von wem sprecht ihr?«
Noch nie hatte Joaquin mit diesen Männern, auch wenn er ihre Gesichter kannte, ein Wort gewechselt. Sie waren ihm immer fremd geblieben wie fast alle Menschen im Dunstkreis des Gutsherrn.
Einen Augenblick später schon war der Anführer vom Pferd gesprungen und hatte ihn am Hals gepackt.
»Das weißt du zu gut, verfluchter Bengel!«
Joaquin schwieg und versuchte, sich in die Situation einzufinden.
»Und dein Pferd ist auch fort!«
Der Anführer kam schnell zu dem einzig möglichen Schluss.
»Du hast den Jungen damit wegreiten lassen!«
Joaquin entgegnete nichts.
»Hängen wirst du dafür, Sohn des Luis, wenn nicht gar die Santa Casa dir die verdammte Seele aus dem Leibe brennt!«
Kurze Anweisungen, dann teilte sich die Gruppe auf.
Zwei der Männer wurden abgestellt, um Joaquin zu fesseln und wegzubringen.
Die anderen, darunter der Anführer, machten sich auf, das Kind zu verfolgen.
Was aus Gabriel anschließend geworden war, hatte Joaquin nicht erfahren.
Einem ersten Verhör durch seinen Herrn hatte er widerstanden. Mit Schlägen und Tritten übel zugerichtet, war er aber nah am Aufgeben gewesen.
Sion de Albanez wandte sich ungeduldig ab und sah sich die Gewalt nicht an.
Diese sturen Bauernsöhne, man hätte sie totschlagen können und dennoch nichts aus ihnen herausbekommen.
So hart und trocken wie der Boden dieser Landschaft.
Schließlich war, für Joaquin überraschend, nachdem er wieder zu denken und zu begreifen in der Lage war, von ihm abgelassen worden, gerade da ein Reiter Sion de Albanez eine Nachricht überbracht hatte.
»Schafft ihn mir aus den Augen. Wenn er schweigen will, dann soll er es richtig tun. Die Mauern, die sein Heim werden, werden es ihm abverlangen. Er wird ihnen viel zu klagen haben, aber sie antworten ihm nicht.«
Mit diesen Worten hatte der Gutsherr Joaquin seinem für ihn bestimmten Schicksal überlassen.
Nachdem er einige Tage bei vollkommener Dunkelheit und Geräuschlosigkeit in seinem Verließ verbracht hatte, war es draußen auf dem Gang laut geworden. Stimmengewirr, was er zunächst wie durch einen Schleier hörte. Metallene Geräusche. Irgendwer sonst vielleicht, der auch in diesem Trakt des Todes, wie es ihm schien, eingesperrt werden sollte, schien sich dagegen zu wehren.
»Bastardo!«
Joaquin fuhr ein Schrecken in die Glieder. Mit einem Mal war er hellwach.
Er kannte diese Stimme.
Papa!
Es war die Stimme seines Vaters!
Papa! Wie können Sie dir das nur antun?
»Ich bin hier, Papa! Hörst du?«
Luis hörte die Stimme seines Sohnes und wehrte sich noch mehr gegen seine Widersacher und gegen sein Verbringen in eines dieser dunklen, nassen Löcher hier.
»Lasst mich zu ihm! Joaquin, mein Junge …«
Das Stimmengewirr erhob sich zu einem fürchterlichen Radau.
Jetzt waren sie vor seiner Zelle angelangt.
»Papa!«
Joaquin trommelte mit Wucht gegen die Tür.
Wenn er nur die Kraft gehabt hätte, sie aufzubrechen. Er hätte seinem Vater beigestanden und ihn aus den Händen seiner Gegner befreit. So aber musste er sich dem deprimierenden Gefühl der Ohnmacht hingeben.
Die Stimmen entfernten sich etwas.
Endlich hörte er, wie eine Zelle aufgesperrt wurde. Kurze Zeit danach wurde die Tür wieder zugeschlagen und der Riegel mit dem gleichen Geräusch wie bei seiner Zellentür vorgeschoben.
Die Schritte der Wachleute kamen wieder näher.
Joaquin hätte schreien müssen. Aber er biss sich auf die Lippen und wartete ab.
Schließlich kehrte Stille ein. Aber es war eine ganz andere Stille als die, die ihn hier empfangen hatte.
Was war mit Vater?
»Papa?«
Joaquin hatte sich auf den feuchtkalten, modrig riechenden Boden geworfen.
Er rief durch den Schlitz zwischen Tür und Boden hindurch.
»Papa, bist du heil?«
Nach endlos langer Zeit erst eine schwache Erwiderung.
Luis hatte Mühe, Kraft für seine Stimme zu finden.
*
Die Unterbringung von Vater und Sohn in nahe beieinander liegenden Zellen geschah nicht ohne Grund. Rund um die Uhr waren tonlose, lautlos wie Schatten dahergekommene Spitzel postiert, die jedes Wort zwischen den beiden mitbekommen sollten.
Eine Zeit lang noch vermochten Luis und Joaquin ihren Mund über die Sache gut im Zaum zu behalten. Sie witterten diese lautlose Gefahr, die sich draußen auf dem Gang zwischen ihren Zellen niedergelassen hatte. Aber irgendwann wird selbst die größte Gefahr, die doch nur im Verborgenen bleibt und sich nicht zeigt, als solche nicht mehr wahrgenommen.
Die List der Gegner, sie ging auf.
Erst nur erfolgte eine zaghafte Andeutung darüber, was ihnen widerfahren war. Dann aber wurde der Austausch, noch dazu irgendeine Reaktion auf den Anfang ihrer Unterhaltung ausgeblieben war, immer klarer und verständlicher.
Die Spione in der Dunkelheit blieben still und schrieben weiter mit.
Letztlich hatten sie so viel notiert, dass es für zehn Anklagen gegen beide gelangt hätte.
Umso überraschter zeigte sich nach Tagen Enrique Lopez, der Kommandant des Gefängnisses, als er Weisung erhielt, Joaquin vorzuladen und ihm zu signalisieren, dass sein Vater unbestraft bleiben würde, wenn er nur ein Geständnis unterzeichnete.
»Das verstehe, wer will. Beide haben sie den Tod verdient!«
Joaquin setzte kein Vertrauen in die Worte von Lopez. Und was für ein Geständnis sollte er überhaupt unterschreiben?
Es war seinem Gegenüber anzumerken, dass ihm der Glaube an die eigenen Worte fehlte.
Vorsicht! Manch ein Wortbruch, von dem er gehört hatte, manchen, den er schon miterlebt hatte.
Die Oberen, die vorgaben, sich allem verpflichtet zu fühlen, die vorgaben, von Gott persönlich die Gnade ihrer Macht erhalten zu haben, sie fühlten sich weder ihm noch irgendeiner Gerechtigkeit verpflichtet und noch nicht einmal dem von ihnen Geäußerten.
Wer die Macht hatte, lieferte sie der Freiheit ihrer Launen aus. Was gestern noch festen Bestand haben sollte, galt am nächsten Tag mitunter nichts mehr, Bündnisse, Verträge oder noch mehr einfache Zusagen gegenüber Untergebenen inbegriffen.
Und für wen sie sich erst einmal interessierten und wen sie verfolgt und festgenommen hatten, den ließen sie doch nicht einfach wieder laufen.
Nur warum mussten sie einen alten Mann noch bedrängen, einen Menschen der immer seine Pflicht getan und alle Zeit für seinen Herrn gearbeitet und sich abgemüht hatte? Warum mussten sie ihn bestrafen für etwas, das keiner Strafe wert war.
Dass sein Vater sich für Gabriel eingesetzt und ihn zu schützen versucht hatte, war aller Ehre Genüge getan.
Konnte es sein, dass ihre Einsicht so weit gediehen war?
Joaquin rätselte.
»Was soll ich unterschreiben?«
Er versuchte die Stille zu beenden, die nur ihn unter Druck setzte. Enrique Lopez blickte angestrengt auf das vor ihm ausgebreitete Schreiben. Das Lesen des auch ihm unbekannten Textes fiel ihm offensichtlich schwer. Schließlich ließ er es sein.
»Hier, lies selbst, wenn du es kannst!«
Barscher Befehlston zur Wiederherstellung der Autorität.
Zögerlich nahm Joaquin das Papier an sich und überflog es. Sehr rasch verengten sich seine Augen. Schrecken in die Starre des Gesichts geschrieben, während der Kommandant ungerührt einen Flecken eingetrockneten Blutes auf seinem Hemd musterte.
»Gabriel ist tot?«
Joaquin wollte nicht glauben, was er da las.
»Wie ist das passiert?«
Der Kommandant erinnerte sich an die Worte, mit denen er das Papier erhalten hatte.
»Vom Pferd gefallen und das Genick gebrochen. – Und du hast ihn wegreiten lassen!«
Eine grausame Antwort, lapidar ihm entgegnet.
Joaquin schluckte und starrte den Kommandanten an, blickte ihm auf die Lippen, so als müsse eine Veränderung der Mimik oder ein Wort, ein Satz die enge Situation auflösen und allen Schrecken von ihm nehmen. Doch der Gesichtsausdruck von Lopez blieb gleich, seine Lippen bewegten sich nicht.
Vom Pferd gestürzt!
Er sah das letzte Bild von Gabriels Flucht vor seinen Augen. Seine Unsicherheit auf dem Rücken des Tieres.
Ja, es konnte so sein, wie es der Kommandant geäußert hatte. Und wenn es so war, dann traf ihn die Schuld allein.
Nicht mehr verlangte dieses Schriftstück, als dass er diese Schuld eingestand.
Egal, ob er es gut gemeint hatte und Gabriel retten wollte.
Langsam nahm er den auf dem Tisch bereit liegenden Federkiel an sich und tauchte ihn in das Tintenglas, das geöffnet für das Leisten seiner Unterschrift bereit stand. Ein letztes Nachdenken, dann räumte er ein, am Tod von Gabriel schuld zu sein.
Enrique Lopez nahm das Geständnis an sich, warf einen Blick auf den Namensschriftzug mit dem Kreuz an seinem Ende, sagte nichts und verließ den Raum. Zugleich trat die Wache wieder ein und brachte Joaquin zurück in seine Zelle, die ihm nun fast wie eine Zuflucht vorkam. Er wollte niemanden sehen, wollte seine Schuld mit sich selbst ausmachen.
Auch seinem Vater verschloss er sich und antwortete ihm den ganzen Tag nicht auf seine unablässigen Fragen, die er verwirrt durch das Dunkel stellte.
*
Und jetzt plötzlich, da er mit nichts mehr als mit seiner Bestrafung rechnete, nach drei Tagen an Qual, in denen er nur den Wunsch verspürt hatte, einem Priester seine Schuld zu beichten und um göttliche Vergebung zu bitten, ein Wunsch, der ihm mit höhnischen Worten abgeschlagen worden war, da stand die Tür zu seiner Zelle auf und lockte ihn, alles auf eine Karte zu setzen und zu versuchen, in der von Soldaten überlaufenen Festung auf unbekannten Gängen und in den vielen Abzweigungen den Weg in die Freiheit zu finden.
Er öffnete die Tür.
»Heiliger Rochus, steh mir bei!«
Immer noch schwankte er in seinem Vorhaben. Er konnte nicht ausschließen, sein Tun jederzeit abzubrechen und in die Zelle zurückzulaufen und auf seinem Lager zu warten, dass die Wache ihren Rausch ausgeschlafen hatte und das Missgeschick vertuschte.
Die ersten Schritte auf dem Gang waren wie der unberechtigte Zutritt zu einer neuen, nie gekannten Welt.
Luis sah sich von allem Bösen heimgesucht, als er die Stimme von Joaquin so nah an seinem Ohr hörte.
Tatsächlich trennte nur die Zellentür Vater und Sohn.
Eine einzige Tür, eine einzige verdammte Tür.
»Du musst gehen!«
»Ich kann es nicht, Vater! Ich kann dich nicht hier zurücklassen!«
Luis war zu alter Stärke erwacht. – Dieses Geschenk des Himmels musste genutzt werden. Er hatte beide für verloren angesehen. Jetzt zum Glück war das Tor zur Freiheit einen Spaltbreit geöffnet. Ganz öffnen musste es Joaquin aber selbst.
»Mich werden sie bald frei lassen. Der Kommandant selbst hat gesagt, dass ich frei komme, wenn du das tust, was sie wollten. Und du hast es getan. Also …!«
Luis ahnte, was das Wort des Kommandanten noch wert sein würde, wenn er erfuhr, dass der Sohn getürmt war statt die für ihn bestimmte Strafe zu erhalten.
Nein, dann würde er nie mehr die Freiheit wiedersehen.
Doch Luis wusste auch, dass Joaquin dem Tod geweiht war, wenn ihm die Flucht nicht gelang oder er sie erst gar nicht antreten wollte.
Dazu hätte es nicht einmal des Geständnisses bedurft.
Aber da es von ihm abgefordert war und er es abgegeben hatte, stand es sicher fest, dass sein Tod fest beschlossene Sache war.
»Verliere jetzt keine Zeit, mein Sohn!«
»Vater!«
Luis stand vom Boden auf.
»Ich segne dich, mein Sohn! Erweise dich meiner und unserer Ahnen würdig und geh! Wir werden uns wiedersehen! Es wird so sein!«
Und wenn es im Himmel sein wird!
Joaquin wusste, dass sein Vater keine weiteren Worte folgen ließ. Noch einmal prüfte er, ob die Zellentür zu öffnen war. Am Türriegel war ein Schloss angebracht, so dass er gesichert war.
Warum dieses zusätzliche Tun bei einem alten Mann, bei dem man keine Angst haben musste, dass er ausbrechen wollte und konnte?
Der Riegel, der seine Zelle absperrte, war nicht gesichert. – Merkwürdig!
Luis hörte, wie Joaquin sich zögerlich entfernte. Er war angespannt, aber auch erleichtert.
Doch den anderen Sohn, den hatte er verloren. Die Nachricht schmerzte und erfüllte sein Herz mit unendlicher Trauer. Die Nachricht von Gabriels Tod, von Joaquin überbracht.
In Joaquins Gegenwart hatte er sich noch zusammennehmen können, doch nun ergriff die Trauer vollends den Geist und seine Seele.
Ja, Gabriel war auch ihm ein Sohn gewesen. Das Glück, das sein Freund Pablo mit ihm erlebte, hatte auch sein Herz mit Freude erfüllt.
Armer, armer Pablo! Das zweite helle Licht, um welches das Schicksal ihn beraubt hatte.
Herr, wo nur bist du mit deiner Gnade? Wie kann deinem Diener nur solch ein Los zuteilwerden? Welche grausame Prüfung mutest du ihm zu?
Wer nur konnte Pablo die furchtbare Nachricht überbringen und wer nur konnte dem Freund und auch Margarita zur Seite stehen, da er hier lebendig begraben war und die Freiheit ihm verwehrt wurde?
Luis faltete die Hände und begann zu beten. Für Gabriel, für Pablo und Margarita und natürlich auch für Joaquin.
Luis betete ohne Unterlass. Das war alles, was er tun konnte. Es war wenig, aber der Herr in seinem Entschluss gab ihm keine andere Möglichkeit.
All das, was sein Leben ausmachte, war in fürchterliche Bedrängnis geraten.
Wahrheiten, unabänderliche, lasteten auf ihm, und die Mächte des Schicksals schickten sich an, weiteres Unheil zu senden und weitere Last auf ihn zu laden.
Wenn nur Joaquin die Flucht gelingen würde, dann würde er kein Wort der Klage gegen den Herrn erheben.
Das schwor er in seinem Gebet mit Gott. – Alles lag nun in seiner Hand.
Er musste hoffen, dass der Heiland sie jetzt nicht verließ.
Luis betete weiter, betete so viel wie nie in seinem Leben zuvor.
Der lehmigfaulige Geruch in dem Dunkel des Ganges wurde nur kurz durch den Gestank von Alkohol unterbrochen, als Joaquin den betrunkenen, auf dem Boden zusammengesunken da liegenden Wachsoldaten erreichte. Ohne Erfolg verlief die eilige Suche nach einem Schlüssel für das Schloss an der Zellentür seines Vaters.
Jetzt tastete Joaquin sich weiter vor. Bald erreichte ihn das Schnarchen des Soldaten nicht mehr.
Noch einmal dachte er sich zu seinem Vater zurück. So schlimm die Empfindung, ihn einem ungewissen Schicksal zu überlassen.
»Dafür werde ich dich büßen lassen!«
Die Worte waren an Sion de Albanez, seinen Herrn, gerichtet.
Da, ein Licht! Der schwache Schein einer Fackel, der sich an eine der nasskalten Wände geheftet hatte.
Äußerste Vorsicht nun! Jeden Augenblick konnte er auf weitere Wachen stoßen.
Wo Licht brannte, fanden Menschen ihren Weg.
Joaquin atmete gepresst, unfähig einen geordneten Plan zu fassen. Vielleicht musste er sich augenblicklich entscheiden, was zu tun war.
Jetzt war er dem Schein der Fackel sehr nahe gekommen. Sie war dazu bestimmt, einen Raum zu erhellen, von dem vier Gänge in verschiedene Richtungen abzweigten.
Joaquin erreichte den Raum mit sehr langsamen Schritten. Durfte er sich diese Langsamkeit überhaupt erlauben? Es konnte keine Stunden dauern, bis entdeckt sein würde, dass er sich nicht mehr in seiner Zelle befand.
Niemand da! Kurzes Durchatmen.
In welche Richtung sollte er jetzt weitergehen? Er steckte den Kopf in jeden Gang. Durch eines der Gewölbe kam von weither Lärm. Lärm wie von einer ausschweifenden Feier.
Joaquin konnte sich auf das Ganze keinen Reim machen.
Wochenlang diese lähmende Stille und nun dieser von Ausgelassenheit zeugende Lärm. Wenigstens erklärte sich jetzt der Zustand der Wache, die ihm das Essen gebracht hatte.
Es ist eine Falle! Es kann nur eine Falle sein!
Die Nachlässigkeit, welche die Wachmannschaft an den Tag legte, war einfach zu auffällig. Er verstand es noch immer nicht. Mehr als dass sie ihn gefangen hielten, konnten sie doch gar nicht erreichen.
Aber auch wenn sie ihn in eine Falle locken wollten, musste er es nutzen, dass er sich außerhalb seiner Zelle aufhalten und bewegen konnte.
Einen offenen Kampf kann ich nicht suchen.
Dies schien ihm das Schlechteste in dieser Situation zu sein. Er war waffenlos.
Seine Gegner hatten die Übermacht.
Also durfte er nicht auffallen, musste er untertauchen und es zu Wege bringen, dass man ihn nicht wahrnahm, schon gar nicht als den Gefangenen aus dem unteren Bereich des Gefängnisses.