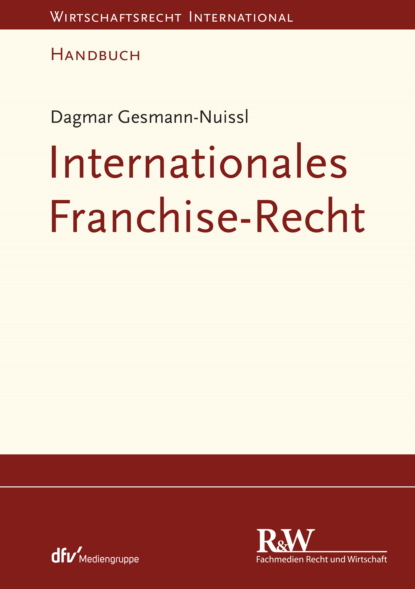- -
- 100%
- +

von
Prof. Dr. jur. Dagmar Gesmann-Nuissl
(Technische Universität Chemnitz)
Fachmedien Recht und Wirtschaft | dfv Mediengruppe | Frankfurt am Main
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
ISBN 978-3-8005-0007-9

© 2019 Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Frankfurt am Main
www.ruw.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Satzkonvertierung: Lichtsatz Michael Glaese GmbH, 69502 Hemsbach
Druck und Verarbeitung: WIRmachenDRUCK GmbH, 71522 Backnang
Vorwort
Das hier vorzustellende Handbuch ist im Rahmen des Forschungsprojektes „Gesetzliche Sonderregelungen über den Franchisevertrag im internationalen Vergleich“ mit Schwerpunkt „Vorvertragliche Aufklärungspflichten des Franchisegebers“ im Jahr 2016/17 entstanden.
Initiiert, gefördert und begleitet wurde das Forschungsprojekt vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV), welches Aufschluss darüber erhalten wollte, wie in repräsentativen ausländischen Rechtsordnungen die vorvertraglichen Informationspflichten des Franchise-Gebers geregelt sind, welche Probleme sie verursachen, wie sie in Rechtsprechung und Rechtswissenschaft behandelt und kommentiert werden und welche wirtschaftlichen Auswirkungen sie auslösen. Die rechtswissenschaftlichen Betrachtungen sind nunmehr in das vorliegende Handbuch zum Internationalen Franchise-Recht eingeflossen, welches einen systematischen Überblick über ausgewählte Franchiseregelungen vermittelt und sich dabei auf die vorvertraglichen Informations- und Aufklärungspflichten der Franchise-Geber fokussiert. Für die Möglichkeit zur Teilveröffentlichung möchte ich dem Bundesministerium an dieser Stelle ausdrücklich danken.
Ein solches Werk wäre ohne die tatkräftige Unterstützung meiner Mitarbeiter nicht möglich gewesen. Mein besonderer Dank gilt Herrn Dipl.-jur. Gernot Kirchner und Frau M. Sc. Kathrin Nitsche, welche unermüdlich recherchierten, zusammentrugen, einzelne Teile vorbereiteten und die Übersetzungen zu den im Werk befindlichen Rechtstexten anfertigten. Ebenso möchte ich Herrn Ass. jur. Michael Rätze und Herrn M. Sc. Julian Dinkel für das Korrekturlesen sowie das Anfertigen des Stichwortverzeichnisses danken.
Ich würde mich freuen, wenn dieses Handbuch der Vertriebspraxis und Wissenschaft als Referenz- und Nachschlagewerk dient und sich als wertvolle Hilfe bei der Orientierung im Internationalen Franchise-Recht bewährt. Letzteres wäre zugleich Ansporn, das Handbuch um weitere Länderbetrachtungen zu ergänzen und es kontinuierlich fortzuschreiben.
Chemnitz, im Dezember 2018Dagmar Gesmann-NuisslEinleitung
1
Franchiseverträge nehmen im Wirtschaftsverkehr eine beachtliche Rolle ein. Die Franchise-Wirtschaft in Deutschland wächst seit Jahren kontinuierlich an, wie die Zahlen des Deutschen Franchise Verbands (DFV) erneut belegen.1 Dabei werden zum einen ausländische Franchisesysteme im Inland etabliert und ermöglichen Existenzgründern den (nicht ganz so risikobehafteten, allerdings auch in der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit eingeschränkten) Sprung in die Selbstständigkeit (populäre Beispiele: Subway, McDonalds) und zum anderen können über das Franchise deutsche Unternehmen ihre Geschäftsbereiche und -ideen ins Ausland transportieren. Das Franchising ist insoweit auch eine weit verbreitete Variante für den Markteintritt im Ausland.
2
Damit verbunden stellt sich für die Franchise-Nehmer im In- und Ausland stets die Frage nach der Qualität des jeweiligen Systems, sowohl hinsichtlich der Begründung desselben (hier insbesondere Wirtschaftlichkeit, Rentabilität, Standort, Lage und Qualität der nutzbaren Objekte), der Ausgestaltung (hier insbesondere Dienstleistungs- und Produktpalette, Zahlungs-, Kreditaufnahme und -abwicklung) und – in die Zukunft orientiert – der Weiterentwicklungspotenziale des jeweiligen Franchisesystems (insbesondere Durchsetzungsfähigkeit am Markt, Möglichkeit zur Erweiterung des Vertragsgebietes). Gerade die Fragen zur Qualität des Systems prägen ganz entscheidend die Anbahnung und die sich anschließenden Verhandlungen über den Abschluss eines Franchisevertrages.
3
Dabei liegt es in der Natur der Sache, dass der Franchise-Geber das eigene System möglichst günstig darstellen möchte, um den Franchise-Nehmer zu einem Vertragsabschluss zu motivieren und um sein eigenes System im Markt zu vergrößern. Der Franchise-Nehmer möchte dagegen möglichst umfassend und ungeschönt über die tatsächlichen, insbesondere wirtschaftlichen Verhältnisse und Aussichten informiert werden, um auf der Basis realistischer Informationen eine Entscheidung bezüglich der eigenen und künftigen Selbstständigkeit und nachhaltigen Solvenz treffen zu können. Insofern laufen die Interessen der Beteiligten gerade in den Vertragsverhandlungen recht oft diametral entgegen und werden seit vielen Jahren – insbesondere weil es auf nationaler Ebene keine gesetzlichen Regelungen zum Franchise gibt und überdies bei grenzüberschreitender Systemausweitung diverse Rechtsordnungen mit unterschiedlichen Anknüpfungsregeln betroffen sein können – durch eine dezidierte Rechtsprechung2 einerseits und durch (vor-) vertragliche Gestaltungsempfehlungen3 andererseits begleitet, die das Ziel haben, dieser asymmetrischen Informationsverteilung zwischen Franchise-Nehmer und Franchise-Geber entgegenzuwirken und dabei sowohl kollisionsrechtliche als auch materiell-rechtliche Aspekte mit einbeziehen.
4
Diese Gestaltungsempfehlungen geben zwar eine erste taugliche Hilfestellung und berücksichtigen das verstärkte Schutzbedürfnis des Franchise-Nehmers, können aber die Rechtsunsicherheiten für die Verhandlungspartner – gerade was Inhalt und Umfang der qualitätsbezogenen Aufklärungs- und Mitteilungspflichten als vorvertragliche Informationspflichten anbetrifft – am Ende wohl nicht vollständig beseitigen, wie die immer wieder aufkeimende Diskussion um eine gesetzliche Regelung zur vorvertraglichen Aufklärungspflicht als Grundlage „transparenter und fairer Vertragsbedingungen“ zeigt.4
5
Im Rahmen des vorliegenden Werkes wird daher wertneutral und am Ende rechtsvergleichend die Ausgestaltung von verschiedenen Franchiseregelungen weltweit dargestellt und dabei der Fokus auf eben solche Regelungen gerichtet, die in der vorvertraglichen Vertragsanbahnungsphase einer asymmetrischen Informationsverteilung zwischen Franchise-Nehmer und Franchise-Geber entgegenwirken sowie dem verstärkten Schutzbedürfnis des Franchise-Nehmers aufgrund des Auseinanderfallens von unternehmerischem Risiko und unternehmerischer Entscheidungsfreiheit Rechnung tragen sollen. Die dargestellten Inhalte geben dabei Aufschluss über die diversen Systemansätze zu den vorvertraglichen Informations- und Aufklärungspflichten des Franchise-Gebers und legen sie detailliert, unter Verweis auf die einschlägigen Rechtsvorschriften, dar. Zur Vervollständigung des Bildes werden Aussagen dazu getroffen, inwieweit die Regelungen die Rechtssicherheit und die Rechtsstellung der Franchise-Nehmer tatsächlich verbessert haben und wie sich die Wissenschaft zu den Regelungen positioniert. Die Darstellungen folgen dabei durchgängig einem einheitlichen Aufbau, um die Transparenz und Vergleichbarkeit der Systemansätze zu erhöhen. Eine tabellarische Zusammenfassung der Ausführungen dient am Ende einem zusätzlichen schnellen Überblick.
6
Für die 1. Auflage wurden Referenzländer von allen Kontinenten ausgewählt, wobei darauf geachtet wurde, möglichst unterschiedliche Systeme in den Vergleich mit einzubeziehen. Die in Augenschein genommenen Länder sind: Deutschland, Frankreich, Spanien, Schweden und Italien innerhalb Europas sowie die USA mit den Bundesstaaten Delaware und Kalifornien, China, Brasilien, Japan, Südafrika und Australien außerhalb Europas. Diese Länderbetrachtungen bilden den Startpunkt eines Handbuches, das in der Zukunft um weitere Länder ergänzt werden soll.
7
Dabei liefern Länderbetrachtungen wichtige Informationen für Franchise-Geber und Franchise-Nehmer, aber auch für alle interessierten Kreise, die einen Überblick über die länderspezifischen Regelungen, Rechtsprechung und wissenschaftliche Meinungen zur Ausgestaltung von vorvertraglichen Aufklärungs- und Informationspflichten bei Abschluss von Franchiseverträgen erhalten wollen. Ferner kann das vorliegende Werk die Diskussionen um gesetzgeberische Maßnahmen sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene inhaltlich begleiten.
1 Ergebnisse der Befragung des Deutschen Franchiseverbands, dargestellt im sog. „Franchisebarometer 2017“ von März 2018. Demnach bestehen bundesweit rund 970 Systeme mit knapp 124.000 Partnern, was eine Steigerung von 3,6 % zum Vorjahr darstellt. Insgesamt beschäftigen die über 162.000 Franchisebetriebe (Steigerung um 1,9 % zum Vorjahr) etwa 707.000 Mitarbeiter (Steigerung um 1,3 % zum Vorjahr) und tätigen einen Umsatz von 112,2 Mrd. EUR (Steigerung um 8 % zum Vorjahr). Vgl. dazu www.franchiseverband.com/verband/franchisebarometer/. 2 U.a. OLG München v. 16.9.1993 – 6 U 5495/92, NJW 1994, 667 ff.; OLG Hamm v. 22.12.2011 – I 19 U 35/10, ZVertriebsR 2012, 177 ff.; OLG Düsseldorf v. 25.10.2013 – I 22 U 62/13, ZVertriebsR 2014, 46 ff.; OLG Hamburg v. 28.7.2015 – 4 U 10/14, ZVertriebsR 2015, 78 ff.; weitere Nachweise bei Martinek/Semler/Flohr, Handbuch des Vertriebsrechts, vor § 29 „Rechtsprechung zur vorvertraglichen Aufklärung“. 3 European Franchise Federation (EFF), Europäischer Verhaltenskodex für Franchising (Ethikkodex); Deutsche Franchiseverband e.V. (DFV), Richtlinie zur vorvertraglichen Aufklärung beim Abschluss von Franchiseverträgen. 4 Vgl. zuletzt etwa die Entschließung des Europäischen Parlaments v. 12.9.2017 für eine Europäische Richtlinie zum Franchiserecht „Legal Perspective of the Regulatory Framework and Challenges for Franchising in the EU“. Siehe dazu auch: Giesler/Güntzel, Franchising: Aufklärungspflichten und kein Ende?, NJW 2007, 3099 ff.; Braun, Aufklärungspflichten des Franchise-Gebers bei den Vertragsverhandlungen, NJW 1995, 504 ff.; Flohr, Editorial, ZVertriebsR 2016, 1 f. sowie ZVertriebsR 2018, 69 f.
Teil A: Franchiseregelungen in Europa
1
In Europa gibt es kein einheitliches Franchise-Recht, welches das Franchise im Allgemeinen oder die (vor-)vertraglichen Pflichten der Franchiseparteien im Besonderen umfassend regeln würde. Während in einigen Ländern – wie etwa in Deutschland – keine Notwendigkeit für eine Reglementierung der (vor-)vertraglichen Pflichten gesehen wird, die Parteien vielmehr privatautonom unter Berücksichtigung der Grenzen der Rechtsprechung agieren, haben andere Mitgliedstaaten Gesetze zum Franchise und den (vor-)vertraglichen Pflichten, insbesondere zur Aufklärung (disclosure requirements) beim Abschluss von Franchiseverträgen, geschaffen. Hier lassen sich z.B. Frankreich, Belgien, Spanien, Schweden und Italien nennen. Dabei beschränken sich diese Gesetze weitgehend darauf, Informationspflichten betreffend der vorvertraglichen Aufklärung zu normieren, um in dieser Weise das Informationsgefälle zwischen Franchise-Geber und Franchise-Nehmer zu vermeiden bzw. zu minimieren. Hierbei setzen sie aber durchaus unterschiedliche Schwerpunkte und werden auch durch die Rechtsprechung und Wissenschaft in unterschiedlichem Umfang begrenzt und begleitet, ein Aspekt, der im Rahmen der nachfolgenden Länderbetrachtung gut sichtbar wird.
2
Die in Europa vorherrschende Situation der unterschiedlichen Regelungen führt in der Rechtspraxis u.a. dazu, dass ein (Master-)Franchise-Geber, der einen auf das Franchisesystem bezogenen Vertrag mit einem außerhalb des eigenen Landes befindlichen Franchise-Nehmer abschließen möchte, die Rechtslage im Zielland genau kennen muss, um bei der Aufnahme der Vertragsverhandlungen nicht bereits erhebliche Fehler zu begehen, die zur Unwirksamkeit des Vertrages oder Sanktionen führen können. Ferner werden – so auch die Auffassung des Europäischen Parlaments – die Interessen der Franchise-Nehmer in unterschiedlich starker Weise geschützt, was zumindest im Rahmen eines gemeinsamen europäischen Handelsmarktes nicht immer nachvollziehbar ist.
3
Gerade deshalb beschäftigte sich das Europäische Parlament schon im Jahr 2013 mit dem Franchising und stellte damals fest, dass „Franchising als Geschäftsmodell, welches neue sowie kleine Unternehmensformen unterstützt, zu begrüßen“ sei. Andererseits mutmaßte es, dass in bestimmten Fällen „unfaire, den Franchise-Nehmer benachteiligende Bestimmungen vorherrschen“ und verlangte nach transparenten und fairen Vertragsbedingungen, die idealerweise europaweit normiert seien.1 Am 12.9.2017 wurde diese Thematik erneut aufgegriffen und eine Resolution im Europäischen Parlament verabschiedet (2016/2244 (INI)), die europaweit einheitliche Richtlinien für Franchiseverträge fordert.2 Darin wird die Europäische Kommission u.a. aufgefordert, das Franchising im Handel hinsichtlich der Existenz von unfairen Vertragsbestimmungen und anderen ungerechten Handelspraktiken zu überprüfen. Das Europäische Parlament hebt insoweit die Prinzipien einer ausgeglichenen Partnerschaft zwischen Franchise-Geber und Franchise-Nehmer hervor und sieht sie offenbar als stark gefährdet an. Es konstatiert hierzu, dass es in vielen Mitgliedsstaaten zwar gesetzliche Regelungen gebe, diese jedoch uneinheitlich seien und oft nur Teilaspekte regeln würden. Die bestehenden gesetzlichen Regelungen seien daher nicht ausreichend, um die unfairen Geschäftspraktiken europaweit zu unterbinden. Zudem führe die zersplitterte Gesetzessituation auch zu einer Behinderung der Weiterentwicklung und Verbreitung des Franchising in Europa. Das Parlament vergleicht Europa mit den USA und fordert – wie in den USA geschehen – zumindest einheitliche europäische Rechtsstandards („Leitlinien für Franchiseverträge“). Zwar – so führt das Parlament aus – gebe es innerhalb Europas die sog. „Codes of Conduct“ einzelner Franchiseverbände und insbesondere den vom Europäischen Franchiseverband (European Franchise Federation – EFF) ausgearbeiteten Europäischen Verhaltenskodex für das Franchising. Allerdings seien diese Verhaltenskodizes nicht vom Gesetzgeber, sondern vielfach von Franchisegeberverbänden entworfen worden und spiegelten daher nicht immer auch die Interessen der Franchisenehmerseite wieder. Die Entschließung empfiehlt daher einen eigenen europäischen „Regelungsrahmen“ und schlägt darin sehr konkrete Inhalte vor, u.a. eine eigenständige Definition des Franchising; Regelungen zur Bereitstellung klarer, zutreffender und umfassender vorvertraglicher Informationen, darunter auch Informationen über die Performance der Franchise-Formel; Regelungen zur Geheimhaltung zwischen Franchise-Geber und Franchise-Nehmer; schriftliche Informationspflichten vor der Unterzeichnung des Vertrags; Einräumen einer Bedenkzeit nach Unterzeichnung des Vertrags; Festschreiben einer kontinuierlichen betrieblich-technischen Unterstützung seitens des Franchise-Gebers u.v.m. – Regelungsinhalte also, welche sich an bereits bestehenden Franchise-Regularien orientieren.
4
Kritiker dieser Resolution3 fordern vor der Verabschiedung eines solchen gesetzlichen Regelungsrahmens zunächst einmal, dass Parameter aufgestellt werden, anhand derer überprüft werden könne, wie die vorvertragliche Aufklärung und die Franchiseverträge in den einzelnen EU-Staaten ausgestaltet sind, um am Ende auf dieser Basis eine Entscheidung zur Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung zu treffen. Es soll also darum gehen, erst einmal zu ermitteln, welche Regelungen sich in den über Gesetze verfügenden Mitgliedstaaten bewährt haben und die gegebenenfalls in ein solches Gesetzesvorhaben einfließen könnten und welche ihre Zielsetzung verfehlten und daher verzichtbar sind. Eine solche Bewertung setzt die Auseinandersetzung mit den Regelungen der jeweiligen Länder voraus und auch inwieweit sie von Wissenschaft und Rechtsprechung begleitet werden – die nachfolgenden Länderbetrachtungen können hierzu erste Hinweise liefern.
1 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11.12.2013 zu dem Europäischen Aktionsplan für den Einzelhandel zum Nutzen aller Beteiligten (2013/2093 (INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2013-0580+0+DOC+PDF+V0//DE. 2 Entschließung des Europäischen Parlaments v. 12.9.2017 für eine Europäische Richtlinie zum Franchiserecht „Legal Perspective of the Regulatory Framework and Challenges for Franchising in the EU“ http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0322+0+DOC+PDF+V0//DE. 3 Flohr, ZVertriebsR 2018, S. 70.
I. Deutschland1
1. Franchiseregeln
a) Rechtsgrundlagen
1
In Deutschland gibt es kein spezielles Franchisegesetz oder eigenständige franchisenehmerschützende Regulierungen. Vielmehr finden die Regelungen des allgemeinen Zivil-, Handels-, Gesellschafts-, Wettbewerbs-, Kartell-, Verbraucherschutz- sowie des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts auf Franchiseverhältnisse Anwendung. Ergänzt werden sie durch die Grundsatzentscheidungen des Bundesgerichtshofs (BGH), welche insbesondere die hier interessierenden Informations- und Aufklärungspflichten des Franchise-Gebers inhaltlich ausgestaltet haben. Daneben ist außerdem der Deutsche Franchiseverband fortwährend darum bemüht, durch Kodizes, Leitlinien und Empfehlungen das Franchiseverhältnis zu definieren sowie seine Inhalte zu präzisieren.
b) Rechtshistorie
2
Das Franchising hat in Deutschland als Vertriebsform in den 80er Jahre an Bedeutung gewonnen und einen regelrechten Boom nach der Wiedervereinigung und der danach einsetzenden Existenzgründungswelle erfahren.2 Diese Entwicklung hat sich zwar Mitte der 90er Jahre etwas abgeschwächt, dennoch entwickelte sich das Franchising als Vertriebsform kontinuierlich fort. Während in 1995 noch 530 Franchisesysteme mit 22.000 Franchise-Nehmern einen Gesamtumsatz von DM 24 Mrd. erarbeiteten, waren in 2017 insgesamt 972 Systeme mit 123.549 Franchise-Nehmern und 706.739 Beschäftigten in der Franchise-Wirtschaft tätig, die einen Umsatz von EUR 112,2 Mrd. erwirtschafteten.3 Dabei ist augenfällig, dass Franchiseverträge von Existenzgründern bevorzugt werden, die den Schritt in die Selbstständigkeit mit einem am Markt erprobten Franchisesystem wagen wollen.
c) Franchisevertrag
aa) Definition des Franchisevertrags
3
Da das Franchising gesetzlich nicht geregelt ist, sucht man auch die Definition des Franchising vergeblich. Das Franchising wird in Deutschland nach dem Ehrenkodex des Deutschen Franchiseverbandes und in Anlehnung an Art. 1 Ziff. 3 der bis zum 31.12.1999 geltenden EU-Gruppenfreistellungsverordnung für Franchise-Vereinbarung4 wie folgt definiert:
4
„Franchising ist ein Vertriebssystem, durch das Waren und/oder Dienstleistungen und/oder Technologien vermarktet werden. Es gründet sich auf eine enge und fortlaufende Zusammenarbeit rechtlich und finanziell selbstständiger und unabhängiger Unternehmen, den Franchise-Geber und seine Franchise-Nehmer. Der Franchise-Geber gewährt seinen Franchise-Nehmern das Recht und legt ihnen gleichzeitig die Verpflichtung auf, ein Geschäft entsprechend seinem Konzept zu betreiben. Dieses Recht berechtigt und verpflichtet den Franchise-Nehmer, gegen ein direktes oder indirektes Entgelt im Rahmen und für die Dauer eines schriftlichen, zu diesem Zweck zwischen den Parteien abgeschlossenen Franchisevertrags per laufender technischer und betriebswirtschaftlicher Unterstützung durch den Franchise-Geber den Systemnamen und/oder das Warenzeichen und/oder die Dienstleistungsmarke und/oder andere gewerbliche Schutz- oder Urheberrechte sowie das Know-how, die wirtschaftlichen und technischen Methoden und das Geschäftsordnungssystem des Franchise-Gebers zu nutzen.“ Ist der Franchisevertrag so vor allem durch die Überlassungs- und Dienstleistung des Franchise-Gebers geprägt, tritt in der Definition des Franchising, die der Deutsche Franchiseverband gibt, darüber hinaus die vom Franchise-Nehmer erwartete Dienstleistung hervor.5 Er soll nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht haben, ein Geschäft nach dem vom Franchise-Geber bereitgestellten Konzept zu betreiben, und dabei in dessen Weisungs- und Kontrollsystem einbezogen sein.6
5
Diese Begriffsfestlegung wird allgemein bei der Beschreibung eines Franchisevertragsverhältnisses zugrunde gelegt; auch die Rechtsprechung7 orientiert sich an dieser Definition.
6
Bei dem Vertrag zwischen einem Franchise-Geber und einem Franchise-Nehmer handelt es sich um einen privatautonom auszugestaltenden Typenkombinationsvertrag, welcher als Dauerschuldverhältnis regelmäßig Elemente aus Kauf-, Miet-, Pacht-, Geschäftsbesorgungs-, Gesellschafts- und Lizenzvertrag enthält. Nur ausnahmsweise ist er als Arbeitsvertrag zu qualifizieren, nämlich dann, wenn der Franchise-Nehmer nicht selbstständig im Sinne von § 84 Abs. 1 S. 2 HGB ist, sondern in Inhalt, Zeit und Ort seiner Tätigkeit fremdbestimmt.8 Ferner hat der BGH mit Beschluss vom 24.2.20089 festgestellt, dass regelmäßig ein Unternehmer- (§ 14 BGB) und nicht ein Verbraucherhandeln (§ 13 BGB) vorliegt, wenn der Vertrag im Zuge einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit abgeschlossen wird.
bb) Vertragsschluss und -inhalt
7
Angesichts der nur grob umrissenen Konturen und des nur abstrakten Inhalts des Franchise-Begriffs sowie der Tatsache, dass es keinen allgemein gültigen Franchise-Mustervertrag gibt, werden die Inhalte des Franchisevertrages zwischen den Vertragspartnern privatautonom ausgehandelt und festgelegt. Dabei verwundert es nicht, dass die Ausgestaltung der Vertriebsbeziehung zwischenzeitlich eher einem „Anweisungsvertrieb“ mit der vom Franchise-Geber erwünscht existentiellen Abhängigkeit des Franchise-Nehmers ähnelte, als einem Vertragsverhältnis auf Augenhöhe.
8
Den Grund für diese zunächst negative Entwicklung erkannte man Mitte der 90er Jahre in der vor Vertragsschluss bestehenden typischen Informationsasymmetrie zwischen dem Franchise-Geber und dem Franchise-Nehmer, die sich zumeist zulasten des Franchise-Nehmers auswirkte. Insofern wurde es als wesentlich erachtet, diese Informationsasymmetrie in Bezug auf wesentliche Aspekte des Franchiseverhältnisses abzubauen und für eine vorvertragliche gegenseitige Information und Aufklärung zu sorgen. Hierdurch sollte der Franchise-Nehmer in die Lage versetzt werden, eine reflektierte Entscheidung zum Vertragsschluss unter Berücksichtigung der abschätzbaren Folgen zu treffen.
9
Schon früh verlangten daher der Ehrenkodex des Europäischen Franchiseverbandes (European Code of Ethics of Franchising) bzw. der des Deutschen Franchiseverbandes von einem Franchise-Geber, dass der Franchise-Nehmer vor Vertragsschluss vollständig aufgeklärt wird. Hinzu traten die selbstverpflichtenden Richtlinien des Deutschen Franchiseverbandes zur vorvertraglichen Aufklärung, die zumindest für die Mitglieder des Deutschen Franchiseverbandes auch selbstverpflichtend wirkten.