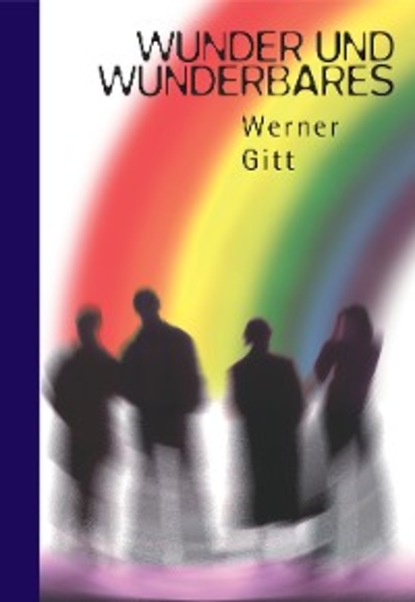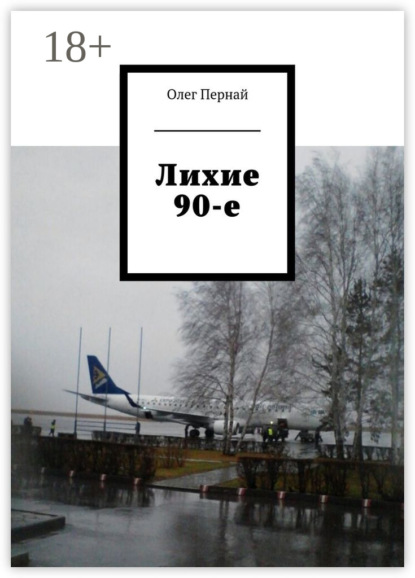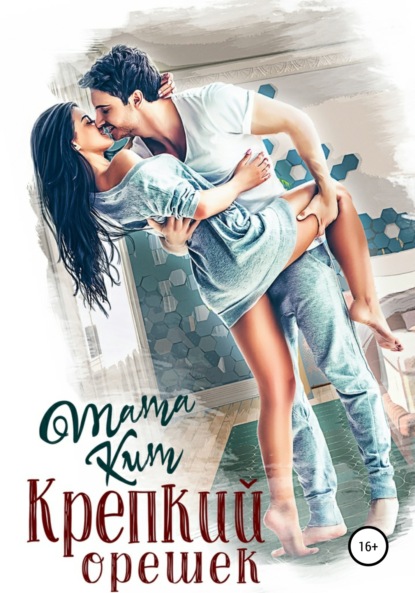- -
- 100%
- +
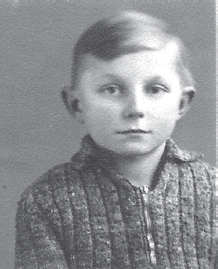
Werner Gitt als 9-Jähriger, 1946.
In Wyk begann für mich nach langer Zeit auch wieder der Schulunterricht. Zwecks Einstufung in die richtige Klasse musste ich einen Text lesen. Nach über einem Jahr »Zwangsferien« fiel dieser Test nicht gerade überzeugend aus, und so musste ich als Neunjähriger noch einmal mit den ABC-Schützen durchstarten. Diesen Rückschritt konnte ich später jedoch bequem wettmachen.
Seit Februar 1945 galt ich als Vollwaise. Meine Mutter war verschleppt worden; die letzte Nachricht von Vater lag bereits einige Jahre zurück. So wurde die Vermutung, dass Vater im Krieg umgekommen sei, immer stärker. Doch dann geschah etwas schier Unglaubliches. Meine Tante erhielt von einem entfernten Verwandten aus Bochum einen außergewöhnlichen Brief. Wie es dazu kam, sehe ich als ein Wunder an.
Nach Kriegsende kam mein Vater in französische Gefangenschaft, und er wusste nichts von dem Schicksal seiner Familie. Es wurde den Gefangenen gewährt, pro Monat einen Brief nach Deutschland zu schreiben. Dafür gab es einen formularartigen Papierbogen mit wenigen vorgegebenen Zeilen; der Inhalt wurde stets kontrolliert. Da nahezu alle unsere Verwandten in Ostpreußen wohnten, schrieb mein Vater immer wieder dorthin. Als er aber nie eine Antwort erhielt und auch nicht wusste, wo wir uns inzwischen befanden, stellte er das Schreiben ein. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein, von niemandem etwas zu hören! Es gab für ihn zwei Vermutungen über den Verbleib seiner Familie: Entweder war sie in Ostpreußen durch die Rote Armee umgekommen, oder sie konnte noch rechtzeitig flüchten und befand sich irgendwo im Westen. Wo aber mochten seine Lieben sein, wenn das Letztere zutraf?
Eines Nachts hatte Vater im Lager einen Traum: Er traf darin einen weit entfernten Verwandten, der schon etliche Jahre vor dem Krieg im Rheinland wohnte. Sie hatten sich jahrelang nicht gesehen, und als sie sich nach ihrem Wiedersehen verabschiedeten, lud der Verwandte meinen Vater ein mit den Worten: »Hermann, besuch mich doch mal!« Mein Vater sagte im Traum zu und stellte noch die entscheidende Frage: »Aber wo wohnst du denn? Ich kenne doch deine Anschrift nicht.« Der Verwandte erklärte ihm deutlich: »Bochum, Dorstener Str. 134a.« Da wachte mein Vater auf, zündete in der Nacht ein Licht an und schrieb die soeben im Traum erfahrene Adresse auf. Den wach gewordenen Kameraden im Schlafsaal erzählte er die sonderbare Traumgeschichte. Sie verlachten ihn, weil er sie ernst nahm und sogar beteuerte, dass er gleich am folgenden Tag dorthin schreiben wollte. Welch eine Überraschung! Bald traf der Antwortbrief ein, der die geträumte Adresse als exakt richtig bestätigte. Über diesen entfernten Onkel kam der Kontakt zu meiner Tante Lina nach Wyk auf Föhr zustande. Nun erfuhr mein Vater Schreckliches: Fast die ganze Familie war umgekommen; nur der kleine Werner war übrig geblieben. Bei allem schwer zu Verarbeitenden war dennoch auch Freude dabei. Der Jüngste von allen lebte.
Die Nachricht, dass mein Vater am Leben war, machte mich überglücklich. Ich weiß heute noch, wie ich draußen vor Freude gehüpft bin. Ich konnte es zunächst gar nicht fassen, dass ich nicht mehr Waise war, sondern einen Vater hatte. Nach allem Elend eine Freudenbotschaft: Ich bin nicht der einzige Überlebende. Ich habe einen Vater, zu dem ich gehöre. Nun hatte mein Leben eine ungeahnte Wende erfahren. Es gab wieder eine Perspektive.
Als Vater im Frühjahr 1947 aus französischer Gefangenschaft entlassen wurde, lautete seine Zieladresse Gut Wensin (Kreis Bad Segeberg). Seinem älteren Bruder Fritz war es gelungen, mit Pferd und Wagen von Ostpreußen bis zu diesem Ort in Schleswig-Holstein zu flüchten. Kurz darauf kam er nach Föhr, um mich abzuholen. Offensichtlich wussten wir nicht seine Ankunftszeit, sonst wäre ich schon Stunden vorher am Schiffsanleger gewesen. Unvergesslich ist mir unsere erste Begegnung im Treppenhaus. Ich lief gerade »zufällig« nach oben, da sprach mich Vater an, ohne mich jedoch zu erkennen: »Sag mal, wohnt hier die Frau Riek?« Ich hatte ihn sofort wiedererkannt, ging aber gar nicht auf seine Frage ein, sondern fragte ihn auf Platt: »Papa, kennst mi nich?« So lange hatten wir uns nicht gesehen, dass er mich nicht wiedererkannte. Welch unbeschreibliche Freude, nach so langer Trennung von einem liebenden Vater umarmt zu werden.
******
Während ich diesen Text sehr lange nach all diesen Ereignissen niederschreibe, wird mir so recht bewusst, dass ich oft in Todesgefahr gewesen bin – und Gott hat mich bewahrt und geschützt. Ich staune und danke meinem Herrn für alles Durchtragen und für das Geleit im Leben. Die dritte Strophe von »Lobe den Herren« bewegt mich immer wieder zutiefst, und ich kann sie von ganzem Herzen mitsingen:
Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet; in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet.
Die Rückkehr meines Vaters war das größte Geschenk nach all den schrecklichen Kriegsereignissen. Er hat noch einmal geheiratet, so dass ich wieder ein familiäres Zuhause hatte. Meinem Vater und der mir ebenfalls sehr zugetanen Stiefmutter habe ich es zu verdanken, dass ich eine gute Ausbildung bekam. Den weiteren Verlauf meines Lebens habe ich in dem Buch »Fragen, die immer wieder gestellt werden«16 geschildert, so dass ich meinen Bericht hier an dieser Stelle beende.
Ein Sprung in das Jahr 1990
Eines Tages erhielt ich einen Anruf von einem mir bis dahin unbekannten Mann. Er erklärte mir, dass er in der Sowjetunion geboren sei und auch dort studiert habe. Er ist jedoch trotzdem Deutscher und beherrscht die russische Sprache in Wort und Schrift. Sein Anliegen: »Ich habe einige Bücher von Ihnen gelesen. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie mit mir in die ehemalige Sowjetunion reisen und dort Vorträge halten? Ich würde die Übersetzung ins Russische übernehmen.« Ich erbat mir Bedenkzeit. In den folgenden Tagen kam mir immer wieder der Gedanke: Kann ich in ein Land reisen, mit deren Bewohnern ich so schreckliche Kindheitserlebnisse verbinde? Schließlich siegten die Gedanken Jesu, zu dem ich mich 1972 bekehrt hatte. Im Vaterunser lehrt er uns: »Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern« (Mt 6,12). Jesus hatte auch geboten: »Liebt eure Feinde!« Wir haben in Ostpreußen die Russen als Feinde erlebt. Durch sie habe ich Mutter und Bruder verloren. Und nun kommt zur Vergebungsbereitschaft auch noch das Gebot der Feindesliebe. Welch eine Spannung in meinem Herzen. Im Missionsbefehl in Markus 16,15 schließt Jesus kein Volk der Erde aus, denn er sagt ausdrücklich: »Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur!« Konnte ich zu diesem Ruf noch NEIN sagen?
Bei einem späteren Telefonat sagte ich zu. So ging die erste Reise nach Moskau, wo wir im Mai 1991 zehn Tage lang an verschiedenen Orten (z. B. Pädagogische Hochschule, Berufsschulen, Krankenhäuser, eine Fabrik und auch eine Kaserne) das Evangelium weitersagten. Gott schenkte viele offene Herzen für das Gesagte, und erstaunlich viele waren bereit, sich Jesus Christus in einer persönlichen Entscheidung hinzuwenden. Wer ist dieser Mann, mit dem Gott mich so zusammengebracht hat? Es ist Dr. Harry Tröster, der in seinem Alltag bis 2004 bei DaimlerChrysler in der Entwicklung tätig war. Inzwischen haben wir fast jährlich eine Missionsreise in den Osten unternommen. Unsere Wege führten uns weitere Male nach Moskau, aber auch je zweimal nach Kasachstan und Kirgisien, nach Weißrussland, mehrmals in das (heute russische) nördliche Ostpreußen und auch nach Polen. Wir haben bei allen Reisen viele liebenswerte Menschen kennen gelernt. Über all dieses gerade in der ehemaligen Sowjetunion Erlebte zu schreiben, würde mehrere Bücher füllen. Heute sehe ich all jene Dienste, die wir im Osten tun durften, als eine segensreiche Führung Gottes an. Die folgenden 14 Berichte sollen ein Zeugnis von dem gnädigen Handeln Gottes ablegen.
Sprung in das Jahr 2005
Im Mai 2005 waren wir zu einer Vortragsreise in Polen17, die auf Einladung von Zbyszek Kołak (Osterode) zustande kam. Er hatte eine Tour zusammengestellt, die uns nach Posen, Elbing, Osterode, Danzig und Marienburg führte. Ich hatte den Wunsch geäußert, Peterswalde (poln. Pietrzwałd) noch einmal zu sehen, denn von unserem Hotel in Osterode (poln. Ostroda) aus waren es bis dahin nur etwa 20 Kilometer. Ich nenne dieses Dorf den traurigsten Ort meines Lebens (siehe Seiten 64 bis 69). Es sind die schlimmsten Kindheitserinnerungen, die ich mit diesem Ort im früheren Südostpreußen verbinde: Einmarsch der Roten Armee, Verschleppung meiner Mutter, Vertreibung mit völlig unbekanntem Ziel. Nie zuvor wusste ich, was Krieg bedeutet. 1945 wurde ich an diesem Ort Augenzeuge aus allernächster Nähe, welche Brutalität und Grausamkeit ein Krieg entfesselt.

Bauernhof in Peterswalde, auf dem wir bis zur Vertreibung wohnten; links Wohnhaus, rechts Stall (Mai 2005).
Am Sonntag, den 22. Mai 2005, hielt ich die Predigt in der Baptistengemeinde Osterode. Am Nachmittag machten wir uns mit Henryk Machs Auto auf den Weg nach Peterswalde. Würde ich wohl etwas wieder erkennen? Sechzig Jahre sind wahrlich eine lange Zeit! Wir fuhren zunächst die einzige Dorfstraße entlang, um einen Überblick zu erhalten. Auf dem Rückweg fiel mir sofort ein alter Bauernhof auf. Das aus roten Ziegeln erbaute Wohnhaus an der Straße konnte ich mühelos als jenes Haus identifizieren, in dem wir bis zur Vertreibung wohnten. Als ich damit begann, das Gehöft von allen Seiten zu fotografieren, kam auch sogleich ein älterer Mann18 aus dem Haus, um zu sehen, warum gerade seine Wohnstätte auf solch ein besonderes Interesse stieß. Mit Henryk Mach als Dolmetscher konnten wir alles sehr schnell aufklären. Ich erzählte ihm, dass wir bis Oktober 1945 in diesem Haus gewohnt haben und dass im Sommer 1945 eine Polin mit mehreren Kindern aus Ostpolen hier einzog. Diese Kinder waren damals meine Spielgefährten, von denen ich als Kind auch sehr schnell so viel Polnisch lernte, dass wir miteinander spielen konnten. Nun erzählte er weiter: »Es waren drei Söhne und zwei Töchter, von denen ich eine geheiratet habe. Wir hatten eine gute Ehe, aber leider ist meine Frau vor drei Jahren ›300 Meter weitergezogen‹ (und damit meinte er den nahe gelegenen Friedhof).« Ich fragte nach seiner Schwiegermutter, die ich als eine sehr korpulente Frau in Erinnerung habe. »O ja«, stimmte er zu und deutete mit abgespreizten Armen auf ihren Umfang: »taka maszyna« (gesprochen: tacka maschinna) – und meinte damit, sie war »so eine Maschine«. Nun gab es nicht mehr den geringsten Zweifel: Ich hatte das richtige Haus gefunden. Er wohnt hier ganz alleine auf diesem Bauernhof, den er aus Altersgründen nicht mehr bewirtschaftet. Als wir uns von diesem freundlichen Mann verabschiedeten, gaben wir ihm drei christliche Bücher in Polnisch.

Vor dem Wohnhaus von Henryk Wozniak in Peterswalde. Von links nach rechts: Übersetzer Henryk Mach, Gunda Perteck, Henryk Wozniak, Werner und Marion Gitt (Mai 2005).
Den Dorfplatz, von dem damals die Verschleppung aller arbeitsfähigen Frauen durch die Russen ausging, gibt es nicht mehr, weil inzwischen Häuser darauf errichtet wurden. Hingegen existierte jener Weg, auf dem damals der Abmarsch begann, auch heute noch, denn er führt in das nächste Dorf. Dieser Weg lädt heute manch einen zu einem Maispaziergang ein, denn die frisch belaubten Bäume am Wegesrand spenden Schatten, und die angrenzenden Raps- und Getreidefelder verbreiten einen angenehmen Frühlingsduft. Wie ganz anders wirkte das auf mich – ich empfand das alles als äußerst beklemmend. Von hier aus begann im Februar 1945 in Schnee und Eiseskälte die Leidenszeit meiner Mutter. Es war für sie der Anfang der Straße des Todes. Von den heutigen polnischen Dorfbewohnern, die erst später das Dorf in Besitz nahmen, war niemand Augenzeuge davon, was damals geschah und was aus meiner Erinnerung nie ausgelöscht werden wird.
Am Abend desselben Tages hatten wir eine Veranstaltung im Osteroder Schloss. Am Ende fand ein Mann zu Christus, der in jungen Jahren auch mit viel Leid konfrontiert worden war. Er berichtete von vier verschiedenen von den Nazis errichteten Arbeitslagern, in denen er während des Krieges hart arbeiten musste. Er zeigte mir eine tiefe Narbe am Bein, die aus jener Zeit stammte. Merkwürdig: Gerade einen Deutschen benutzte Gott, um ihn zu Christus zu führen.
Am nächsten Morgen hatten wir ein Rundfunkinterview bei dem Osteroder Regionalsender »Radio Mazurky«. Der Reporter sagte zu meinem Übersetzer, dass er noch nie in so kurzer Zeit über die Herkunft des Lebens und über das Leben nach dem Tod gehört habe. Danach wollte ich noch einmal den Bahnhof Osterode sehen, jenen Bahnhof, von dem aus wir im Oktober 1945 in den Westen abgeschoben wurden. Von hier aus starteten wir unsere Odyssee in eine völlig ungewisse Zukunft. Nun stand ich erstmals nach 60 Jahren wieder an dieser schicksalhaften Stelle, wo damals niemand mehr eine Hoffnung hatte. Jetzt empfand ich die Rückkehr an diesen Ort als einen Kreis, der sich hier zu schließen schien. Die 60 Jahre dazwischen liefen mir wie ein Film im Zeitraffer ab. Was war doch inzwischen alles geschehen: Schulausbildung, Studium, Familiengründung, Beruf und der Glaube an Jesus Christus. Gott hatte einen neuen Weg für mich und mir außerdem ewige Hoffnung geschenkt. Wie merkwürdig das alles gefügt ist. Jetzt war ich eingeladen, gerade nach Osterode zu kommen. Es galt, den Menschen, die jetzt hier leben und die auch von Gott geliebt sind, die gute Botschaft des Evangeliums zu bringen. Wer versteht die Wege Gottes? Wie groß ist doch unser Gott!
2.2 Der »schwerhörige« Professor aus Moskau
Im Mai 199119 unternahmen wir unsere erste missionarische Reise in die frühere Sowjetunion, und zwar in die Metropole Moskau. Wegen der damals noch schwierigen Einreisebedingungen brauchten wir einen offiziellen Reisegrund. Nun war Phantasie gefragt. Es kam uns zugute, dass mein Übersetzer Dr. Harry Tröster sich für eine Gruppe von Querschnittsgelähmten in Moskau engagierte und versuchte, sie auf mancherlei Weise zu unterstützen. So hatte er 23 Rollstühle überlassen bekommen, die kostenlos in der Aeroflot-Maschine mitgenommen werden konnten. Im Gegenzug erhielten wir eine Einladung zur »Internationalen Autorallye für Querschnittsgelähmte«, die zu jener Zeit in Moskau stattfand. Außer meinem Übersetzer und mir bestand unsere Mannschaft aus zehn weiteren Personen, insbesondere jungen Leuten aus unserer Braunschweiger Gemeinde. Dietrich Müller, Karl Schumann und ich waren als Sportreferenten, die jungen Leute als Begleiter und Harry als Leiter der Mannschaft deklariert. Sieht man von jenen »Rallyefahrten « ab, bei denen uns einige Querschnittsgelähmte durch Moskau zu unseren evangelistischen Einsatzorten brachten, dann haben wir von der offiziellen Rallye nichts gesehen.

Von links nach rechts: Prof. Anatoli Rogow, Dr. Harry Tröster, Schirinai Dossowa und Werner Gitt, August 2004.
Wir blieben etwa zehn Tage in Moskau und waren von der unerwarteten Offenheit für das Evangelium völlig überrascht. Meine zu verschiedenen Themen ausgearbeiteten Manuskripte, die ich vorgesehen hatte, waren hier völlig fehl am Platz. Sie hätten weder Kopf noch Herz der Zuhörer erreicht, denn es waren überwiegend Leute, die aufgrund ihrer atheistischen Erziehung noch nie etwas vom Evangelium gehört hatten. Noch nie habe ich das Gleichnis vom großen Abendmahl (Lukas 14,16-24) so sehr geschätzt wie in jenen Tagen. Diesen Text empfand ich als geradezu maßgeschneidert für unsere Situation. Menschen, die hochoffiziell von Gott selbst in den Himmel eingeladen waren, lehnten sein Angebot ab. Wir waren in Krankenhäusern, Berufsschulen, Universitäten, in der Bibliothek eines großen Autoherstellers, und wir sprachen vor Rollstuhlfahrern und in Hausversammlungen. Welch ein kostbar aufbereitetes Evangelium hatten wir doch in Form dieses Gleichnisses. »Wir sind zu euch gekommen, weil Gott noch Plätze im Himmel frei hat«, so sagte ich es den Zuhörern immer wieder. »Kommt, nehmt Jesus an, den Sohn Gottes, und ihr seid einmal beim großen Fest im Himmel dabei.« Das verstanden die Leute, und nach dem Aufruf zur Entscheidung gingen überall viele Hände hoch. Da wir viele Bibeln und evangelistische Bücher zur Verfügung hatten, bekam jeder eine Ration an geistlicher Verpflegung mit auf den Weg. Am Ende eines jeden Tages waren wir von all den Einsätzen müde und erschöpft, aber die Freude war groß über das, was Gott an den Menschen gewirkt hatte.
Wir wurden ständig von Anatoli Rogow, einem Universitätsprofessor, den Harry noch aus seiner Studienzeit kannte, begleitet. In Moskau hörte er in jenen Tagen mehrmals täglich das Evangelium, und bei den vielen Fahrten quer durch Moskau hatten wir sehr angeregte Gespräche mit ihm. Einmal sagte er mir, dass zwei Deutsche ihn beeindruckt haben, nämlich Hegel und Gitt. Immer hofften wir, dass er bei einem der Einsätze auch einmal die Hand heben würde, um Jesus in sein Herz zu lassen, doch leider vergeblich. Vorbilder hatte er ja inzwischen sehr viele. Aber er blieb eisern, ja er verhielt sich gegenüber der Botschaft geradezu immun. Das Evangelium beschäftigte ihn zwar irgendwie, aber es schien ihn letztlich doch nicht zu erreichen. So nahte unser Abreisetag, und bei ihm blieb alles beim Alten.
Blieb wirklich alles beim Alten? Schon wenige Wochen nach unserer Rückkehr hatte er dienstlich in Stuttgart zu tun. So traf er sich auch mit Harry. Kurz entschlossen lud dieser ihn ins Auto, und sie besuchten uns an einem Wochenende in Braunschweig. Abends luden wir einige junge Leute von der Moskau-Reise zu uns nach Hause ein, um das Wiedersehen ein wenig zu feiern. Es war eine nette Begegnung. Am anderen Morgen besuchten wir den Gottesdienst in unserer Gemeinde. Da Prof. Rogow kein Deutsch verstand, reduzierte sich für ihn alles auf das Erleben der Gemeinschaft. Während des Mittagessens sprachen wir über Zachäus. Gespannt hörte er jetzt zu und achtete konzentriert auf das, was Harry übersetzte. Er legte Messer und Gabel beiseite, um kein Wort zu verpassen. In diesem Augenblick spürte ich: Jetzt rührt Gott sein Herz an. So fragte ich ihn direkt, ob er sich bekehren wolle. Es kam die klare Antwort: JA! Nach dem inzwischen fast erkalteten Essen konnten wir ihm den Weg zu Jesus erklären und zusammen beten. Was in Moskau nicht möglich war, begriff er in unserem Wohnzimmer. Erst jetzt fiel die rettende Botschaft in sein Herz. Nun war das Evangelium für ihn reif geworden. Es bleibt für uns ein unergründliches Geheimnis, wann und wo der Herr Jesus ein Herz öffnet.
Bei unserer nächsten Moskau-Reise im Mai 1993, also zwei Jahre später, trafen wir ihn wieder. Er lud uns zu einem Jugendabend in seiner Gemeinde ein und bat uns darum, auf Fragen, die die jungen Leute beschäftigten, einzugehen. Er sagte, dass er nun seine Aufgabe gefunden habe: »Die Jugend Russlands muss für Christus gewonnen werden, denn sie ist die Zukunft des Landes.«
2.3 Nach fünfzig Jahren wieder in Ostpreußen
Fünfzig Jahre nach der Flucht und Vertreibung waren wir zum ersten Mal wieder in Ostpreußen20, und zwar im nördlichen Teil, in dem auch mein Geburtsort Raineck lag. Zehn Tage hielten wir uns dort auf, um Vorträge zu halten. Gebangt hatten wir uns vor der Abreise gefragt, wie man wohl aufgenommen werden würde in einer Gegend, die so viele Jahre militärisches Sperrgebiet war und in die niemand aus dem Westen einreisen durfte. Doch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hatte sich auch diese Tür geöffnet.
In den zehn Tagen erlebten wir beides: Negatives und Großartiges. Die Auswirkungen von fast fünfzig Jahren Kommunismus sind verheerend. Die Städte und Dörfer in einem einstmals schönen Land sind völlig zerstört. Den Menschen erging es nicht besser; sie lebten weitgehend ohne Hoffnung und Ziel. Karl Marx hatte einmal gesagt: »Die Praxis ist das Kriterium der Wahrheit.« Zumindest mit diesem Satz hat er Recht. Wer Anschauungsunterricht über die praktischen Auswirkungen des Kommunismus sucht, der findet dort genug Beispiele. Wie würden diese Menschen, die jetzt hier wohnen, auf das Evangelium reagieren? Unser erstes Ziel war Palmnicken.
1. Palmnicken: Palmnicken ist ein ehemals wunderschöner Kurort an der Samland-Küste der Ostsee, weltbekannt durch seine reichen Bernsteinvorkommen. Auf Russisch heißt Bernstein »jantar«, und davon ist auch der heutige Ortsname abgeleitet. 94 % der Weltbernsteinproduktion kommt von hier. Wir kamen am Samstag gegen Mittag an. Ursprünglich hieß es, wir seien zu einer Bibelstunde eingeladen, und ich hatte mir einen kleinen Hauskreis vorgestellt. Wer nach Russland reist, um zu evangelisieren, muss wissen, dass er immer wieder mit Desorganisation konfrontiert wird. So erging es uns auch in Jantarny. Als wir dort ankamen, hatte es den Anschein, als ob uns niemand erwartete. Es war ein schöner sonniger Tag, und wir vertrieben uns die Zeit auf dem Rasenplatz vor dem Kino. Zunächst geschah nichts, bis nach und nach einige Leute aus dem Dorf auftauchten: erst vereinzelte, dann mehrere, schließlich waren es etwa fünfzig. Sie gingen alle zielstrebig in den Kinosaal. Ob da wohl gleich ein Film lief? Neugierig gingen wir hinein. Kurz danach wurde uns klar, dass wir uns in unserer eigenen Veranstaltung befanden. Einen Verantwortlichen konnten wir immer noch nicht ausmachen, aber die Leute schienen etwas Besonderes zu erwarten. Es war ein bunt zusammengewürfeltes Völkchen. Die meisten von ihnen schienen uns ungläubig zu sein. Nach Absprache mit Harry erkannten wir: Das Gebot der Stunde heißt Evangelisation. Es war also nicht eine Bibelstunde für Gläubige, wie wir ursprünglich angenommen hatten. Wer nach Russland geht, muss oft blitzschnell reagieren, umdisponieren, Gedanken umschalten, Planungen umwerfen. Kurz entschlossen trugen wir eine verständliche evangelistische Botschaft vor. Das Erstaunliche: Von den fünfzig Leuten bekehrten sich am Ende zwanzig zu Jesus. Das war für uns ein großes Wunder.

Der Königsberger Dom, 1998.
2. Palast der Eisenbahner: Das eigentliche Ziel unserer Reise war jedoch die Evangelisationswoche in der Stadt Königsberg (russ. Kaliningrad). Die einstige ostpreußische Metropole und auch die anderen Orte sind geradezu vollständig russifiziert. Es ist kaum noch eine deutsche Spur zu finden, und wo es an Gebäuden aus deutscher Zeit Inschriften gab, hat man diese beseitigt. Hier also sollten die Veranstaltungen stattfinden. Wir waren schon sehr darauf gespannt.
Der Palast der Eisenbahner, ein Gewerkschaftshaus in der Nähe des früheren Südbahnhofs, war der Vortragsplatz. Als wir am ersten Abend erst kurz vor Beginn am Veranstaltungsort ankamen, enttäuschte uns der fast leere große Parkplatz. Ob niemand kommen würde? Würden wir in einem Saal zu leeren Stühlen predigen? Doch dann waren wir überrascht über die große Menschenmenge, die drinnen schon Platz genommen hatte. Fast alle waren mit öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen oder hatten einen langen Fußmarsch hinter sich. Nach der Predigt luden wir all jene ein, auf die Bühne zu kommen, die sich an diesem Abend für Jesus Christus entscheiden wollten. Jeden Abend war es eine stattliche Gruppe, die sich da einfand, so dass Harry und ich uns auf eine Bank stellen mussten, um von allen gut gesehen und verstanden zu werden.