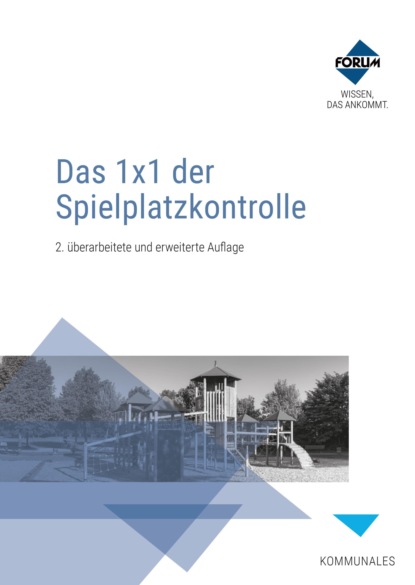- -
- 100%
- +
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
Vereinfacht und auf Spielplätze bezogen: Wer Spielplätze betreibt, ohne die Sicherheit der Spielplatzgeräte, Spielplatzböden und Ausstattungen in angemessenen Fristen zu kontrollieren und bei Bedarf instand zu setzen, haftet, wenn sich aufgrund seines mangelnden Sicherheitsmanagements Unfälle ereignen. Im Umkehrschluss wird aber auch deutlich, dass ein Betreiber mit einem angemessenen Sicherheitsmanagement für Unfälle, die sich im Rahmen des sportlich-spielerischen Risikos ereignen, nicht haftbar gemacht werden kann.[4]
Maßstab für die Sicherheit der Spielplatzgeräte sind die sicherheitstechnischen Anforderungen der Normenreihe DIN EN 1176. Für Ausstattungen und sonstige Einrichtungen auf dem Spielplatz gelten diese Normen jedoch nicht. Hier sind die allgemeinen Grundsätze der Verkehrssicherungspflicht zu beachten. Dabei sollte sich der Betreiber daran orientieren, was vernünftigerweise vorhersehbar ist bzw. bereits bekannte Unfälle beachten. Bei der Erarbeitung dieser Schrift wurde z. B. beachtet, dass sich in Sachsen ein tödlicher Unfall durch Erdrosseln an einer Einfriedung ereignet hat. Für Einfriedungen wurde deshalb eine Veröffentlichung[5] der Unfallkasse Sachsen in Bezug genommen.
Weitere sicherheitstechnische Anforderungen, die in den Normen nicht eindeutig geregelt sind, können aus den EK-2-Beschlüssen AK 2-5[6] resultieren. Diese wurden hier ebenfalls berücksichtigt.
Zur Beurteilung von Giftpflanzen und anderer für die Gesundheit der Benutzer bedenklichen Pflanzen wurden folgende Quellen berücksichtigt:
• DIN 18034, obwohl diese nicht bauaufsichtlich eingeführt ist • die Liste giftiger Pflanzenarten[7] • das Urteil des Amtsgerichtes Grimma[8] zu Liguster im Aufenthaltsbereich von Kleinkindern (siehe hierzu auch Kapitel
Zur Beurteilung von Altreifen auf Spielplätzen wurde auf die „Stellungnahme des BgVV zur Nutzung von Autoreifen und -schläuchen als Spielgeräte in Kindergärten“[9] zurückgegriffen (siehe hierzu auch Kapitel

Welche Maßnahmen der Betreiber im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht treffen muss, wird im Kapitel

Zum Bestandsschutz
Wenn ein Eigentümer einen Spielplatz zum Zeitpunkt des Errichtens nach den damals geltenden Vorschriften errichtet hat, darf er diesen grundsätzlich auch bei Erscheinen neuer Vorschriften zeitlich unbefristet weiterbetreiben, solange sich das Objekt sicherheitstechnisch noch im Ursprungszustand befindet.[10] Solange dieser Ursprungszustand durch Instandsetzung wiederhergestellt wird, besteht weiterhin Bestandsschutz.
In § 3 Abs. 2 des Produkthaftungsgesetzes heißt es dazu:
Ein Produkt hat nicht allein deshalb einen Fehler, weil später ein verbessertes Produkt in den Verkehr gebracht wurde.
Im Umkehrschluss ergibt sich daraus: Wenn ein Spielplatzgerät zum Zeitpunkt der Installation nicht den geltenden Bestimmungen entsprach, gilt kein Bestandsschutz. Der Bestandsschutz gilt auch dann nicht, wenn der Fehler über einen längeren Zeitraum nicht erkannt wurde. (Unwissenheit schützt vor Strafe nicht!)
Wenn ein Spielplatzgerät vor Erscheinen von DIN 7926 errichtet wurde und gegen wesentliche sicherheitstechnische Anforderungen dieser Norm verstößt, gilt kein Bestandsschutz.[11] Hingegen stehen nach DIN 7926 gefertigte Spielplatzgeräte auch nach Erscheinen von DIN EN 1176 unter Bestandsschutz.
Der Bestandsschutz erlischt, wenn an einem Spielplatzgerät wesentliche Änderungen durchgeführt werden.
Beispiel:
Bei einem nach DIN 7926 hergestellten Gerät dürfen die Sprossenabstände von Leitern nicht zwischen 12 cm und 20 cm liegen. Nach DIN EN 1176-1 müssen die Sprossenabstände kleiner als 8,9 cm oder größer als 23 cm sein. Ein Altgerät nach DIN 7926 steht unter Bestandsschutz, auch wenn defekte Sprossen ausgetauscht werden. Wird jedoch die komplette Leiter ersetzt, gilt das als wesentliche Änderung, und die neue Leiter muss die Anforderungen nach DIN EN 1176 erfüllen. Die Anwendung der neuen Norm verursacht auch keine unzumutbaren Mehrkosten.
Fußnoten:
[1]
Übereinkommen über die Rechte des Kindes, UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK).
[2]
§ 3 Abs.2 ProdSG.
[3]
Vgl. Abschnitt 5 DIN EN 1176-1.
[4]
Urteil des OLG Stuttgart v. 29.10.1984, 5 ZU 59/84.
[5]
Fischer, Rundum sicher, Einfriedungen in Kindertageseinrichtungen, in ipunkt 1/2011, Unfallkasse Sachsen.
[6]
www.zlsmuenchen.de/erfahrungsaustausch/ek_ak/dokumente_ek2/EK2_AK2.5_Beschluesse_2018_09_V2 %20(3).pdf.
[7]
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Bekanntmachung einer Liste giftiger Pflanzenarten vom 17.04.2000, Bundesanzeiger Nr. 86, S. 8517 vom 06.05.2000.
[8]
Amtsgericht Grimma, Vergiftung durch Liguster in einer Kindergrippe, Urteil vom 28.10.1996, Az. 2 C 0108/96.
[9]
Vgl. www.mobil.bfr.bund.de/cm/343/autoreifen.pdf.
[10]
Aus Art. 14 Abs. 1 GG abgeleiteter Grundsatz.
[11]
Agde u. a., Spielgeräte – Sicherheit auf Europas Spielplätzen, Erläuterungen in Bildern zu DIN EN 1176, S. 4 f., 3. Auflage, Beuth Verlag Berlin, Wien, Zürich, 2007.

{Normen}

{Bedeutung}
Normen sind in der deutschen Rechtschreibung definiert als Richtschnur, Regel, Vorbild.[1] Es gibt sie nicht nur in der Technik, sondern auch als Vorgaben für die Arbeit, als Rechtsvorschrift oder im menschlichen Zusammenleben.
An dieser Stelle geht es um technische Normen. Diese beschreiben Eigenschaften von Produkten, Dienstleistungen und Verfahren. Herausgeber der technischen Normen ist in Deutschland das Deutsche Institut für Normung e. V. (DIN). Der Vorteil einer Norm wird bereits im Alltag spürbar: Wenn Sie eine bestimmte Schraube benötigen, müssen Sie diese nicht genau in allen Einzelheiten wie Bauform, Art und Steigung des Gewindes, Länge, Gestaltung des Schraubenkopfes, Werkstoff, Festigkeit usw. beschreiben – es genügt eine Angabe mit Bezug auf die geltende Norm. So gilt z. B. für Sechskantschrauben mit Flansch und Feingewinde der leichten Reihe die DIN EN 14219.
DIN-Normen gehören zu den privaten Regeln der Technik. Ihre Anwendung ist deshalb auch freiwillig. Wenn in Gesetzen und anderen Rechtsvorschriften auf sie Bezug genommen wird, erlangen sie eine höhere juristische Wertigkeit. So verweist in Deutschland z. B. der Gesetzgeber in den Verzeichnissen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) auf bestimmte Normen. Für Produkte, die den dort aufgeführten Normen entsprechen, kann vermutet werden, dass diese die Anforderungen des ProdSG erfüllen.
Für den grenzüberschreitenden Handel mit Produkten sind europäische Normen (EN) und internationale Normen (ISO) von besonderer Bedeutung. Auch die Normen für Spielplatzgeräte sind seit vielen Jahren europäische Normen und gewährleisten so den freien Warenverkehr für Spielplatzgeräte in den beteiligten Ländern Europas.
Damit Normen immer aktuell sind, werden sie i. d. R. alle fünf Jahre überarbeitet. In den nachfolgenden Abschnitten wird aufgezeigt, welche Entwicklung die Normung rund um den Spielplatz von den Anfängen in den 1970er-Jahren bis heute genommen hat. Aus der ehemals nationalen Norm DIN 7926 ist eine europäische Norm geworden, die inzwischen für die meisten Teile in der vierten Edition vorliegt.
Den Nutzen der Normung haben alle: Die Hersteller können europaweit einheitlich agieren. Für die Benutzer gilt in ganz Europa ein einheitliches Sicherheitsniveau.
Für die Spielplatzprüfung sind von besonderer Bedeutung (Kurztitel):
• die Normenreihe DIN EN 1176 Spielplatzgeräte und Spielplatzböden • DIN EN 1177 Stoßdämpfende Spielplatzböden • DIN 18034 Spielplätze und Freiräume zum Spielen • DIN 33942 Barrierefreie Spielplatzgeräte • die Normenreihe DIN 79161 Qualifizierung von Spiel- platzprüfernDarüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer Normen, mit denen Spielplatzprüfer im Einzelfall konfrontiert werden können, wie z. B. (Kurztitel):
• DIN 79400 Slacklinesysteme • DIN EN 16630 Standortgebundene Fitnessgeräte im Außenbereich • DIN EN 15312 Frei zugängliche Multisportgeräte • DIN EN 14974 Anlagen für Benutzer von Rollsport- geräten • die Normenreihe DIN EN 14960 Aufblasbare SpielgeräteDiese Normen sind nicht Bestandteil der Ausbildung von Spielplatzprüfern nach DIN 79161-1 und werden hier nicht erläutert. Die Aufzählung ist nicht abschließend.
Fußnoten:
[1]
Vgl. WAHRIG 2003.

{DIN-Normen, DIN EN 1176}
Die Normenreihe DIN EN 1176 löste 1998 die deutsche Norm DIN 7926 mit allen Teilen ab. Sie war zunächst in Verbindung mit DIN EN 1177[1] zu lesen, denn in dieser befand sich bis 2008 die Tabelle „Bodenarten in Abhängigkeit von den zulässigen freien Fallhöhen“.
In die neue europäische Norm sind wesentliche Teile der deutschen Norm eingeflossen. Insgesamt war die neue Normenreihe jedoch komplizierter und nicht frei von Widersprüchen. Mit einem Beiblatt wurde versucht, die Inhalte transparenter zu machen, was jedoch nicht vollständig gelang.
2003 und 2008 erfolgten Überarbeitungen.
Von der Änderung 2017-12 wurden noch nicht alle Teile erfasst. Die Regeln für Karussells bedurften eines zweiten Entwurfs. Noch länger dauerte es beim neuen Teil 7, der erst zum 01.06.2020 erschien.
Leider wird den Belangen des Spielplatzprüfers durch das DIN nicht ausreichend Rechnung getragen, denn ein Paket, in dem sich auch alle früheren Ausgaben befinden, ist nicht als Taschenbuch verfügbar. Nicht ganz unproblematisch war auch, dass das Beiblatt 1:2009 erst im Januar 2019 aktualisiert wurde.
Im Folgenden wird auf die wesentlichen Neuerungen in der aktuellen Ausgabe auszugsweise eingegangen – es geht lediglich um eine grobe Übersicht. Das setzt die Kenntnis der bisherigen Edition voraus. Weitere Angaben finden sich in den sicherheitstechnischen Anforderungen.
In Teil 1 „Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren“ wurden Sprunggeräte neu aufgenommen. Von großer Bedeutung sind die nationalen Abweichungen. Diese gibt es in Deutschland z. B. für stoßdämpfende Böden. Daran hat sich aber mit der neuen Norm nichts geändert. Erhebliche Auswirkungen dagegen hat der Verzicht auf die nationale Abweichung bezüglich Kindern unter drei Jahren/leichte Zugänglichkeit ab Ausgabe 2017-12. Dadurch müssen leicht zugängliche Geräte nun bereits ab einer freien Fallhöhe von 60 cm Brüstungen zur Absturzsicherung haben.
Der Betreiber bzw. Planer muss nun genau überlegen, welche Spielplatzgeräte er weiterhin für die Gruppe U3, also leicht zugänglich, anbieten will und welche nicht. Durch den Wegfall der ehemaligen nationalen Abweichung gelten jetzt die Anforderungen an die Absturzsicherung leicht zugänglicher Geräte in vollem Umfang wie für Europa.
Für die Anwendung nicht gerade förderlich ist die vollständige Neuübersetzung der Norm. Von einem guten „Deutsch“ ist keine Rede mehr. Darunter hat vor allem die Verständlichkeit sehr gelitten. Hier hätte man sich vom nationalen Normungsgremium etwas mehr „Mut“ gewünscht. So ist bspw. Anhang C neu mit „Physikalische Prüfung der konstruktiven Festigkeit“. überschrieben. Der bisherige Titel „Belastungsversuche zur konstruktiven Festigkeit“ war für jedermann verständlich.
Weitere wesentliche Änderungen finden sich zu Schaukeln. Hier wurde die bisherige Sicherheitsphilosophie des alten Beiblatts zur Bodenfreiheit von Nestschaukeln nahezu umgekehrt. Dagegen wurde die Prüfung von Seilbahnen durch Vereinheitlichung von Prüflasten wesentlich erleichtert. Bei Rutschen gibt es nun eine Längenbegrenzung gerader Rutschteile. Für Wippgeräte der Typen 1 bis 4 wurde der Fallraum bei stehender Benutzung auf 1,5 m vergrößert. Karussells müssen keine Mindestdurchmesser und auch keine Mindestbenutzerstellenzahl mehr haben. Neu aufgenommen wurden schüsselförmige Karussells.
Zu Raumnetzen gab es keine Änderungen.
Aktuell umfasst die Normenreihe folgende Teile:
• DIN EN 1176-1:2017-12 Spielplatzgeräte und Spielplatzböden – Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren • DIN EN 1176-2:2020-04 Spielplatzgeräte und Spielplatzböden – Teil 2: Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für Schaukeln • DIN EN 1176-3:2017-12 Spielplatzgeräte und Spielplatzböden – Teil 3: Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für Rutschen • DIN EN 1176-4:2019-05 Spielplatzgeräte und Spielplatzböden – Teil 4: Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für Seilbahnen • DIN EN 1176-5:2019-12 Spielplatzgeräte und Spielplatzböden – Teil 5: Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für Karussells • DIN EN 1176-6:2019-05 Spielplatzgeräte und Spielplatzböden – Teil 6: Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für Wippgeräte • DIN EN 1176-7:2020-06 Spielplatzgeräte und Spielplatzböden – Teil 7: Anleitung für Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb • DIN EN 1176-11:2014-11 Spielplatzgeräte und Spielplatzböden – Teil 11: Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für Raumnetze • DIN EN 1176 Beiblatt 1:2019-01 Spielplatzgeräte und Spielplatzböden – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren; Beiblatt 1: ErläuterungenFür Prüfer konventioneller Spielplätze ist DIN EN 1176-10 Spielplatzgeräte und Spielplatzböden – Teil 10: Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für vollständig umschlossene Spielgeräte kaum von Bedeutung. Aktuell ist Ausgabe 2008; es gibt einen Änderungsentwurf von 2020-06.
Fußnoten:
[1]
DIN EN 1177 Stoßdämpfende Spielplatzböden – Prüfverfahren zur Bestimmung der Stoßdämpfung.

{DIN-Normen, DIN EN 1177}
In den Ausgaben 1997 und 2002 der Normenreihe DIN EN 1176/1177 enthielt DIN EN 1177 noch die sicherheitstechnischen Anforderungen an Spielplatzböden, z. B. die Tabelle der üblicherweise auf Spielplätzen verwendeten stoßdämpfenden Bodenmaterialien mit Schichtdicken und kritischen Fallhöhen.
Ab Ausgabe 2008 änderte sich das: DIN EN 1176 enthielt nun den Titel „Spielplatzgeräte und Spielplatzböden“, und die sicherheitstechnischen Anforderungen an die Spielplatzböden wurden aus DIN EN 1177 heraus- und in DIN EN 1176-1 übernommen. In der aktuellen Ausgabe 2018-03 von DIN EN 1177 wurde vor allem ein weiteres Prüfverfahren zugelassen.
DIN EN 1177 beschränkt sich seit Ausgabe 2008 auf die Bestimmung der kritischen Fallhöhe von stoßdämpfenden Böden und ist eine reine Prüfnorm. Dazu wird auf den aus der Fahrzeugtechnik bekannten HIC-Wert (Head Injury Criterion) zurückgegriffen. Der Wert ist faktisch ein dimensionsloser Kopf-Verletzungsfaktor. Aus der Fahrzeugtechnik wurde als maximal zulässiger Wert HIC 1000 übernommen. Das ist nicht unstrittig.
Das Messverfahren mit Kunstkopf und integriertem Beschleunigungsaufnehmer kann zwar auch auf Spielplätzen angewandt werden, spielt aber bei den jährlichen Hauptinspektionen keine Rolle. Wenn die in DIN EN 1176-1 beschriebenen Bodenarten in Abhängigkeit von der freien Fallhöhe verwendet werden, darf vermutet werden, dass die Anforderungen an die Stoßdämpfung der Aufprallfläche erfüllt sind. Andere als diese Bodenarten bedürfen der HIC-Prüfung nach DIN EN 1177.
Das ist z. B. der Fall bei den sog. „Fallschutzplatten“. Diese werden für unterschiedliche Fallhöhen hergestellt. Bei der Verlegung sind alle Randbedingungen des Herstellers zu beachten, damit die erforderliche Stoßdämpfung auch tatsächlich erreicht wird. Entgegen der weit verbreiteten Auffassung von Spielplatzbetreibern bedürfen auch Fallschutzplatten einer regelmäßigen Wartung. Durch UV-Strahlung, Verschmutzung u. a. Faktoren altern sie und sind in der Lebensdauer begrenzt.

Bild 1: Vor Ort installierter synthetischer Fallschutzbelag muss auch vor Ort nach DIN EN 1177 geprüft werden. (Quelle: GAO – Gesundheits- und Arbeitsschutz Onischka UG [haftungsbeschränkt].)

Bild 2: Fallschutzplatten mit Wartungsbedarf. (Quelle: GAO – Gesundheits- und Arbeitsschutz Onischka UG [haftungsbeschränkt].)

Fußnoten:
[1]
Als kritische Fallhöhe gilt die größtmögliche freie Fallhöhe, für die eine Aufprallfläche ein ausreichendes Maß an Stoßdämpfung bietet.

{DIN-Normen, DIN 18034}
Die erste Ausgabe von DIN 18034 erschien im November 1971 unter dem Titel „Spielplätze für Wohnanlagen, Flächen und Ausstattungen für Spiele im Freien, Planungsgrundlagen“. Obwohl diese Norm nur sechs Seiten umfasste, enthielt sie alles, was für Spielplatzkonzeptionen gebraucht wurde:
• den Flächenbedarf pro Kind gestaffelt nach Altersbereichen • den Flächenbedarf von Spielplätzen • Anforderungen an die Lage des Spielplatzes, dessen maximale Entfernung von den Wohnungen und den Radius des Einzugsbereiches sowie • detaillierte Vorgaben für Spielarten und -bereicheDas Echo auf diese Norm war nicht ungeteilt. Einige Kommunen befürchteten Eingriffe in ihre Planungshoheit. Aus diesem Grund wurde ein Änderungsentwurf von 1982 auch nicht umgesetzt. Man fand eine pragmatische Lösung, nahm die strittigen Teile aus der Norm heraus und veröffentlichte sie am 03.06.1987 als Musterlass „Freiflächen zum Spielen“ der Arge Bau. Die „Restnorm“ erschien im Oktober 1988 unter dem Titel „Spielplätze und Freiflächen zum Spielen, Grundlagen und Hinweise für die Objektplanung“. Neben den Planungshinweisen gibt es sicherheitstechnische Anforderungen, z. B. an die maximale Wassertiefe, Einfriedungen, Zugänge, Giftpflanzen und an die Wartung.
Aus DIN 18034:1999-12 und 2012-09 resultierten keine wesentlichen Änderungen in den sicherheitstechnischen Anforderungen.
Seit Dezember 2019 gibt es einen neuen Entwurf, der voraussichtlich im 2. Halbjahr 2020 als DIN 18034-1 in Kraft gesetzt wird. Das angekündigte und im Entwurf veröffentlichte Beiblatt 1 wurde ersatzlos zurückgezogen. Als Teil 2 der Normenreihe soll nach Informationen aus dem DIN eine Matrix veröffentlicht werden, mit deren Hilfe bewertet werden kann, ob Spielplätze die Anforderungen an die Inklusion erfüllen. Der Inhalt wird nur informativ sein; ein Entwurf soll nicht veröffentlicht werden.

{DIN-Normen, DIN 33942}
Die erste Ausgabe dieser Norm trat am 01.09.1998 in Kraft. Ihr Ziel war, Anforderungen festzulegen, damit barrierefreie Spielplatzgeräte
• von allen Kindern, • weitestgehend ohne fremde Hilfe und • ohne ständige Aufsichtbenutzt werden können.
Die Anforderungen umfassten folgende Hauptpunkte:
• Bewegungsflächen in den Geräten • Bewegungsflächen außerhalb der Geräte • Orientierungshilfen • Möglichkeiten zur Hilfestellung und • gerätespezifische FestlegungenBasierend auf diesen Hauptpunkten erschienen überarbeitete Ausgaben der Norm im August 2002 und im April 2016.
Allen drei Ausgaben ist gemeinsam, dass die allgemeinen Aussagen zur Barrierefreiheit hilfreich sind. Bei den gerätespezifischen Festlegungen gibt es eine Reihe von Festlegungen, die in dieser Form nicht toleriert werden können und teilweise zu einer Schlechterstellung behinderter Kinder führen können. Aus diesem Grund wurde DIN 33942 aus dem Anhang 2 des Produktsicherheitsgesetzes gestrichen. Diese Norm gilt damit nicht als allgemein anerkannte Regel der Technik. Es darf nicht vermutet werden, dass nach dieser Norm gefertigte Spielplatzgeräte sicher sind.