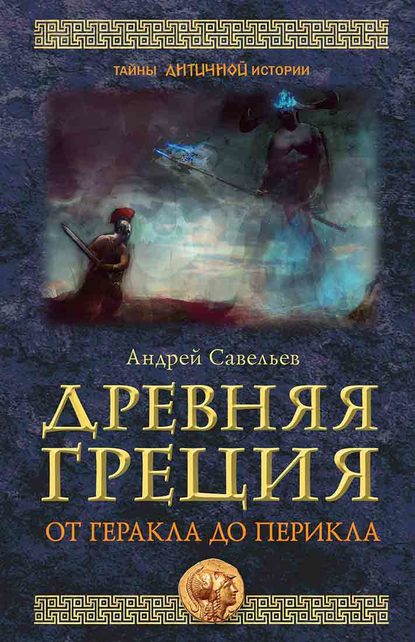Lebens-Ansichten des Katers Murr

- -
- 100%
- +
«Beste Mutter», fi el ich der Gefl eckten ins Wort, «beste Mutter, verdammen Sie nicht ganz jene Neigung. Das gebildetste Volk der Erde legte den sonderbaren Appetit des Kinderfressens dem Geschlecht der Götter bei, aber gerettet wurde ein Jupiter, und so auch ich!»-
«Ich verstehe dich nicht, mein Sohn», erwiderte Mina, «aber es kommt mir vor, als sprächest du albernes Zeug, oder als wolltest du gar deinen Vater verteidigen. Sei nicht undankbar, du wärest ganz gewiß erwürgt und gefressen worden von dem blutdürstigen Tyrannen, hätte ich dich nicht so tapfer verteidigt mit diesen scharfen Krallen, hätte ich nicht, bald hier, bald dort hinfl iehend in Keller, Boden, Ställe, dich den Verfolgungen des unnatürlichen Barbaren entzogen. – Er verließ mich endlich; nie habe ich ihn wiedergesehen! Und doch schlägt noch mein Herz für ihn! – Es war ein schöner Kater! – Viele hielten ihn seines Anstandes, seiner feiner Sitten wegen für einen reisenden Grafen. – Ich glaubte nun, im kleinen häuslichen Zirkel meine Mutterpfl ichten übend, ein stilles ruhiges Leben führen zu können, doch der entsetzlichste Schlag sollte mich noch treffen. – Als ich von einem kleinen Spaziergange einst heimkehrte, weg warst du samt deinem Geschwister! – Ein altes Weib hatte mich Tages zuvor in meinem Schlupfwinkel entdeckt und allerlei verfängliche Worte von ins Wasser werfen und dergleichen gesprochen! – Nun! ein Glück, daß du, mein Sohn, gerettet, komm nochmals an meine Brust, Geliebter!» -
Die gefl eckte Mama liebkoste mich mit aller Herzlichkeit und fragte mich dann nach den nähern Umständen meines Lebens. Ich erzählte ihr alles und vergaß nicht, meiner hohen Ausbildung zu erwähnen, und wie ich dazu gekommen.
Mina schien weniger gerührt von den seltenen Vorzügen des Sohnes, als man hätte denken sollen. Ja! sie gab mir nicht undeutlich zu verstehen, daß ich mitsamt meinem außerordentlichen Geiste, mit meiner tiefen Wissenschaft auf Abwege geraten, die mir verderblich werden könnten. Vorzüglich warnte sie mich aber, dem Meister Abraham ja nicht meine erworbenen Kenntnisse zu entdecken, da dieser sie nur nützen würde, mich in der drückendsten Knechtschaft zu erhalten.
«Ich kann mich», sprach Mina, «zwar gar nicht deiner Ausbildung rühmen, indessen fehlt es mir doch durchaus nicht an natürlichen Fähigkeiten und angenehmen, mir von der Natur eingeimpften Talenten. Darunter rechne ich z.
B. die Macht, knisternde Funken aus meinen Pelz hervorstrahlen zu lassen, wenn man mich streichelt. Und was für Unannehmlichkeiten hat mir nicht schon dieses einzige Talent bereitet! Kinder und Erwachsene haben unaufhörlich auf meinem Rücken herumhantiert jenes Feuerwerks halber, mir zur Qual, und wenn ich unmutig wegsprang oder die Krallen zeigte, mußte ich mich ein scheues wildes Tier schelten, ja wohl gar prügeln lassen. – Sowie Meister Abraham erfährt, daß du schreiben kannst, lieber Murr, macht er dich zu seinem Kopisten, und als Schuldigkeit wird von dir gefordert, was du jetzt nur aus eigenem Antriebe zu deiner Lust tust.» -
Mina sprach noch mehreres über mein Verhältnis zum Meister Abraham und über meine Bildung. Erst später habe ich eingesehen, daß das, was ich für Abscheu gegen die Wissenschaften hielt, wirkliche Lebensweisheit war, die die Gefl eckte in sich trug.
Ich erfuhr, daß Mina bei der alten Nachbarsfrau in ziemlich dürftigen Umständen lebe, und daß es ihr oft schwer falle, ihren Hunger zu stillen. Dies rührte mich tief, die kindliche Liebe erwachte in voller Stärke in meinem Busen, ich besann mich auf den schönen Heringskopf, den ich vom gestrigen Mahle erübrigt, ich beschloß, ihn darzubringen der guten Mutter, die ich so unerwartet wiedergefunden.
Wer ermißt die Wandelbarkeit der Herzen derer, die da wandeln unter dem Mondschein! – Warum verschloß das Schicksal nicht unsere Brust dem wilden Spiel unseliger Leidenschaften! – Warum müssen wir, ein dünnes schwankendes Rohr, uns beugen vor dem Sturm des Lebens? – Feindliches Verhängnis! – O Appetit, dein Name ist Kater! – Den Heringskopf im Maule, kletterte ich, ein pius Aeneas, aufs Dach – ich wollte hinein ins Bodenfenster! – Da geriet ich in einen Zustand, der, auf seltsame Weise mein Ich meinem Ich entfremdend, doch mein eigentliches Ich schien. – Ich glaube mich verständlich und scharf ausgedrückt zu haben, so daß in dieser Schilderung meines seltsamen Zustandes jeder den die geistige Tiefe durchschauenden Psychologen erkennen wird. – Ich fahre fort! -
Das sonderbare Gefühl, gewebt aus Lust und Unlust, betäubte meine Sinne – überwältigte mich – kein Widerstand möglich, – ich fraß den Heringskopf! -
Ängstlich hörte ich Mina miauen, ängstlich sie meinen Namen rufen. – Ich fühlte mich von Reue, von Scham durchdrungen, ich sprang zurück in meines Meisters Zimmer, ich verkroch mich unter den Ofen. Da quälten mich die ängstlichsten Vorstellungen. Ich sah Mina, die wiedergefundene gefl eckte Mutter, trostlos, verlassen, lechzend nach der Speise, die ich versprochen, der Ohnmacht nahe – Ha! – der durch den Rauchfang sausende Wind rief den Namen Mina – Mina – Mina rauschte es in den Papieren meines Meisters, knarrte es in den gebrechlichen Rohrstühlen, Mina – Mina – lamentierte die Ofentüre – O! es war ein bitteres herzzerschneidendes Gefühl, das mich durchbohrte! – Ich beschloß, die Arme womöglich einzuladen zur Frühstücksmilch. Wie kühlender wohltuender Schatten kam bei diesem Gedanken ein seliger Frieden über mich! – Ich kniff die Ohren an und schlief ein! – Ihr fühlenden Seelen, die ihr mich ganz versteht, ihr werdet es, seid ihr sonst keine Esel, sondern wahrhaftige honette Kater, ihr werdet es, sage ich, einsehen, daß dieser Sturm in meiner Brust meinen Jugendhimmel aufheitern mußte, wie ein wohltätiger Orkan, der die fi nstern Wolken zerstäubt und die reinste Aussicht schafft. O! so schwer anfangs der Heringskopf auf meiner Seele lastete, doch lernte ich einsehen, was Appetit heißt, und daß es Frevel ist, der Mutter Natur zu widerstreben. Jeder suche sich seine Heringsköpfe und greife nicht vor der Sagacität der andern, die, vom richtigen Appetit geleitet, schon die ihrigen fi nden werden.
So schließe ich diese Episode meines Lebens, die -
(Mak. Bl.) – nichts verdrießlicher für einen Historiographen oder Biographen, als wenn er, wie auf einen wilden Füllen reitend, hin und her sprengen muß über Stock und Stein, über Äcker und Wiesen, immer nach gebahnten Wegen trachtend, niemals sie erreichend. So geht es dem, der es unternommen, für dich, geliebter Leser, das aufzuschreiben, was er von dem wunderlichen Leben des Kapellmeisters Johannes Kreisler erfahren. Gern hätte er angefangen: In dem kleinen Städtchen N. oder B. oder K., und zwar am Pfi ngstmontage oder zu Ostern des und des Jahres, erblickte Johannes Kreisler das Licht der Welt! – Aber solche schöne chronologische Ordnung kann gar nicht aufkommen, da dem unglücklichen Erzähler nur mündlich, brockenweis mitgeteilte Nachrichten zu Gebote stehen, die er, um nicht das Ganze aus dem Gedächtnisse zu verlieren, sogleich verarbeiten muß. Wie es eigentlich mit der Mitteilung dieser Nachrichten herging, sollst du, sehr lieber Leser, noch vor dem Schlusse des Buchs erfahren, und dann wirst du vielleicht das rhapsodische Wesen des Ganzen entschuldigen, vielleicht aber auch meinen, daß trotz des Anscheins der Abgerissenheit doch ein fester durchlaufender Faden alle Teile zusammenhalte.
Eben in diesem Augenblick ist nichts anders zu erzählen, als daß nicht lange nachher, als Fürst Irenäus in Sieghartsweiler sich niedergelassen, an einem schönen Sommerabend Prinzessin Hedwiga und Julia in dem anmutigen Park zu Sieghartshof lustwandelten. Wie ein goldner Schleier lag der Schein der sinkenden Sonne ausgebreitet über dem Walde. Kein Blättlein rührte sich. In ahnungsvollem Schweigen harrten Baum und Gebüsch, daß der Abendwind komme und mit ihnen kose. Nur das Getöse des Waldbachs, der über weiße Kiesel fortbrauste, unterbrach die tiefe Stille. Arm in Arm verschlungen, schweigend wandelten die Mädchen fort durch die schmalen Blumengänge, über die Brücken, die über die verschiedenen Schlingungen des Bachs führten, bis sie an das Ende des Parks, an den großen See kamen, in dem sich der ferne Geierstein mit seinen malerischen Ruinen abspiegelte.
«Es ist doch schön!» rief Julia recht aus voller Seele. «Laß uns», sprach Hedwiga, «in die Fischerhütte treten. Die Abendsonne brennt entsetzlich, und drin ist die Aussicht nach dem Geierstein aus dem mittlern Fenster noch schöner als hier, da die Gegend dort nicht Panorama, sondern in gruppierter Ansicht, wahrhaftes Bild erscheint.»
Julia folgte der Prinzessin, die, kaum hineingetreten und zum Fenster hinausschauend, sich nach Crayon und Papier sehnte, um die Aussicht in der Beleuchtung zu zeichnen, welche sie ungemein pikant nannte.
«Ich möchte», sprach Julia, «ich möchte dich beinahe um deine Kunstfertigkeit beneiden, Bäume und Gebüsche, Berge, Seen so ganz nach der Natur zeichnen zu können. Aber ich weiß es schon, könnte ich auch so hübsch zeichnen als du, doch wird es mir niemals gelingen, eine Landschaft nach der Natur aufzunehmen, und zwar um desto weniger, je herrlicher der Anblick. Vor lauter Freude und Entzücken des Schauens würd’ ich gar nicht zur Arbeit kommen.» – Der Prinzessin Antlitz überfl og bei diesen Worten Julias ein gewisses Lächeln, das bei einem sechzehnjährigen Mädchen bedenklich genannt werden dürfte. Meister Abraham, der im Ausdruck zuweilen etwas seltsam, meinte, solch Muskelspiel im Gesicht sei dem Wirbel zu vergleichen auf der Oberfl äche des Wassers, wenn sich in der Tiefe etwas Bedrohliches rührt. – Genug, Prinzessin Hedwiga lächelte; indem sie aber die Rosenlippen öffnete, um der sanften unkünstlerischen Julia etwas zu entgegnen, ließen sich ganz in der Nähe Akkorde hören, die so stark und wild angeschlagen wurden, daß das Instrument kaum eine gewöhnliche Guitarre zu sein schien.
Die Prinzessin verstummte, und beide, sie und Julia, eilten vor das Fischerhaus. Nun vernahmen sie eine Weise nach der andern, verbunden durch die seltsamsten Übergänge, durch die fremdartigste Akkordenfolge. Dazwischen ließ sich eine sonore männliche Stimme hören, die bald alle Süßigkeit des italienischen Gesanges erschöpfte, bald, plötzlich abbrechend, in ernste düstere Melodien fi el, bald rezitativisch, bald mit starken, kräftig akzentuierten Worten dreinsprach. -
Die Gitarre wurde gestimmt – dann wieder Akkorde – dann wieder abgebrochen und gestimmt – dann heftige, wie im Zorn ausgesprochene Worte – dann Melodien – dann aufs neue gestimmt. -
Neugierig auf den seltsamen Virtuosen, schlichen Hedwiga und Julia näher und näher heran, bis sie einen Mann in schwarzer Kleidung gewahrten, der, den Rücken ihnen zugewendet, auf einem Felsstück dicht an dem See saß und das wunderliche Spiel trieb mit Singen und Sprechen.
Eben hatte er die Gitarre ganz und gar umgestimmt auf ungewöhnliche Weise und versuchte nun einige Akkorde, dazwischen rufend: «Wieder verfehlt – keine Reinheit – bald ein Komma zu tief, bald ein Komma zu hoch!» -
Dann faßte er das Instrument, das er von dem blauen Bande, an dem es ihm um die Schultern hing, losgenestelt, mit beiden Händen, hielt es vor sich hin und begann: «Sage mir, du kleines eigensinniges Ding, wo ruht eigentlich dein Wohllaut, in welchem Winkel deines Innersten hat sich die reine Skala verkrochen? – Oder willst du dich vielleicht aufl ehnen gegen deinen Meister und behaupten, sein Ohr sei totgehämmert worden in der Schmiede der gleichschwebenden Temperatur und seine Enharmonik nur ein kindisches Vexierspiel? Du verhöhnst mich, glaub’ ich, unerachtet ich den Bart viel besser geschoren trage als Meister Stefano Pacini, detto il Venetiano, der die Gabe des Wohllauts in dein Innerstes legte, die mir ein unerschließbares Geheimnis bleibt. Und, liebes Ding, daß du es nur weißt, willst du den unisonierenden Dualismus von Gis und As oder Cis und Des – oder vielmehr sämtlicher Töne durchaus nicht verstatten, so schicke ich dir neun tüchtige teutsche Meister auf den Hals, die sollen dich ausschelten, dich kirre machen mit enharmonischen Worten. – Und du magst dich nicht deinem Stefano Pacini in die Arme werfen, du magst nicht wie ein keifendes Weib das letzte Wort behalten wollen. – Oder bist du vielleicht gar dreist und stolz genug, zu meinen, daß alle schmucke Geister, die in dir wohnen, nur dem gewaltigen Zauber folgen der Magier, die längst von der Erde gegangen; und daß in den Händen eines Hasenfußes – »
Bei dem letzten Worte hielt der Mann plötzlich inne sprang auf und schaute wie in tiefen Gedanken versunken, in den See hinein. – Die Mädchen, gespannt durch des Mannes seltsames Beginnen, standen wie eingewurzelt hinter dem Gebüsch; sie wagten kaum zu atmen.
«Die Guitarre», brach der Mann endlich los, «ist doch das miserabelste, unvollkommenste Instrument von allen Instrumenten, nur wert, von girrenden liebeskrankenden Schäfern in die Hand genommen zu werden, die das Embouchoir zur Schalmei verloren haben, da sie sonst es vorziehen würden, erklecklich zu blasen, das Echo zu wecken mit den Kuhreigen der süßesten Sehnsucht und klägliche Melodien entgegenzusenden den Emmelinen in den weiten Bergen, die das liebe Vieh zusammentreiben mit dem lustigen Geknalle empfi ndsamer Hetzpeitschen! – O Gott! – Schäfer, die, “wie ein Ofen seufzen mit Jammerlied auf ihrer Liebsten Brau’n” – lehrt ihnen, daß der Dreiklang aus nichts anderm bestehe als aus drei Klängen und niedergestoßen werde durch den Dolchstich der Septime, und gebt ihnen die Gitarre in die Hände! – Aber ernsten Männern von leidlicher Bildung, von vorzüglicher Erudition, die sich abgegeben mit griechischer Weltweisheit und wohl wissen, wie es am Hofe zu Peking oder Nanking zugeht, aber den Teufel was verstehen von Schäferei und Schafzucht, was soll denen das Ächzen und Klimpern? – Hasenfuß, was beginnst du? Denke an den seligen Hippel, welcher versichert, daß, säh’ er einen Mann Unterricht erteilen im Klavierschlagen, es ihm zumute werde, als sötte besagter Lehrherr weiche Eier – und nun Guitarre klimpern – Hasenfuß! – Pfui Teufel!»– Damit schleuderte der Mann das Instrument weit von sich ins Gebüsch und entfernte sich raschen Schrittes, ohne die Mädchen zu bemerken.
«Nun», rief Julia nach einer Weile, lachend, «nun, Hedwiga, was sagst du zu dieser verwunderlichen Erscheinung? Wo mag der seltsame Mann her sein, der erst so hübsch mit seinem Instrument zu sprechen weiß und es dann verächtlich von sich wirft wie eine zerbrochene Schachtel?»
«Es ist unrecht», sprach Hedwiga, wie im plötzlich aufwallenden Zorn, indem ihre verbleichten Wangen sich blutrot färbten, «es ist unrecht, daß der Park nicht verschlossen ist, daß jeder Fremde hinein kann.»
«Wie», erwiderte Julia, «der Fürst sollte, meinst du, engherzig den Sieghartsweilern – nein, nicht diesen allein, jedem, der des Weges wandelt, gerade den anmutigsten Fleck der ganzen Gegend verschließen! das ist unmöglich deine ernste Meinung!» – «Du bedenkst», fuhr die Prinzessin noch bewegter fort, «du bedenkst die Gefahr nicht, die für uns daraus entsteht. Wie oft wandeln wir so wie heute allein, entfernt von aller Dienerschaft, in den entlegensten Gängen des Waldes umher! – Wie wenn einmal irgendein Bösewicht – »
«Ei», unterbrach Julia die Prinzessin, «ich glaube gar, du fürchtest aus diesem, jenem Gebüsch könnte irgendein ungeschlachter märchenhafter Riese oder ein fabelhafter Raubritter hervorspringen und uns entführen auf seine Burg! – Nun, das wollte der Himmel verhüten! –
Aber sonst muß ich dir gestehen, daß mir irgendein kleines Abenteuer hier in dem einsamen romantischen Walde recht hübsch, recht anmutig bedünken möchte. Ich denke eben an Shakespeares «Wie es euch gefällt», das uns die Mutter so lange nicht in die Hände geben wollte, und das uns endlich Lothario vorgelesen. Was gilt es, du würdest auch gern ein bißchen Celia spielen, und ich wollte deine treue Rosalinde sein. – Was machen wir aus unserm unbekannten Virtuosen?»
«O», erwiderte die Prinzessin, «eben dieser unbekannte Mensch – glaubst du wohl Julia, daß mir seine Gestalt, seine wunderlichen Reden ein inneres Grauen erregten, das mir unerklärlich ist? – Noch jetzt durchbeben mich Schauer, ich erliege beinahe einem Gefühl, das, seltsam und entsetzlich zugleich, alle meine Sinne gefangen nimmt. In dem tiefsten dunkelsten Gemüt regt sich eine Erinnerung auf und ringt vergebens, sich deutlich zu gestalten. – Ich sah diesen Menschen schon in irgendeine fürchterliche Begebenheit verfl ochten, die mein Herz zerfl eischte – vielleicht war es nur ein spukhafter Traum, dessen Andenken mir geblieben. – Genug – der Mensch mit seinem seltsamen Beginnen, mit seinen wirren Reden deuchte mir ein bedrohliches gespenstisches Wesen, das uns vielleicht verlocken wollte in verderbliche Zauberkreise.»
«Welche Einbildungen», rief Julia, «ich für mein Teil verwandle das schwarze Gespenst mit der Gitarre in den Monsieur Jacques oder gar in den ehrlichen Probstein, dessen Philosophie beinahe so lautet, wie die wunderlichen Reden des Fremden. – Doch hauptsächlich ist es nun nötig, die arme Kleine zu retten, die der Barbar so feindselig in das Gebüsch geschleudert hat.» -
«Julia – was beginnst du – um des Himmels willen», rief die Prinzessin; doch ohne auf sie zu achten, schlüpfte Julia hinein in das Dickicht und kam nach wenigen Augenblicken triumphierend, die Gitarre, die der Fremde weggeworfen, in der Hand, zurück.
Die Prinzessin überwand ihre Scheu und betrachtete sehr aufmerksam das Instrument, dessen seltsame Form schon von hohem Alter zeugte, hätte das auch nicht die Jahrzahl und der Namen des Meisters bestätigt, den man durch die Schallöffnung auf dem Boden deutlich wahrnahm. Schwarz eingeätzt waren nämlich die Worte: “Stefano Pacini fec. Venet. 1532”.
Julia konnte es nicht unterlassen, sie schlug einen Akkord auf dem zierlichen Instrument an und erschrak beinahe über den mächtigen vollen Klang, der aus dem kleinen Dinge heraustönte. «O herrlich – herrlich», rief sie aus und spielte weiter. Da sie aber gewohnt, nur ihren Gesang mit der Gitarre zu begleiten, so konnte es nicht fehlen, daß sie bald unwillkürlich zu singen begann, indem sie weiter fortwandelte. Die Prinzessin folgte ihr schweigend. Julia hielt inne; da sprach Hedwiga: «Singe, spiele auf dem zauberischen Instrumente, vielleicht gelingt es dir, die bösen, feindlichen Geister, die Macht haben wollten über mich, hinabzubeschwören in den Orkus.»
«Was willst du», erwiderte Julia, «mit deinen bösen Geistern, die sollen uns beiden fremd sein und bleiben, aber singen will ich und spielen, denn ich wüßte nicht, daß jemals mir ein Instrument so zur Hand gewesen, mir überhaupt so zugesagt hätte, als eben dieses. Mir scheint auch, als wenn meine Stimme viel besser dazu laute als sonst.» – Sie begann eine bekannte italienische Kanzonetta und verlor sich in allerlei zierliche Melismen, gewagte Läufe und Capriccios, Raum gebend dem vollen Reichtum der Töne, der in ihrer Brust ruhte.
War die Prinzessin erschrocken über den Anblick des Unbekannten so erstarrte Julia zur Bildsäule, als er, da sie eben in einen andern Gang einbiegen wollte, plötzlich vor ihr stand.
Der Fremde, wohl an dreißig Jahre alt, war nach dem Zuschnitt der letzten Mode schwarz gekleidet. In seinem ganzen Anzuge fand sich durchaus nichts Sonderbares, Ungewöhnliches, und doch hatte sein Ansehen etwas Seltsames, Fremdartiges. Trotz der Sauberkeit seiner Kleidung war eine gewisse Nachlässigkeit sichtbar, die weniger von Mangel an Sorgfalt als davon herzurühren schien, daß der Fremde gezwungen worden, einen Weg zu machen, auf den er nicht gerechnet und zu dem sein Anzug nicht paßte. Mit aufgerissener Weste, das Halstuch nur leicht umschlungen, die Schuhe dick bestäubt, auf denen die goldnen Schnällchen kaum sichtbar, stand er da, und närrisch genug sah es aus, daß er an dem kleinen dreieckigen Hütchen, das nur bestimmt, unter den Armen getragen zu werden, die hintere Krempe herabgeschlagen hatte, um sich gegen die Sonne zu schützen. Er hatte sich durchgedrängt durch das tiefste Dickicht des Parks, denn sein wirres schwarzes Haar hing voller Tannadeln. Flüchtig schaute er die Prinzessin an und ließ dann den seelenvollen leuchtenden Blick seiner großen dunklen Augen auf Julia ruhen, deren Verlegenheit noch dadurch erhöht wurde, so daß ihr, wie es in dergleichen Fällen ihr zu geschehen pfl egte, die Tränen in die Augen traten.
«Und diese Himmelstöne», begann der Fremde endlich mit weicher sanfter Stimme, «und diese Himmelstöne schweigen vor meinem Anblick und zerfl ießen in Tränen?»
Die Prinzessin, den ersten Eindruck, den der Fremde auf sie gemacht, mit Gewalt niederkämpfend, blickte ihn stolz an und sprach dann mit beinahe schneidendem Ton: «Allerdings überrascht uns Ihre plötzliche Erscheinung, mein Herr! man erwartet um diese Zeit keine Fremden mehr im fürstlichen Park. – Ich bin die Prinzessin Hedwiga.» -
Der Fremde hatte sich, sowie die Prinzessin zu sprechen begann, rasch zu ihr gewendet und schaute ihr jetzt in die Augen, aber sein ganzes Antlitz schien ein andres worden. – Vertilgt war der Ausdruck schwermütiger Sehnsucht, vertilgt jede Spur des tief im Innersten aufgeregten Gemüts, ein toll verzerrtes Lächeln steigerte den Ausdruck bitterer Ironie bis zum Possierlichen, bis zum Skurrilen. – Die Prinzessin blieb, als träfe sie ein elektrischer Schlag, mitten in der Rede stecken und schlug, blutrot im ganzen Gesicht, die Augen nieder.
Es schien, als wollte der Fremde etwas sagen, in dem Augenblick begann indessen Julia: «Bin ich nicht ein dummes törichtes Ding, daß ich erschrecke, daß ich weine wie ein kindisches Kind, das man ertappt über dem Naschen! – Ja, mein Herr! ich habe genascht, hier die treffl ichsten Töne weggenascht von Ihrer Gitarre – die Gitarre ist an allem schuld und unsere Neugier! – Wir haben Sie belauscht, wie Sie mit dem kleinen Dinge so hübsch zu sprechen wußten, und wie Sie dann im Zorne die Arme wegschleuderten in das Gebüsch, daß sie im lauten Klageton ausseufzte, auch das haben wir gesehen. Und das ging mir so recht tief ins Herz, ich mußte hinein in das Dickicht und das schöne liebliche Instrument aufheben. – Nun, Sie wissen wohl, wie Mädchen sind, ich klimpere etwas auf der Guitarre, und da fuhr es mir in die Finger – ich konnt’ es nicht lassen. – Verzeihen Sie mir, mein Herr, und empfangen Sie Ihr Instrument zurück.»
Julia reichte die Gitarre dem Fremden hin. «Es ist», sprach der Fremde, «ein sehr seltnes klangvolles Instrument, noch aus alter guter Zeit her, das nur in meinen ungeschickten Händen – doch was Hände – was Hände! – Der wunderbare Geist des Wohllauts, der diesem kleinen seltsamen Dinge befreundet, wohnt auch in meiner Brust, aber eingepuppt, keiner freien Bewegung mächtig; doch aus Ihrem Innern, mein Fräulein, schwingt er sich auf zu den lichten Himmelsräumen, in tausend schimmernden Farben, wie das glänzende Pfauenauge. – Ha, mein Fräulein! als Sie sangen, aller sehnsüchtige Schmerz der Liebe, alles Entzücken süßer Träume, die Hoffnung, das Verlangen wogte durch den Wald und fi el nieder wie erquickender Tau in die duftenden Blumenkelche, in die Brust horchender Nachtigallen! – Behalten Sie das Instrument, nur Sie gebieten über den Zauber, der in ihm verschlossen!» -
«Sie warfen das Instrument fort», erwiderte Julia hoch errötend. «Es ist wahr», sprach der Fremde, indem er mit Heftigkeit die Guitarre ergriff und an seine Brust drückte, «es ist wahr, ich warf es fort und empfange es geheiligt zurück; nie kommt es mehr aus meinen Händen!» -
Plötzlich verwandelte sich nun das Antlitz des Fremden wieder in jene skurrile Larve, und er sprach mit hohem schneidenden Ton: «Eigentlich hat mir das Schicksal oder mein Kakodämon einen sehr bösen Streich gespielt, daß ich hier so ganz ex abrupto, wie die Lateiner und noch andere ehrliche Leute sagen, vor Ihnen erscheinen muß, meine hochverehrtesten Damen! – O Gott gnädigste Prinzessin, riskieren Sie es, mich anzuschauen von Kopf bis zu Fuß. Sie werden denn aus meinem Ajustement zu entnehmen geruhen, daß ich mich auf einer großen Visitenfahrt befi nde. – Ha! ich gedachte eben bei Sieghartsweiler vorzufahren und der guten Stadt, wo nicht meine Person, doch wenigstens eine Visitenkarte abzugeben. – O Gott! fehlt es mir denn an Konnexionen, meine gnädigste Prinzessin? – War nicht sonst der Hofmarschall Dero Herrn Vaters mein Intimus? – Ich weiß es, sah er mich hier, so drückte er mich an seine Atlasbrust und sagte gerührt, indem er mir eine Prise darbot: “Hier sind wir unter uns, mein Lieber, hier kann ich meinem Herzen und den angenehmsten Gesinnungen freien Lauf lassen.” – Audienz hätte ich erhalten bei dem gnädigsten Herrn Fürsten Irenäus und wäre auch Ihnen vorgestellt worden, o Prinzessin! Vorgestellt worden auf eine Weise, daß ich mein bestes Gespann von Septime-Akkorden gegen eine Ohrfeige setze, ich hätte Ihre Huld erworben! – Aber nun! – hier im Garten am unschicklichsten Orte zwischen Ententeich und Froschgraben, muß ich mich selbst präsentieren, mir zum ewigen Malheur! – O Gott, könnt’ ich nur was weniges hexen, könnt’ ich nur subito diese edle Zahnstocherbüchse (er zog eine aus der Westentasche hervor) verwandeln in den schmuckesten Kammerherrn des Irenäusschen Hofes, welcher mich beim Fittich nähme und spräche: Gnädigste Prinzessin hier ist der und der! – Aber nun! – che far’, che dir’! – Gnade – Gnade, o Prinzessin, o Damen! – o Herren!»