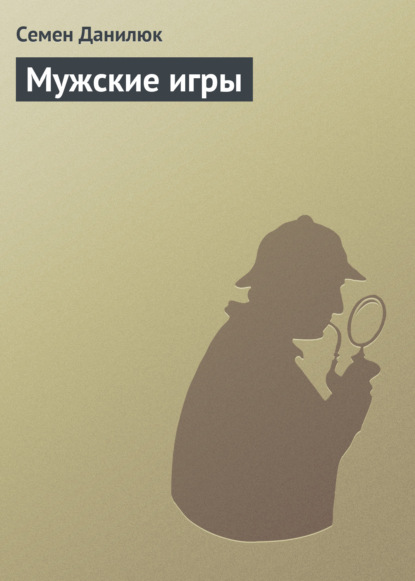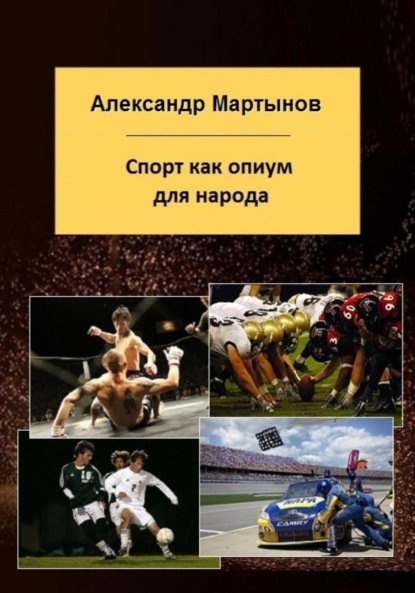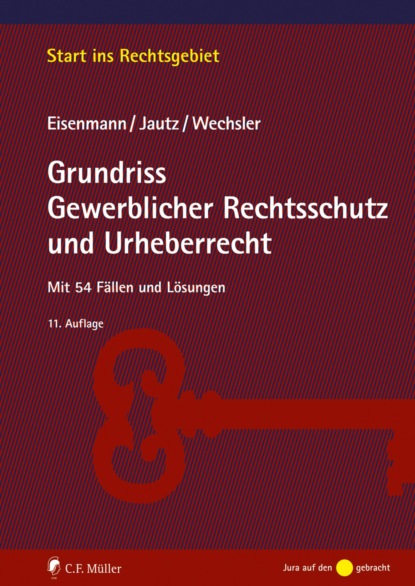- -
- 100%
- +
Kaiserliche Rechtsbeugung: der Skandal um Donauwörth
Mit der Exekution beauftragte Kaiser Rudolf nicht etwa den eigentlich zuständigen Obristen des Schwäbischen Reichskreises („Landfriedensschutz“, wie man das damals nannte, war Kreissache), also den lutherischen Herzog von Württemberg, sondern Maximilian von Bayern: für alle Protestanten ein himmelschreiender Rechtsverstoß! Wie konnte man sich unter solchen Umständen noch auf den Rechtsschutz des Reiches verlassen? „Donawörth ist ein lumpennest, was hat es aber für ungelegenheit und weiterung causirt“, also verursacht: so seufzte mit Zacharias Geizkofler einer der klügsten politischen Beobachter der Zeit. Der Bayernherzog exekutierte demonstrativ robust, okkupierte die Kommune mit Truppenmacht, übergab die Pfarrkirche den Jesuiten und unterwarf die Reichsstadt seiner angeblich „kommissarischen“ Verwaltung. Daraus wird nie mehr Selbstverwaltung, Donauwörth mutiert zur bayerischen Landstadt. All das musste Deutschlands Protestanten empören, auch, und zumal in Süddeutschland, ängstigen.
1.2.4 Das politische Grundvertrauen schwindet dahin
Es waren aber nicht nur Einzelbestimmungen des Religionsfriedens umkämpft. Wert, Sinnhaftigkeit, ja, Legitimität eines interkonfessionellen politischen Friedens wurden vielmehr seit den 1580er-Jahren in immer mehr Flugschriften (also auf Massenwirkung abzielenden Broschüren zu tagesaktuellen Themen) und gelehrten Abhandlungen [<<28] ganz grundsätzlich infrage gestellt. Ein solcher Frieden wurde immer mehr Autoren zum Inbegriff politischer Hybris, die dem Irrglauben erlegen war, Politik könne mehr sein als Ancilla theologiae (wörtlich übersetzt: „Magd der Theologie“ – also praktische Politik als Vollzug theologischer Postulate, Politikwissenschaft als theologische Hilfswissenschaft).
Fundamentalkritik am Religionsfrieden
Die Fundamentalkritik am Religionsfrieden gipfelte in diese – nun bei katholischen Autoren häufig begegnende – publizistische Position: „Der Augsburger Religionsfrieden bindet uns schon deshalb nicht, weil Vereinbarungen mit Ketzern grundsätzlich keine Rechtskraft zukommt.“ Die damals jedem Gebildeten geläufige lateinische Überschrift für derartige Erwägungen lautete „fides haereticis servanda“ – so also hat man die beliebte Streitfrage rubriziert, ob man denn überhaupt verpflichtet sei, mit Häretikern getroffene Vereinbarungen einzuhalten. „Haeretici“, das waren natürlich die Protestanten, und die waren denn auch zu Recht alarmiert.
„Fides haereticis servanda“
Es entspann sich eine rege publizistische Kontroverse darüber, ob der konfessionelle Widerpart überhaupt noch politikfähig, noch geschäftsfähig sei. Beide Seiten warfen einander in Hunderten von Flugschriften und Traktätchen vor, sich nicht an einmal getroffene Vereinbarungen zu halten, überhaupt halten zu wollen. Frohgemute Bekenntnisse zu mangelnder Vertragstreue begegnen bis in die Kriegsjahre hinein nur von katholischer Seite, aber den Vorwurf an den Widerpart, sich nicht durch Eid oder Vertragsunterschrift gebunden zu sehen, erhoben nun alle Seiten gewohnheitsmäßig. Apodiktisch hielt 1614 ein calvinistischer Autor fest: „Cum ejusmodi hominum genere … contrahi non potest“, Menschen dieses Schlags sind nicht geschäftsfähig. Umgekehrt wussten zahlreiche katholische Autoren, dass von Protestanten grundsätzlich „keine Constitutiones, keine Pacta, Brief vnd Siegel nicht gehalten“ wurden – so eine katholische Abhandlung aus demselben Jahr 1614.
Natürlich lasen die Entscheidungsträger solche Schriften. Für Wilhelm Ferdinand von Efferen, einen im frühen 17. Jahrhundert bekannten katholischen Spitzendiplomaten, waren es „verlauffene Zeiten, da Treue und Glaube noch gehalten worden“, da für evangelische Politiker noch „Eyd, Pflicht, Verschreiben, Versprechen und dergleichen humanae fidei vincula“ gegolten hätten. Protestanten konnte man [<<29] einfach nicht trauen. Gehörten sie, recht besehen, überhaupt jener Wertegemeinschaft des christlichen Abendlandes an, außerhalb derer allenfalls vorübergehende Pax iniqua herrschen konnte, ein Waffenstillstand bis auf bessere Gelegenheit, doch niemals Frieden? Johann Schweikhard von Mainz, wahrlich kein Zelot unter den geistlichen Reichsfürsten der Vorkriegszeit, lamentierte einmal in einem Schreiben an den wichtigsten Berater des Kaisers Matthias (1612–1619), Melchior Khlesl: Es hätten „Ongehorsamb, Ontreu, Betrug und List uber Hand genommen, dass sich weder auf teuere Wort, Vertrösten und Versprechen, noch auch Brief und Siegel, ja den Schwur und Eid selbsten ichtwas zu verlassen, sonder daß alles nach der verfluchten Lehr des Machiavelli auf ein jede sich an Hand gebende Occasion ratione status (wie sie es nennen)“, also unter Berufung auf die „Staatsräson“, „bei Seit gesetzt und nichts geacht wird“. Im lautstarken publizistischen Getöse um die Bindewirkung interkonfessioneller Abmachungen drohte sich das für den Politikbetrieb unabdingbare Grundvertrauen in die Verlässlichkeit der Mitakteure zu verflüchtigen.
1.3 Seit 1608 – die Vorkriegszeit
1.3.1 Krisenjahr 1608
Die Frage, ob politischer Interessenausgleich ohne solches Grundvertrauen überhaupt funktionieren kann, stellte sich mit voller Schärfe seit 1608. In diesem Jahr scheiterte spektakulär und mit weitreichenden Folgen der in Regensburg angesetzte Reichstag.
Reichstag in Regensburg
Klären wir kurz einige im Folgenden wichtige Begriffe: so insbesondere die Termini „Reichstag“ und „Reichsabschied“! Der Reichstag war, modern formuliert, das Legislativorgan des Reiches sowie überhaupt sein zentrales politisches Forum. Er tagte unregelmäßig, alle Reichsstände durften teilnehmen bzw. einen Vertreter abordnen. „Reichsstand“ war, wer „reichsunmittelbar“ war, also lediglich „Kaiser und Reich“, nicht aber einem anderen Landesherrn unterstand; sowie „Sitz und Stimme“ am Reichstag besaß (wo keine Reichsritter saßen und votierten – sie also waren zwar „reichsunmittelbar“, aber doch keine „Reichsstände“). Meistens stand die Reichsstandschaft [<<30] einer einzelnen Person zu: einem Kurfürsten, Fürsten oder Grafen. Im Fall der Reichsstädte besaß ein Gremium die Reichsstandschaft: der Stadtrat der betreffenden Kommune nämlich. Am Ende jedes Reichstags fügte die Kanzlei des Kurfürsten von Mainz, der sozusagen der ‚Reichstagsdirektor‘ war, alle von der betreffenden Tagung erarbeiteten „Reichsschlüsse“ (also, modern gesagt, alle von ihr beschlossenen Gesetze) zu einem langen Text zusammen: dem „Reichsabschied“ dieses Reichstags.
Gehen wir nach Regensburg! Die Protestanten waren bereits äußerst besorgt und in großer Erregung angereist, insbesondere Donauwörths wegen. Als der Reichstag eröffnet wurde, hing am Regensburger Rathaus noch das Achtsmandat gegen die seitherige Reichsstadt. Das ist aber nur eine Teilerklärung für die von Anfang an angespannte Stimmung in Regensburg. Konsterniert berichteten die kursächsischen Gesandten nach Hause, der Widerpart sei von „jesuitischen consilia“ (lat. consilia = „Ratschläge“) vergiftet, bemühe sich erst gar nicht um ein konziliantes Auftreten – alles sehe danach aus, als werde im Reich „in Kurzem ein greulich Blutbad angerichtet werden“.
Die Protestanten fordern die Bekräftigung des Religionsfriedens
Donauwörths wegen teils verängstigt, teils tief verletzt forderten die Protestanten, die Verbindlichkeit des Religionsfriedens im Reichsabschied zu bekräftigen, was die katholische Seite reflexhaft abschlug. Motiviert hat den evangelischen Antrag die soeben angedeutete Debatte „an fides haereticis servanda“. Man beobachtete, dass seit geraumer Zeit immer mehr katholische Traktate offen die Verbindlichkeit des Religionsfriedens bestritten. Deshalb also sollte ihn der Reichsabschied bestätigen, so bekräftigen. Indem sich die „Politici“ demonstrativ von publizistischen Ruhestörern und Schreibtischextremisten distanzierten, würden sie ein Fundament für wieder vertrauensvolle politische Zusammenarbeit legen und sich gleichsam selbst aus dem Sumpf ziehen – so das Kalkül der Antragssteller.
Die Katholiken kontern mit der Restitutionsklausel
Stattdessen verlor man nun vollends den Boden unter den Füßen. Die katholische Seite witterte verschlagene Hintergedanken, und auch wenn sich über sie nur vage rätseln ließ – auf den Leim gehen würde man dem Widerpart natürlich nicht. Es ist bezeichnend für das kommunikative Desaster der Vorkriegsjahre, wie da die katholischen Reichstagsteilnehmer, anstatt mit den evangelischen Kollegen ein konstruktives Gespräch und auf diesem Wege Aufklärung zu suchen, [<<31] unfassbar viel Energie ins Ausmalen immer neuer, noch finstererer Verschwörungsfantasien steckten. Es mochte ja alles Mögliche hinter dem evangelischen Antrag stecken, eines freilich ganz gewiss nicht: was in den Zeilen statt zwischen ihnen stand. Man konterte den vermeintlich hinterhältigen evangelischen Wunsch mit einer maliziösen Retourkutsche: forderte nämlich, dass im Gegenzug alles, was sich die eine oder andere Seite seit 1555 rechtswidrig angeeignet habe, zurückgegeben, restituiert werde.
Ein kommunikatives Desaster
Was beim ersten Hinschauen harmlos anmuten mag, hat nun wiederum die schon erregten Protestanten noch mehr alarmiert. Evangelische Positionen waren in den maßgeblichen Reichstagskurien in der Minderheit. Konnte die Gegenseite da nicht rasch umreißen und mehrheitlich beschließen, wer (nämlich ausschließlich Protestanten) sich was rechtswidrig angeeignet habe? Nun könnte man einwenden, die evangelische Seite hätte ja nur ihren Antrag auf eine Bekräftigung des Religionsfriedens zurückzuziehen brauchen. Diese heute plausible Erwägung ginge aber völlig an der Logik des Konfessionellen Zeitalters vorbei. Wenn die Protestanten jetzt klein beigäben, würdigten sie den Religionsfrieden selbst zum vorübergehenden Waffenstillstand, zum Provisorium herab: Davon waren sie felsenfest überzeugt. Man hätte seine glorreiche Idee einer Bestätigung des Augsburger Gesetzeswerks vielleicht besser gar nicht erst vorgetragen, aber nachdem sie nun einmal aktenkundig geworden war, konnte man unmöglich zurück.
Umgekehrt war es den Katholiken gewiss zunächst einmal darum gegangen, die frechen Ketzer zu ärgern, ihnen den Spaß an ihrer unverschämten Forderung zu verderben; die Restitutionsklausel war nicht als Angriffswaffe, sondern als Gegenmittel ausgedacht worden. Zögen sie die Katholiken ihrer verheerenden Nebenwirkungen wegen wieder zurück, dann könnten sie sich, so ihre felsenfeste Überzeugung, genauso gut auch gleich selbst den Todesstoß versetzen. Die Forderung nach umfassenden Restitutionen war nun gestellt, distanzierte man sich nachträglich davon, würde der Widerpart gar kein Halten mehr kennen, würde er die Reste der Reichskirche vollends verschlingen. Was zunächst als pfiffiges Gegenmittel ersonnen worden war, erhärtete der heftige evangelische Widerspruch, einem diabolischen Mechanismus dieser unseligen Zeit gehorchend, zum katholischen Grundprinzip, an [<<32] ihm ließ man 1608 sogar den Reichstag zerbrechen – wie hätte man da später wieder davon abrücken können! Zu den katholischen Vorbedingungen, um mit dem Widerpart überhaupt ins politische Geschäft kommen, ihn wieder als gesprächsfähig erachten zu können, gehörte fortan die Restitution des unrechtmäßig Angemaßten. In katholischen Augen waren alle seit 1555 von den Protestanten errungenen Positionen unrechtmäßig „occupirt“ worden – das Restitutionsedikt von 1629 (vgl. Kap. 2.3.1) kündigte sich am Horizont an! Seit 1608 stand den evangelischen Reichsständen klar vor Augen, was ihnen blühen würde, wenn die katholische Seite ein deutliches machtpolitisches Übergewicht im Reichsverband gewinnen sollte: nämlich einschneidende territoriale Revisionen zu ihren Ungunsten.
Sprengung des Reichstags
Der Eklat war da – beginnend mit den Pfälzern und ihrem Anhang, reisten die Protestanten schließlich einfach ab. Die Reichsstände gingen auseinander, ohne dass ein Reichsabschied zustande gekommen wäre. Die Legislative des Reiches war lahmgelegt. Fast schon wider besseres Wissen wird man sich 1613 noch einmal zum Reichstag versammeln, aber der verläuft ganz unerquicklich, hinterlässt auf beiden Seiten Erbitterung und selbstgerechten Zorn über die Verstocktheit der Gegenseite. „Wir stunden gegeneinander wie zwei Böcke, die niemand weichen wollen“, schrieb der kurbrandenburgische Delegierte vom Reichstag nach Hause (zit. nach Winfried Schulze). Es ein weiteres Mal mit dieser Tagungsform zu versuchen, war in zeitgenössischer Einschätzung vergebliche Liebesmüh; erst 1640 wird man es wieder wagen. Eine Politikergeneration hat keinen Reichstag erlebt, kein Forum gekannt, das alle Reichsstände zusammengeführt hätte, um friedlich, mit Worten anstatt mit Waffen Interessen aufeinander abzustimmen und Entscheidungen fürs Reich zu fällen. Es ist auch für die Kriegsursachenforschung aufschlussreich, dass der Dreißigjährige Krieg bis in seine Spätphase hinein keinen Reichstag gesehen hat.
1.3.2 Die Blockade des politischen Systems
Mit dem Reichstag war nun nicht nur ein zentrales, war zudem das letzte bis dahin überhaupt noch arbeitsfähige Reichsorgan lahmgelegt. Über dem eskalierenden Streit der Interpretationsschulen waren zuvor [<<33] schon alle anderen Reichsorgane ausgefallen oder unwirksam geworden. Werfen wir einige Schlaglichter auf die Wichtigsten von ihnen!
Den Rechtsfrieden im Reich sollten zwei oberste Reichsgerichte verbürgen. Aus unterschiedlichen Gründen waren sie dazu schon im Vorfeld des Dreißigjährigen Krieges nicht mehr in der Lage.
Krise der Reichsjustiz
Der mit Vertrauensmännern des Kaisers besetzte Reichshofrat verschrieb sich seit den 1590er-Jahren unübersehbar den katholischen Lesarten des Religionsfriedens, schaltete seit 1606 vollends auf eine „konfrontative Linie um“ (Stefan Ehrenpreis). Deshalb akzeptierten viele Protestanten seine Rechtsprechung in interkonfessionellen Streitfällen nicht mehr – denn bei den „Hofprozessen“ würden Politik und Rechtsprechung ungut vermischt. Damit waren um den Religionsfrieden kreisende Auslegungsprobleme nicht mehr konsensstiftend justiziabel. Der Soziologe Niklas Luhmann hat die Auswirkungen von Gerichtsverfahren einmal so beschrieben: Der Prozessteilnehmer finde sich
wieder als jemand, der die Normen in ihrer Geltung und die Entscheidenden in ihrem Amte bestätigt und sich selbst die Möglichkeiten genommen hat, seine Interessen als konsensfähig zu generalisieren und größere soziale oder politische Allianzen für seine Ziele zu bilden. Er hat sich selbst isoliert. Eine Rebellion gegen die Entscheidung hat dann kaum noch Sinn und jedenfalls keine Chancen mehr. Selbst die Möglichkeit, wegen eines moralischen Unrechts öffentlich zu leiden, ist verbaut.
Das Verfahren habe die Funktion, „den einzelnen, wenn er nicht zustimmt, thematisch und sozial so zu isolieren, dass sein Protest folgenlos bleibt“. Man wird den inkriminierten „Hofprozessen“ alle diese Wirkungen nicht zusprechen wollen: Evangelische Beklagte, die von ihnen überzogen wurden, interpretierten die fraglichen „Normen“, nämlich den Reichsabschied von 1555, ganz anders als jenes Gericht, das sie als Entscheidungsinstanz gar nicht akzeptierten. Weil zahlreiche evangelische Reichsstände die Auslegungskunst des Reichshofrats ablehnten, konnte der einzelne Prozessverlierer durchaus „politische Allianzen für seine Ziele“ bilden, kollektive Entrüstung an Protestantenkonventen mobilisieren, seine Niederlage skandalisieren und zum evangelischen „Gravamen“ machen. Die Reichsgerichte produzierten [<<34] nicht mehr problemlos exekutierbare Urteile und „folgenlos“ bleibenden Protest, sondern folgenreiche Proteste und schwer exekutierbare Urteile.
Das ständische Reichskammergericht war konfessionell ausgewogener besetzt, aber die Probleme waren deshalb nur anders, nicht kleiner. Beispielsweise blockierten sich Katholiken und Protestanten häufig schon in jenen Extrajudizialsenaten gegenseitig, die darüber zu entscheiden hatten, ob ein Streit überhaupt gerichtsanhängig wurde. Damit konnte die konfliktkanalisierende Kraft des Verfahrens (wir dürfen die befriedenden Effekte der Rechtsprechung ja nicht nur bei den Endurteilen verorten) nicht mehr wirksam werden. Andere Probleme kamen hinzu, aber um Detailfülle und Vollständigkeit soll es hier ja nicht gehen – jedenfalls war die Wirksamkeit auch dieses Gerichtshofs schwer beeinträchtigt. Um erneut Luhmann zu zitieren: Er hat einmal zu Recht betont, ein politisches System müsse „die Entscheidbarkeit aller aufgeworfenen Probleme garantieren“. Das Reichskammergericht hat dazu nicht mehr beigetragen.
Krise der Reichsversammlungen
Aber dem Reich kamen überhaupt sukzessive die Foren des Meinungsaustauschs und der friedlichen Konfliktbereinigung abhanden. Der Versuch des Reichsdeputationstags (gewissermaßen ein verkleinertes Abbild des Reichstags), sich einiger vom Kammergericht nicht mehr lösbarer Rechtsstreitigkeiten anzunehmen, führte 1601 zu seiner Sprengung. Der Rheinische Kurfürstentag, eine fürs Spätmittelalter zentral wichtige, noch im 16. Jahrhundert bedeutsame Tagungsform, zerbrach irreversibel an der Unlust der drei rheinischen Erzbischöfe, sich mit dem aus ihrer Sicht ketzerischen, nämlich calvinistischen Kurpfälzer an einen Tisch zu setzen. Man blieb lieber unter sich, wollte die Feindbilder gar nicht mehr dem Realitätstest aussetzen. Der Kurpfälzer und der Kurfürst von Brandenburg traten dem Kurverein nicht bei, weil die geistlichen Amtskollegen „mit lauter Martialischen unndt Kriegerischen Gedanken“ erfüllt seien.
Im frühen 17. Jahrhundert war von allen Institutionen des Reiches nur noch der Reichstag – leidlich – arbeitsfähig. Das macht die Sprengung der Regensburger Tagung von 1608 so fatal. Aufmerksamen Zeitgenossen entging das nicht: „De comitiis si quid vis, omnia ibi lenta et turbulenta et uno verbo ad bellum spectant“ („wenn Du wissen willst, wie der Reichstag verläuft – hier geht alles zäh voran und [<<35] doch drunter und drüber, kurz, Krieg ist in Sicht“). In evangelischen Akten dieser Monate grassiert eine Formulierung, die nicht modernem Deutsch entspricht und doch noch heute verständlich ist: „krieg steht ins haus“; es gerann rasch zum Topos. Wie sollten Konflikte fortan noch kanalisiert und gewaltlos geschlichtet werden? Musste man da nicht, um seine Interessen zu verfechten, fast zwangsläufig früher oder später zu den Waffen greifen? Noch im Frühjahr 1608 schlossen sich eine Reihe evangelischer Reichsstände in Auhausen zur evangelischen Union zusammen, die katholische Seite wird 1609 mit der Liga nachziehen. Damit stehen wir unübersehbar in der Vorkriegszeit.
1.3.3 Evangelische Union und katholische Liga
Das evangelische Deutschland wird im Dreißigjährigen Krieg deutlich weniger geschlossen agieren als Deutschlands Katholiken; und anders als die bis 1635 fortexistierende Liga wird die Union die erste Kriegsphase, den Böhmisch-Pfälzischen Krieg, nicht überdauern. Woran liegt es? Es gab von Anfang an zwei Mankos: Innerhalb der Union mussten sehr verschiedene Denk- und Politikstile miteinander auskommen; und viele evangelische Reichsstände waren für die Union erst gar nicht zu gewinnen, fast ganz Norddeutschland blieb abseits.
Die Union wurde in einem Dörflein der fränkischen Markgrafschaft Ansbach gegründet, im Kapitelsaal des säkularisierten Klosters Auhausen. Gründungsmitglieder waren der Kurfürst von der Pfalz, der Herzog von Württemberg, die Markgrafen von Baden, Ansbach und Kulmbach sowie der Pfalzgraf von Neuburg. Die Bundessatzung schreibt zwar jährliche Bundessteuern fest, auf dass man für den militärischen Ernstfall gewappnet sei (es wurde also eine gemeinsame Kriegskasse angelegt), aber der Bündniszweck wird wiederholt ausdrücklich als defensiv charakterisiert. Die Allianz werde Truppen in Bewegung setzen, so eines ihrer Glieder angegriffen werde.
Probleme der Union 1: geringe Homogenität
Freilich, wer definierte den Angriffsfall? Weil sich der calvinistische Heidelberger Kurhof traditionell einem risiko- und konfrontationsbereiteren Politikstil verschrieb als die anderen, mehrheitlich lutherischen Residenzen des evangelischen Deutschland, konnte es schon von Bedeutung sein, dass die Leitung der Union in kurpfälzischer Hand lag. Friedrich IV. war eben, als Kurfürst, das ranghöchste [<<36] Gründungsmitglied und wurde dementsprechend zum Direktor des Bündnisses ernannt – er also hatte die Korrespondenz zu führen, zu Bundestagen zu laden, wo ihm dann die Versammlungsleitung zukam. Auch die militärischen Bundesämter fielen in die Hände von Kurpfälzern oder von Anhängern des dortigen Politikstils. Die politischen und militärischen Schlüsselpositionen hatten Personen inne, die viel weiträumiger dachten als die meisten Unionsstände; Personen, die im europäischen Maßstab kalkulierten, für die die Union nicht lediglich Nachbarschaftshilfe im Fall der Bedrängnis zu organisieren hatte, für die diese Union Baustein einer europaweiten antikatholischen, antihabsburgischen Allianz war. Dieser weite Horizont, negativer formuliert: diese Neigung zum risikobereiten Hazardspiel war den meisten Fürsten im Bündnis (und erst recht den in den Folgejahren beitretenden reichsstädtischen Magistraten) fremd.
Probleme der Union 2: Norddeutschland bleibt abseits
Die Gründungsmitglieder der Union wird man süddeutsch nennen können, auch den später beitretenden Pfalzgrafen von Zweibrücken, die Grafschaft Öttingen sowie insgesamt 17 fränkische, schwäbische und elsässische Reichsstädte, ferner die fränkische Reichsritterschaft. Dazu kamen noch – sagen wir salopp: ungefähr in der Mitte des Reiches – der Landgraf von Hessen-Kassel sowie das Fürstentum Anhalt. Dabei aber blieb es. Die Union vergrößerte sich in ihren schwungvollen Anfangsjahren rasch auf 28 Bundesglieder, aber seit 1610 stagnierte der Mitgliederstand. Die norddeutsche Tiefebene blieb abseits, lediglich Kurbrandenburg im Nordosten wird zeitweise zur Union gehören, aber nie ein zuverlässiger Verbündeter sein. Spät beitretend, hat sich Berlin seit 1617, also vier Jahre vor der Auflösung der Union, faktisch schon wieder diesem entlegenen Bündnis mit seinen süddeutschen Interessen entwunden, keine Beiträge mehr entrichtet, keine Bundestage mehr beschickt. Noch einmal drei Jahre früher, nämlich bereits 1614, war das Gründungsmitglied Pfalz-Neuburg ausgeschieden, mit dem Regierungsantritt des zum Katholizismus konvertierten Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm.
Besonders schwer wog, dass mit Kursachsen das renommierteste evangelische Territorium, das Mutterland der Reformation, dauerhaft draußen blieb. An der Elbe betrieb man eine betont kaisernahe Reichspolitik, das Reichsoberhaupt aber war katholisch. Damit kam entschiedene konfessionelle Interessenwahrung in der Reichspolitik [<<37] für die Kursächsischen nicht infrage. In einem Gutachten von 1610 attestierten sich die Dresdner selbst: „politice seint wir Bäpstisch“ – meint in modernem Deutsch: In der Reichspolitik agieren wir so kaisernah wie die katholischen („bäpstischen“) Reichsstände. Die Dresdner standen nicht nur draußen, sie bekämpften die Union entschieden: Dieses Bündnis stand an der Elbe für „Ungehorsam“ dem Reichsoberhaupt gegenüber, als halbe Reichssezession gefährde es die Stabilität des politischen Systems.
Denk- und Politikstile im evangelischen Deutschland
Wenn wir einmal der Übersichtlichkeit halber stark schematisieren, können wir im damaligen deutschen Protestantismus drei Denkschulen und Politikstile ausmachen. Da gab es erstens Territorien, die ihre konfessionellen Besitzstände so wenig gefährdet sahen – und in Norddeutschland gab es nun einmal keine mächtigen katholischen Nachbarn wie im Süden Bayern oder Österreich –, dass man keine Notwendigkeit empfand, für ihre Verteidigung Geld auszugeben und den Reichsverband zusätzlichen Spannungen auszusetzen. Zweitens gab es Regierungen – es waren hauptsächlich die süddeutschen Lutheraner, ob kleinere Fürstenhöfe, ob reichsstädtische Magistrate –, die sich durchaus lebhaft bedroht fühlten und lebhaft um ihre konfessionellen Besitzstände bangten, aber genauso lebhaft um die Stabilität des Reiches und den Frieden in Mitteleuropa. Sie versuchten sich in einer anstrengenden, oft quälenden Gratwanderung zwischen betonter Reichs- und Kaisertreue einerseits, koordinierter konfessioneller Interessenwahrung andererseits, unterstrichen den defensiven Charakter der Union und dass diese der Friedenswahrung, nicht der Kriegsvorbereitung zu dienen habe. Drittens gab es eine Gruppe von evangelischen Politikern – es waren vor allem, aber nicht nur Calvinisten –, für die der große, europaweite Endkampf zwischen Licht und Finsternis sowieso unvermeidlich war und offenkundig nah bevorstand; die dem bestehenden, strukturell prokatholisch wirkenden Reich, so, wie es sich momentan präsentierte, weder eine lange Lebensdauer gaben noch ihm eine Träne nachweinen wollten und deshalb die Priorität eindeutig auf energische, risiko- und konfrontationsbereite Konfessionspolitik legten – unter Inkaufnahme weiterer Eruptionen im zerschlissenen Reichsverband. Die erste der drei Gruppen war für die Union nicht zu gewinnen. Die beiden anderen Gruppen mussten in der Union miteinander auskommen. [<<38]