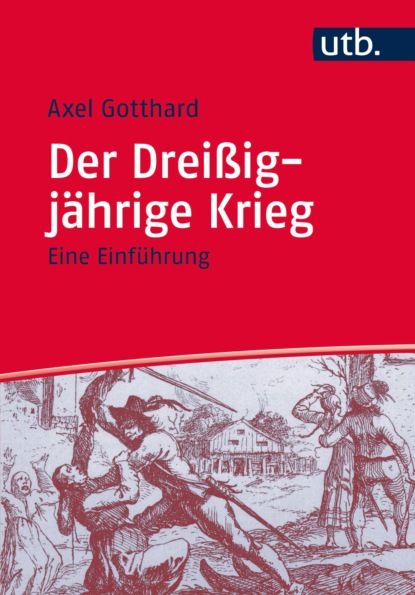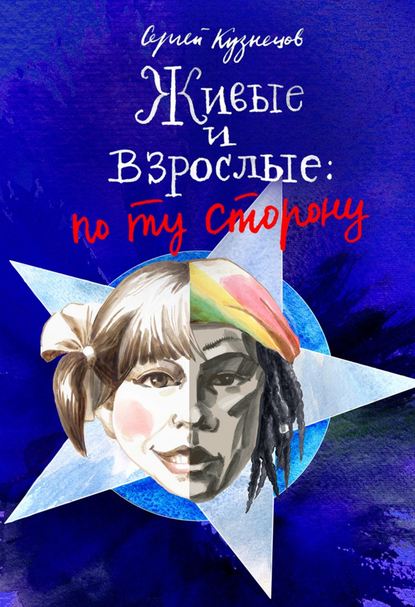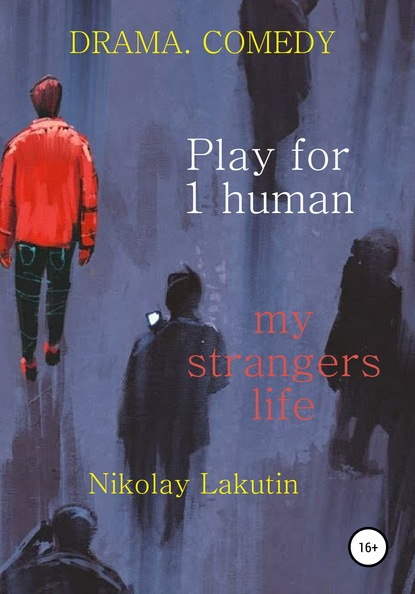- -
- 100%
- +
Für die Geschichte der Union sollte der zweite Einfall ins Elsass (vom Mai 1610) folgenreich werden. Wir müssen, anstatt aller Einzelheiten, nur drei Umstände kennen, um die Brisanz des Unternehmens verstehen zu können: Erstens war offenkundig, dass die katholischen Musterungen nicht Südwestdeutschland galten, dass sich Erzherzog Leopold endlich Respekt als kaiserlicher Administrator von Jülich verschaffen wollte. Man kann also nicht sagen, dass die Union unmittelbar bedroht gewesen wäre. Zweitens waren nur vier Unionsfürsten überhaupt eingeweiht: der kurpfälzische Direktor, sodann Moritz von Hessen-Kassel, der Ansbacher Markgraf Joachim Ernst und Georg Friedrich von Baden. Diese vier ‚Aktivisten‘ rissen einfach das Heft des Handelns an sich, schickten Unionstruppen über den Rhein. Weil sie wussten, dass die Militäraktion auf bundesfremdem Gebiet nicht konsensfähig war, wurden die Verbündeten eben gar nicht erst gefragt, auch nicht jene, die über ihre mitziehenden Truppen unfreiwillig in den Coup verwickelt waren. Sie alle wurden hinterher informiert. Sodann, drittens, ließen sich die Unionstruppen [<<49] zahlreiche Übergriffe zuschulden kommen, sie plünderten Mutzig, verwüsteten Molsheim, wüteten in der Landvogtei Hagenau, es gab Dutzende, vielleicht über hundert Tote.
Die meisten Unionsstände (einhellig die vorsichtigen, konfliktscheuen reichsstädtischen Magistrate) waren empört über den eklatanten Landfriedensbruch, der da auch in ihrem Namen verübt worden war. An den Unionstagen der Folgejahre wird der Einfall ins Elsass immer wieder als Begründung dafür herhalten, dass die Reichsstädte mehr Kontrolle über die Unionspolitik verlangen und/oder neue Steuern verweigern werden. Der Coup hat dem Bündnis in seinem dritten Jahr Wunden geschlagen, die nie mehr ganz verheilen sollten. Das latente Dauerproblem der Union war schlagartig unübersehbar geworden: dass da Regierungen mit ganz unterschiedlichen, verschieden konfrontationsbereiten politischen Vorstellungen miteinander auskommen mussten.
Wird die Union gar in einen großen europäischen Krieg hineingerissen?
Die längerfristigen Folgen der elsässischen Aggressionen waren also erheblich. Dabei war denjenigen, die sich nun und noch jahrelang darüber empörten, nicht einmal klar, dass es seit dem Winter 1609/10 um viel mehr als ‚nur‘ um Jülich und Kleve gegangen war. Während die meisten Auhausener damals ängstlich um Frieden und Stabilität in Mitteleuropa bangten, verhandelte Christian von Anhalt (bei sehr selektiver Information seiner Auhausener Verbündeten) in Paris mit Heinrich IV. über gemeinsame antihabsburgische Militäraktionen am Niederrhein. In beider Augen eröffnete die Jülicher Erbfolgekrise Chancen, die Stärkung des Protestantismus im Reich mit einer Zurückdrängung des spanischen Einflusses auf den Nordwesten des Kontinents, ja, überhaupt einer einschneidenden Schwächung der Position Habsburgs in Europa zu verbinden. Sie wollten den niederrheinischen Erbkonflikt mit der antispanischen Europapolitik Frankreichs verquicken. Ersterer sollte Paris den Vorwand zum Losschlagen liefern und deutsche Unterstützung eintragen.
Im Februar 1610 fixierten die Auhausener und Emissäre aus Paris im Vertrag von Schwäbisch Hall die Truppenkontingente für gemeinsame Militäroperationen am Niederrhein, wo Jülich inzwischen von Söldnern der österreichischen Habsburger unter Erzherzog Leopold besetzt worden war – sie gelte es mit vereinten Kräften von dort zu vertreiben. Der Vertragstext deutet, genau gelesen, die Möglichkeit [<<50] bedenklicher Weiterungen an: Falls der König wegen seines Engagements in und um Jülich von den Madridern oder den Brüsselern angegriffen würde, stünde ihm die Union mit viertausend Mann zu Fuß und tausend Reitern zur Seite, heißt es da; umgekehrt sicherte Heinrich den Unionsständen, falls die „sur le sujet de Julliers, ou autre concernant l’union“ (wegen Jülichs oder aus einer anderen das Bündnis betreffenden Ursache) attackiert würden, achttausend Fußsoldaten und zweitausend Berittene zu. Eklatant war, dass sich die Auhausener verpflichteten, keinen Vertrag, „qui importe à la cause commune“ (der für die gemeinsame Sache relevant ist), ohne vorherige Zustimmung des Bourbonen abzuschließen – einmal ins Kampfgeschehen am Niederrhein verwickelt, würde es für die Union keinen billigen diplomatischen Notausgang mehr geben. Dass der Kampf um Jülich für Heinrich von vornherein lediglich die Ouvertüre zu viel weiter reichenden Schlägen gegen das Haus Habsburg und zumal seinen spanischen Zweig sein sollte, wussten die meisten Auhausener freilich nicht, und sie kannten nicht das Ausmaß seiner Zurüstungen.
Denn Heinrich palaverte nicht nur, er stellte ein nach damaligen Maßstäben imposantes Heer auf die Beine – eine Nordarmee von zwanzigtausend Mann, eine südliche von zwölftausend: Ein Zangengriff auf Habsburg wurde da offenbar vorbereitet, wofür sonst so immense Rüstungsanstrengungen? Wie weit Heinrich gehen wollte, ob er gar vorhatte, zu einem Angriff auf die Iberische Halbinsel weiterzuschreiten, wissen wir nicht. Jedenfalls aber spielte sich Gewaltiges ab in Frankreich, und die Union wäre mit dabei gewesen – als Heinrich, am 14. Mai 1610, von der Hand eines Wirrkopfs, eines konfessionellen Fanatikers ermordet wurde: ein Paradebeispiel dafür, welches Gewicht biografischen Zufälligkeiten für vormoderne geschichtliche Abläufe zukommen kann. Heinrich starb ohne regierungsfähigen Nachfolger; an der Seite einer Regentin zweifelhafter Legitimität und zweifelhafter Intelligenz wollten selbst die Verwegensten unter Deutschlands Protestanten dann doch nicht gegen die Weltmacht Habsburg marschieren. Auch Paris stellte seine antihabsburgischen Projekte augenblicklich zurück. Wie im Vertrag von Schwäbisch Hall vereinbart, halfen französische Truppen bei der Belagerung von Jülich, das am 1. September 1610 kapitulierte. Danach zogen sie sich nach Frankreich zurück. [<<51]
Der malade Zustand des Reichsverbands wird zum Kriegsrisiko
Mitteleuropa war damals einem großen Krieg bedenklich nah. Wir erkennen schon hier, 1610, viele Konfrontationsmuster, die das Reich dann 1619 tatsächlich – erneut wegen regionaler Querelen, bei denen die allermeisten Reichsstände unmittelbar gar nichts zu gewinnen haben – in den Kriegsstrudel ziehen werden: Die Polarisierung des Reichsverbands ist so weit vorangeschritten, dass man seine konfessionspolitischen Anliegen militärisch verteidigen zu dürfen und zu müssen meint, sogar außerhalb des engeren regionalen Umfelds, sogar im Grenzsaum des Reiches. Das Gefühl, überall in die Enge getrieben zu werden, ist so bedrängend, dass Defensive, Vorwärtsverteidigung und Prävention in der subjektiven Wahrnehmung der Beteiligten an Trennschärfe einbüßen. Die Bereitschaft, sich bei alldem nichtdeutscher Unterstützung zu bedienen, war bei den ‚Aktivisten‘ von 1610 noch größer als 1619. Die Union präsentierte sich zwei Jahre nach ihrer Gründung kraftvoll, selbstbewusst und erreichte gerade, nach dem Beitritt Kurbrandenburgs, ihren höchsten, bald danach wieder abbröckelnden Mitgliederstand (der Fenstersturz wird das Bündnis ja als ein bereits niedergehendes, in sukzessiver Auflösung begriffenes ereilen). Doch war das Ausmaß der Konfrontationsbereitschaft eben auch im Frühjahr 1610 nicht überall gleich, weshalb – wiederum prototypisch – Christian von Anhalt vorpreschte, im Grunde bis hin zur Täuschung der meisten Verbündeten, die ‚lediglich‘ die konfessionelle Ausrichtung der niederrheinischen Herzogtümer im Blick hatten. So wenig das Gros der Unionsstände um 1620 eigentlich böhmische Interessen hat, so wenig gab es für die allermeisten Unierten 1610 am Niederrhein unmittelbar etwas zu gewinnen; die Aussicht, dem anderen konfessionellen Lager eins auszuwischen, es zu schädigen, zu demoralisieren – das reichte als Anreiz. Die Ermordung Heinrichs IV. dürfte einen großen Krieg unter Beteiligung der deutschen Protestanten vereitelt haben.
Erneute Kriegsgefahr 1614
Nur vier Jahre später drohten erneut kriegerische Verwicklungen. Die Spannungen zwischen den Brandenburgern und den mittlerweile von einem katholischen Pfalzgrafen regierten Neuburgern eskalierten, holländische und spanische Truppen setzten sich in Bewegung. War der Reichsverband schon so ruinös polarisiert, dass ihn nach den traditionellen französisch-habsburgischen Rivalitäten nun die seit Generationen mal virulenten, mal latenten Spannungen zwischen Madrid [<<52] und Den Haag in den Kriegsstrudel zu reißen drohten? Im November 1614 gelang, sozusagen im letzten Augenblick, dank internationaler Vermittlung der Interimsvergleich von Xanten. Für die verfeindeten „Possedierenden“ wurden je eigene Verwaltungszonen gezirkelt. (An Berlin kamen Kleve, Mark, Ravensberg: Kurbrandenburg setzte sich also dauerhaft am Niederrhein fest – Keimzelle dessen, was einmal viel später, seit der Rheinkrise von 1840, als Preußens „Wacht am Rhein“ besungen werden wird.)
Wieder war eine Atempause gewonnen. Wieder hatte sich gezeigt, dass der Zustand des Reiches mittlerweile so prekär war, dass sich jede Querele in seinem Inneren oder auch in der Nachbarschaft, irgendwo an seinen weit geschwungenen Grenzen, zum Flächenbrand auswachsen konnte. Wir werden noch sehen, dass Deutschlands Protestanten auch 1618 besorgt zum Rhein schauen werden, keinesfalls mit der gleichen Bangigkeit nach Prag.
1.4 Schon einmal vorab: etwas Kriegsursachenforschung
1.4.1 Warum die Ursachenforschung am Zustand des Reichsverbandes ansetzen muss
Dieses Studienbuch wird in Kapitel 5 rückblickend fragen, worum denn da dreißig Jahre lang Krieg geführt worden ist. Es wird immer wieder und resümierend in Kapitel 5 Kriegsschuld zumessen, nach Stolpersteinen auf dem Weg zum Frieden fragen. Aber weil wir auf den letzten Seiten ziemlich ausführlich die Vorgeschichte analysiert haben, dürfen wir doch schon jetzt erste Fragen nach dem Warum aufwerfen. Wagen wir erste Sondierungen, die noch nicht den weiteren Verlauf des Krieges umgreifen können, sondern um Vorkriegszeit und Kriegsausbruch kreisen!
Dass die evangelischen Residenzen, wie soeben schon erwähnt, im Sommer 1618 gar nicht angestrengt nach Prag starren werden, liegt auch daran, dass es dort im Osten um sehr eigene, eben spezifisch böhmische (und übrigens keinesfalls nur konfessionspolitische) Probleme geht. Auftakt zur ersten Phase des Dreißigjährigen Krieges, zum Böhmisch-Pfälzischen Krieg, ist der Prager Fenstersturz [<<53] (vgl. ausführlicher Kap. 2.1.2) – knapp gesagt versuchen im Mai 1618 einige Heißsporne unter den Ständeführern, den definitiven Bruch mit dem sich frühabsolutistisch gerierenden habsburgischen Regime zu erzwingen, indem sie zwei Exponenten schroffer Gegenreformation im Statthalterrat mitsamt ihrem Sekretär aus dem Fenster werfen. Alle drei überleben, aber es ist doch ein Mordanschlag auf Mitglieder der kaiserlichen Regierung, mithin ein recht gravierender Vorgang – aus Prager oder Wiener Warte.
Die böhmischen Querelen gehen Union und Liga eigentlich nichts an …
Was freilich hat das alles mit Deutschlands Protestanten und Katholiken, mit Union und Liga oder dem lädierten Reichsverband zu tun? Der Fenstersturz ereignete sich ja im Grenzsaum des Reiches, in einer Zone mit verdünnter Reichspräsenz – so wird der moderne Historiker die verwickelten staatsrechtlichen Befunde zusammenfassen. Akten des frühen 17. Jahrhunderts subsumieren Böhmen meistens gar nicht dem politischen Verband des Reiches. Als die böhmischen Aufständischen an die Hilfe der Auhausener appellierten, fanden diese im Staatsrecht nichts, was sie dazu hätte verpflichten können: Es sei nämlich (um aus dem Protokoll des Rothenburger Unionstags vom Herbst 1618 zu zitieren) „Bohemen dem reich nit underworffen“, urteilten sie. Die „unions Verfassung“ ziele „uf conservation der reichs Constitution“, Böhmen aber habe „aigene zunge, gesatzungen und ordnungen“. Es sei der Union „scopus uf ußländische nit gemeinet“. Tatsächlich war Böhmen, beispielsweise, nicht am Reichstag vertreten, nicht in die Kreisverfassung des Reiches einbezogen. Die einzige nennenswerte Klammer war diese: Der Böhmenkönig wählte das Reichsoberhaupt mit; an den anderen Aktivitäten des Kurkollegs beteiligte er sich hingegen nicht, er beschickte keine nichtwählenden Kollegialtage, war nicht im Kurverein.
Wir müssen solche staatsrechtlichen Sachverhalte aber gar nicht vertiefen, noch wichtiger ist nämlich dieser ganz eindeutige Befund: Hatten sich Union und Liga wegen des eskalierenden Auslegungsstreits um den Augsburger Religionsfrieden und zur Verteidigung ihrer eigenen, konfessionsspezifischen Lesarten des Texts von 1555 formiert, stritt man sich in Böhmen über einen anderen Text, ein Dokument von 1609 (namens „Majestätsbrief“ – wir werden ihn gleich kennenlernen). So gesehen gingen die Nöte der böhmischen Ständeführer die Union von Auhausen nichts an, und nichts die Nöte der Habsburger [<<54] in ihren Erbländern die katholische Liga – die beiden Konfessionsbündnisse hätten sich hierfür keinesfalls mobilisieren lassen müssen.
… aber die beiden Bündnisse lassen sich in den Konflikt hineinreißen
Aus Böhmen flog der sprichwörtliche Funken heran, der das Pulverfass zum Explodieren brachte. Seriöse Kriegsursachenforschung muss aber, um im Bild zu bleiben, an der explosiven Mischung ansetzen, die das Reich zum entzündbaren Pulverfass gemacht hat, nicht die Lunte inspizieren. Anstatt alle Kraft auf die Einhegung der regionalen böhmischen Querelen und die Abschirmung des Reiches von diesem Krisenherd zu verwenden, ließen sich die konfessionspolitischen Lager des polarisierten Reichsverbands sukzessive in die böhmischen Auseinandersetzungen hineinziehen.
Die Unionsfürsten sympathisieren eben 1618/19 nicht mit einem von seinen Untertanen bedrängten hochadeligen Standesgenossen, dem Habsburger. Sie sympathisieren vielmehr mit den aufbegehrenden Glaubensgenossen, und der Direktor der Union, Friedrich V. von der Pfalz, lässt sich von ihnen (wie wir ja schon wissen und noch genauer sehen werden) zum neuen Böhmenkönig wählen. Die darniederliegende Liga revitalisiert sich und kommt Ferdinand von Habsburg zu Hilfe – was kriegsentscheidend ist. Dass Friedrich von der Pfalz als frischgebackener Böhmenkönig nur einen Prager Winter erleben darf, entscheidet im November 1620, in der ersten berühmten Schlacht des Dreißigjährigen Krieges, ein Triumph der Ligatruppen. Der Direktor der Liga, Maximilian von Bayern, gibt persönlich den Schlachtruf aus – so hallen denn die Hänge des Weißen Berges am 8. November wider vom tausendfach ausgestoßenen „Maria, Maria, Sancta Maria“. Die geschlagenen Verteidigungstruppen unterstehen jenem Christian von Anhalt, den wir schon am Niederrhein antrafen. Die Anlässe waren zwar böhmisch. Aber die regionalen Querelen dieses Königreiches weiteten sich rasch zu Kämpfen zwischen Deutschlands Katholiken und Protestanten aus.
1.4.2 Kann die moderne Politik aus dem damaligen Desaster lernen?
Dass sich das Reich, nachdem es 1610 und 1614 zweimal (und nicht aus eigener Kraft!) um Haaresbreite an einem großen Krieg vorbeigeschrammt war, in die regionalen böhmischen Querelen hineinreißen [<<55] ließ, sagt etwas über den Zustand dieses politischen Systems aus. Der Reichsverband war nach 1555 eine Zeit lang unterwegs gewesen zu integrativer Verdichtung über weltanschauliche Gräben hinweg, aber am Ende relativierten nicht die systemimmanenten politischen Sachzwänge den konfessionellen Dissens, sondern das doppelte Wahrheitsmonopol schüttelte ihm nicht frommende Zwänge ab. Deren Sachlogik war indes unabweislich, das politische System wurde blockiert und trudelte dann in den dreißigjährigen deutschen Konfessionskrieg.
Der Versuch der Verrechtlichung des Wahrheitsdissenses ist damals gescheitert
Ist der Augsburger Religionsfrieden an allem schuld? Diese politische Friedenskonzeption eilte ihrer Zeit in mancherlei Hinsicht zu weit voraus. Ob sie gerade deshalb für die moderne Politik von Interesse sein kann? Verschiedene Dauerkonflikte, nicht nur der im Nahen Osten, entwickelten sich in den letzten Jahrzehnten vom Gegeneinander der Nationalismen zunehmend, auf dem Wege einer eminenten Re-Politisierung des Religiösen, zum Gegeneinander religiöser Fundamentalismen. Fundamentalisten lehnen Kompromisse ab – der Augsburger Text erwuchs großer Verhandlungs- und auch einer gewissen Kompromissbereitschaft. Fundamentalismen akzeptieren keine Grenzen – der Religionsfrieden versuchte die vielfältigen Besitzansprüche beider Seiten gegeneinander abzugrenzen. Der Augsburger Religionsfrieden versuchte zu erreichen, was derzeit vielerorts auf der Erde als so dringlich erachtet wird: religiösem Dissens seine politische Brisanz zu nehmen. Allerdings erwies sich der Augsburger Ansatz, das ausschließlich auf dem Wege der Verrechtlichung des Dissenses zu versuchen, als nicht dauerhaft tragfähig.
Warum es 1555 gar keine andere Möglichkeit gegeben hatte
Es gab 1555 gar keine realistische Alternative zum Versuch, den Wahrheitsdissens durch seine Verrechtlichung politisch handhabbar zu machen – durch seine Privatisierung politisch neutralisieren konnte man ihn nämlich nicht. Denn die Säkularisierung des einst christlichen Abendlandes, ob wir sie nun geistesgeschichtlich als Siegeszug der Toleranz beschreiben oder soziologisch als Ausdifferenzierung verschiedener Lebensbereiche, stand 1555 erst noch bevor.
Sie vollzog sich auf langen und verschlungenen Wegen, aber zwei Schübe, die nicht in strikter Scheidung aufeinanderfolgten, sondern gleichsam eine gemeinsame zeitliche Schnittmenge aufweisen, sind hierbei besonders wichtig gewesen: Jene Konfession, die einst alle Lebensbereiche vollständig imprägniert hatte, wurde zunächst einmal [<<56] zu einem öffentlich relevanten Teilbereich gesellschaftlicher Wirklichkeit neben anderen, wie der Politik oder dem Recht, die eigenen Sachlogiken folgen durften – im Fall der Politik der schon um 1620 geläufigen, in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts inflationär beschworenen „Staatsräson“; sie wurde sodann, in einem zweiten lang gestreckten Schritt, einer Privatsphäre zugeordnet, in die die öffentliche Hand gar nicht mehr hineingreifen sollte – Kehrseite dieser neuen Freiräume war eine gewisse Einbuße an öffentlicher Relevanz. Jene „aufgeklärten“ intellektuellen Eliten des 18. Jahrhunderts, die die Weltanschauung zunehmend zur Privatsache erklärt haben, pochten ferner auf Respekt vor Teilwahrheiten und Heilschancen abweichender Glaubensbekenntnisse. Wenn auch andere Religionen Teilwahrheiten enthalten, der Mensch womöglich überhaupt nur Teilwahrheiten erhaschen kann, ist die Ausrottung anderer Weltanschauung nicht mehr sittlich geboten, sondern bei der Wahrheitssuche kontraproduktiv. Wenn jeder seines (irdischen und womöglich ewigen) Glückes Schmied ist, enthebt das den Staat seiner Verantwortung dafür. Jenes Seelenheil der „schäfelein“, das zentrales Anliegen staatlicher Politik im Konfessionellen Zeitalter gewesen war, kann nun der Privatsphäre zugewiesen, damit aus dem Raum des Politischen verbannt werden. Das Staatswohl definiert sich ohne Rücksicht aufs ewige Wohl der Bevölkerung.
Politik, Recht, Glauben; öffentlicher Raum und Privatsphäre: erst solche Segmentierungen erlauben es, die Suche nach Heilswahrheiten dem individuellen Gewissen aufzubürden und das ewige Wohl der Bevölkerung aus den Staatszielen auszuscheiden (womit es auch nicht mehr auf dem Gewissen der Obrigkeit lastet und weshalb es zu befördern nicht mehr als ihre vornehmste Amtspflicht gilt). Indes waren solche Ausdifferenzierungen zwischen Politik, Recht und Theologie in den Jahrzehnten um 1600 nur in den Augen weniger legitim. Für die meisten damaligen Menschen dürften sie noch nicht einmal denkbar gewesen sein. Auch eine konsequente Scheidung von öffentlichem Regelbereich und privatem Rückzugsraum hätten sie sich nur schwer vorstellen können. Ein damaliger Politiker war nicht mit sich im Reinen, wenn er nicht der Wahrheit zum Sieg zu verhelfen und das Seelenheil möglichst vieler Menschen zu ermöglichen suchte: Dieses Kernproblem des konfessionell gespaltenen Reiches konnte [<<57] der Religionsfrieden nicht neutralisieren. Insofern hat er weniger den Konfessionsdissens als den Diskurs über ihn verrechtlicht.
Die Abdankung der Politik zugunsten der Rechthaberei
Die Konfessionsparteien der Jahrzehnte um 1600 kämpften nicht wirklich um Rechtspositionen, sondern im Dienste der von ihnen exklusiv besessenen universalen Wahrheit, sie kämpften um Seelen. Weil aber 1555 besiegelt worden war, dass der diskursive Austausch mit dem Widerpart auf der Bühne der Reichspolitik in den Begrifflichkeiten des Rechts erfolgte, weil die 1555 festgelegte diskursive Währung Paragrafen des Religionsfriedens auf die Verhandlungstische packte und nicht Glaubensartikel, hatte man die eigenen Wahrheiten als einzig wahre Auslegungen der Augsburger Ordnung zu verfechten.
Den damaligen Akteuren zu unterstellen, dass sie den Religionsfrieden dabei zynisch missbraucht, dass sie einfach verlogene Schlagworte vor sich hergetragen hätten, wäre unangemessen – nicht, weil Menschen des Konfessionellen Zeitalters edler und wahrhaftiger gewesen wären als der kapitalistische Homo oeconomicus (wer wollte das ermessen!), aber weil bei ihnen Recht, Politik und Theologie – in modernen Augen verschiedene Sachgebiete mit ihren je eigenen Sachlogiken – eben völlig ineinander verschränkt waren. Diese Menschen fochten für viel mehr als ‚nur‘ für Rechtspositionen, doch spricht nichts dafür, dass sie nicht davon überzeugt gewesen wären, dass das Recht auf ihrer Seite stand. Sie kämpften für ihr gutes Recht, von dem sie schon deswegen nicht abrücken konnten, weil es auf ihre Wahrheit und ihre Gerechtigkeit verwies. Weil man mit jeder Nachgiebigkeit auf dem juristischen Kampfplatz Seelenheil verspielte, konnte man nicht „durch die finger sehen“, wie das die Jahrzehnte um 1600 formulierten, konnte man, modern gesagt, nicht einfach bisweilen „alle Fünf grade sein lassen“, musste man vielmehr unerbittlich auf seinen Paragrafen herumreiten. Eben deshalb wirkte die „Verrechtlichung“ eines zentralen Problems der Reichspolitik in diesem Fall nicht befriedend.
Die 1555 ausgeklammerte Wahrheitsfrage drängte ein halbes Jahrhundert später machtvoll in die gelehrten und die politischen Diskurse zurück. Es wurde immer schwieriger, einen Kernbereich reichspolitischen Aushandelns und reichspolitischen Krisenmanagements gegen das anbrandende Wahrheitsproblem, die Konkurrenz eines doppelten, je exklusiven Wahrheitsmonopols abzuschirmen. Die [<<58] Verrechtlichung des Konfessionsdissenses mündete in die Abdankung der Politik zugunsten der Rechthaberei.
Setzt interkonfessioneller Frieden „Aufklärung“ und ein „liberales“ Menschenbild voraus?
Ob man wirklich aus der Geschichte – oder doch nur aus eigenen Fehlern lernen kann? Lernen wir aus der Geschichte, dass haltbare interkonfessionelle Friedensschlüsse nur zwischen Bekenntnisgemeinschaften möglich sind, die ihre Phase von „Aufklärung“ durchlaufen haben? Gar nur zwischen Gesellschaften mit individualistischer, liberal imprägnierter Anthropologie, die – mit vielen anderen Lebensbereichen – auch die Weltanschauung gleichsam privatisiert (oder doch, wie hier in Deutschland, jedenfalls teilprivatisiert) haben? Wissenschaftlich stringent beantworten kann Geschichtsschreibung solche Fragen nicht, sie kann sie nur aufwerfen.
1.5 Die böhmischen Anlässe des Dreißigjährigen Krieges
1.5.1 Rückblicke: lange Tradition konfessioneller Heterogenität und ständischer Aufmüpfigkeit
Dass die Funken, die seit 1620 Teile Europas in Brand setzten, aus Böhmen herüberwehten, ist ganz zufällig – wir sahen, dass das Reich ein Pulverfass war, das sich schon 1610 beinahe an niederrheinischem Konfliktpotenzial entzündet hätte. Dass die Funken, die seit 1620 Teile Europas in Brand setzten, aus Böhmen herüberwehten, ist höchst bezeichnend – auch so kann man es sehen: eine Frage der Perspektive.
Warum könnte man denn Böhmen gewissermaßen für seine Rolle prädisponiert sehen? Nun, zwei große politische Themen der Jahrzehnte um 1600, wohl die damals zentralen, waren erstens der Widerstreit der Konfessionen, zweitens der Widerstreit zwischen erstarkender Zentralgewalt im Vorhof des „Absolutismus“ und ständischen Partizipationsansprüchen. (Der Schulbüchern geläufige Terminus „Absolutismus“ gefällt vielen Wissenschaftlern nicht mehr als Epochenbegriff, manche verwenden den Terminus überhaupt nicht mehr – kein Thema für dieses Büchlein, das es, manchmal in Anführungszeichen, beim „Absolutismus“ belässt, schon weil sich bislang keine griffige Alternative etabliert hat.) Böhmen hatte damals eine schon lange Tradition weltanschaulicher Heterogenität; und es hatte ungewöhnlich [<<59] selbstbewusste Stände. Die beiden großen Antagonismen der Zeit waren in Böhmen schon seit Generationen virulent, wurden hier auf engem Raum ausgefochten. Zeittypisch waren der Kampf um Seelen und das Ringen um die Macht ineinander verknäuelt. Dennoch: Trennen wir beide Aspekte einmal der Übersichtlichkeit halber voneinander!