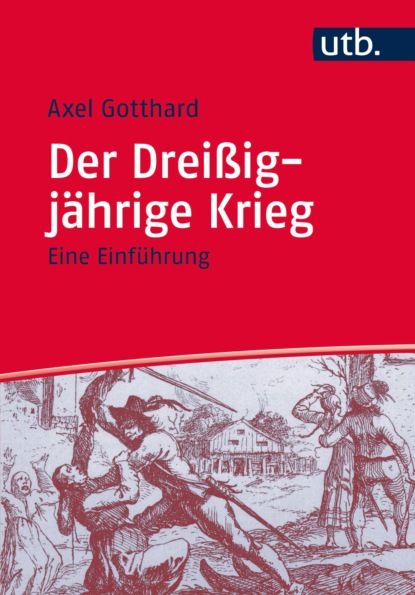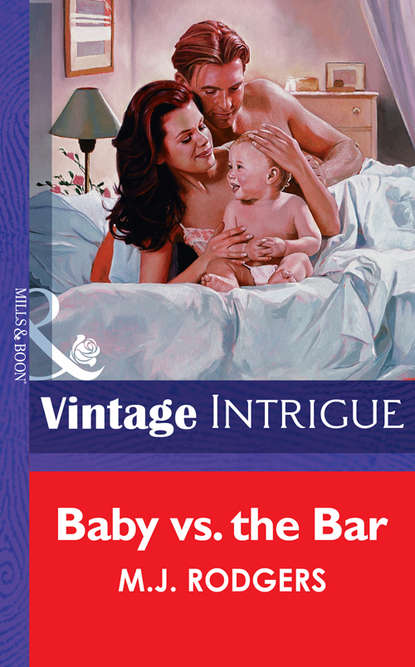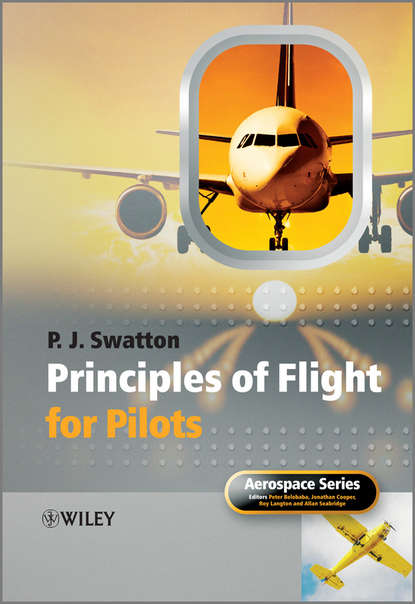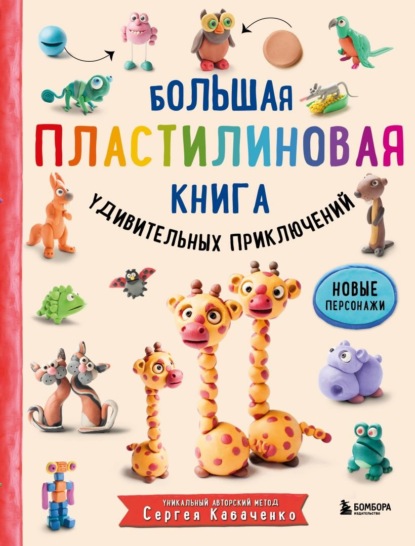- -
- 100%
- +
Warum die böhmischen Stände traditionell stark sind
Warum waren denn die böhmischen Stände besonders stark und selbstbewusst? Zum einen waren die Stände überall in Mittelosteuropa stark. Es hat auch ökonomische Gründe. Anders als die „Grundherren“ Westeuropas, die fast alles Land an weitgehend selbstständig arbeitende Bauern verliehen, bewirtschafteten die ostmitteleuropäischen Magnaten mithilfe der „niedergelegten“, faktisch zu Lohnarbeitern heruntergedrückten einstigen Bauern riesige Ländereien. Sie agierten dabei sprichwörtlich „nach Gutsherrenart“, ließen sich von der schwachen Zentrale nicht dreinreden. Bei den Ständen Habsburgs kam ein Zweites hinzu: Die Habsburgerlande grenzten ans osmanische Riesenreich, die „Türkengrenze“ lief mitten durch Ungarn, Böhmen war nicht weitab. Die Habsburger brauchten die Mitwirkung und Zahlungsbereitschaft ihrer Stände, waren gleichsam erpressbar. Die Stände hat auch dieser enorme Geldbedarf der Zentrale stark gemacht.
Die Steuerverwaltung war ständisch, wie vielerorts; auch die Aufbringung und Verwendung der indirekten Steuern, andernorts Ansatzpunkt frühabsolutistischer Vorstöße der Landesherren, war unter den Habsburgern Ständesache. Nicht einmal Kriegsherren waren die Habsburger unumschränkt, man war dort als Militär nicht habsburgischer, sondern „der Landschafft Kriegs officir“, der ständische Einfluss auf die „Landesdefension“ war groß. Sogar außenpolitisch wurden die Landstände bisweilen aktiv – so verhandelten sie beispielsweise in den Anfangsjahren der Union (wenn auch ohne bleibende Resultate) mit Vertretern dieses Konfessionsbündnisses über Kooperationsmöglichkeiten.
Kurz, die habsburgischen (auch, und zumal die böhmischen) Landstände agierten, als seien sie Reichsstände, eigene Herrschaftsträger. War es nicht ein signifikanter Unterschied, dass sich die Reichsstände zwar einem Habsburger unterstellten, den aber als Reichsoberhaupt frei und zu ihren – in der Wahlkapitulation festgehaltenen – Bedingungen wählten, während Böhmen Erbbesitz der Dynastie war? Sogar dieses Erbrecht der Habsburger wurde immer wieder angezweifelt [<<60] oder relativiert. So führte man bei jedem Herrscherwechsel Huldigungsverhandlungen – man stellte also seine Bedingungen für die ‚Unterwerfung‘, eben die Huldigung. Oder man behauptete ganz offen, die böhmische Krone sei tatsächlich eine Wahlkrone; Matthias (Böhmenkönig seit 1611) musste ein Dokument unterzeichnen, das seine Nachfolge als „freie Wahl“ der Landstände deklariert. Es gab unter den Landständen in dieser Frage drei Positionen: ein kleines Häuflein, das der Erbkrone das Wort redete; gemäßigte Anhänger der Wahlkrone; und radikalere. Letztere behaupteten, „Wahl“ meine nicht nur Auswahl innerhalb der angestammten Dynastie, sondern beinhalte auch die Möglichkeit des Dynastiewechsels.
Hinzu kommt, dass die im Konfessionellen Zeitalter so zentrale Kirchengewalt traditionell eher ständisch als landesherrlich war. Ungefähr vier Fünftel der von den katholischen Habsburgern regierten Adeligen waren im 16. Jahrhundert evangelisch geworden, sie nötigten diese Option auch ihren Hintersassen auf; was die Regierungen durch weitreichende Konzessionen absegneten. Faktisch besaß also in den Habsburgerlanden nicht die Landesherrschaft, sondern der landständische Adel das Ius reformandi.
Warum Böhmen schon lange nicht mehr geschlossen katholisch ist
Jetzt sind wir fast unvermerkt doch schon beim zweiten Aspekt angekommen: der konfessionellen Ausrichtung. Die meisten böhmischen Adeligen waren keine Mitglieder der römischen Kirche. Welcher Konfession gehörten sie denn an? Nun, zum Teil tendierten sie zu den neueren europäischen Reformationsströmungen (wie dem Calvinismus oder, häufiger, dem Luthertum); zum Teil standen sie in der älteren, einheimischen hussitischen Tradition.
In Böhmen gab es nämlich schon hundert Jahre vor der Publikation der lutherschen Ablassthesen Nichtkatholiken. Ein Prager Prediger, Jan Hus, fand mit seinen kirchenkritischen, in manchem die lutherische Reformation vorwegnehmenden Ansichten begeisterte Zustimmung. 1414 wurde er zum Konzil nach Konstanz geladen, mit einem Geleitbrief, der ungestörtes Reisen und ungehinderte Anhörung in Konstanz garantierte – und doch wurde er dort, am Bodensee, verhaftet und verbrannt. Jan Hus ist tot – der Hussitismus setzt sich in Böhmen weitgehend durch. Übrigens sah der damalige Kampf um Prag einen „Fenstersturz“: Einige reformunwillige Ratsherren stürzten in den Burggraben. Die Hussiten gewannen in Prag und anderswo, [<<61] genauer: ihr gemäßigter Flügel, die sogenannten „Utraquisten“. Es ging keine Sprengwirkung davon aus, die Bewegung, pointiert tschechisch von Anfang an, expandierte nicht in andere Teile Europas – anders als hundert Jahre später das Luthertum, dann der Calvinismus. Aber geschlossen „römisch-katholisch“ war Böhmen schon hundert Jahre vor Luther nicht mehr.
Böhmen als Bestandteil der habsburgischen Composite Monarchy
Freilich kam das Land dann in die Hände einer erzkatholischen Dynastie: der Habsburger. Im Jahr 1526 fiel der letzte Jagiellonenkönig im Kampf gegen das Osmanische Reich. Die Habsburger erhoben Erbansprüche auf die Kronen Ungarns und Böhmens, die Stefans- wie die Wenzelskrone. Den Anspruch auf Ungarn konnten sie nur zum kleinen Teil realisieren, sie regierten einen schmalen westlichen Gebietsstreifen, den Rest besetzte das Osmanische Reich. Mit der Stefanskrone hat das Haus Habsburg die welthistorische Aufgabe geerbt, das christliche Abendland gegen einen immer wieder die Expansion suchenden Islam zu verteidigen. Genau deshalb wird es in den nächsten beiden Jahrhunderten wieder und wieder den Kaiser stellen: In kurfürstlichen Wahlgutachten steht stets dieser Gesichtspunkt (wer kann das Alte Reich am wirkungsvollsten vor dem islamischen „Türken“ schützen?) im Zentrum.
Zu den Ländern der Wenzelskrone gehörte Böhmen. Dieses Königreich war nun habsburgisch, geschlossen römisch-katholisch wurde es deshalb (wie wir soeben schon sahen) noch lange nicht. Im Gegenteil, zu den alten hussitischen traten neue lutherische, später calvinistische Einflüsse. Mit der „Confessio Bohemica“ gaben sich die verschiedenen nichtkatholischen Bewegungen 1575 eine gemeinsame Rahmenordnung. Sie sollte politische Verhandlungen mit der Landesobrigkeit erleichtern, also politisch und nach außen wirksam sein, nicht die konfessionellen Binnenunterschiede einebnen.
Lang musste Habsburg zusehen, aber nicht ewig. Die Habsburgerlande gehörten zu denjenigen Gebieten, in denen der nachtridentinische Kampfkatholizismus seit den 1570er-Jahren am frühesten und entschiedensten Terrain zurückeroberte.
„Die Habsburgerlande“: Warum steht das hier im Plural? Nun, es handelt sich um eine „composite monarchy“. Solche „dynastische Unionen von Ständestaaten“ (wie der ältere deutsche Ausdruck hierfür lautet) waren im vormodernen Europa nicht untypisch: Territorien mit [<<62] ganz unterschiedlichen kulturellen Traditionen und administrativen Strukturen werden auf der obersten staatsrechtlichen Ebene dadurch verklammert, dass sie von Mitgliedern ein und derselben Dynastie regiert werden. Im zuletzt gestreiften Zeitraum der habsburgischen Gegenreformation gab es fast durchgehend drei regierende Habsburger, dementsprechend drei größere Happen vom Gesamtbesitz, die jeweils in sich mehrere historische Landschaften vereinten. Erstens sprach man von „Niederösterreich“ – meinte: die Erzherzogtümer Österreich ob der Enns (Hauptort Linz) und unter der Enns; Regierungssitz war Wien. Der dort residierende Erzherzog regierte außerdem, unter der Wenzelskrone, die böhmischen Länder: das Königreich Böhmen, die Markgrafschaft Mähren, das Herzogtum Schlesien, die Markgrafschaften Nieder- und Oberlausitz. Und er regierte ferner, unter der Stefanskrone, das „Königliche Ungarn“ (also jenen schmalen westlichen Teil von Ungarn, der nicht vom Osmanischen Reich besetzt war). Zweitens gab es „Innerösterreich“: die Herzogtümer Steiermark, Kärnten, Krain und einige kleinere Gebiete wie die Grafschaft Görz oder die Markgrafschaft Istrien, Regierungssitz war Graz. In unserem Zeitraum regierte sodann fast immer, und zwar von Innsbruck aus, ein weiterer, dritter Habsburger Oberösterreich (dessen Kernland Tirol war) sowie Vorderösterreich (also den Streubesitz im heutigen Oberschwaben sowie den Breisgau).
Energische habsburgische Gegenreformation
In fast allen Landesteilen (am wenigsten in Oberösterreich) fanden evangelische Anschauungen zeitweise großen Anklang. In den späten 1570er-Jahren setzte indes die habsburgische Gegenreformation ein. Sie zeitigte insgesamt große Erfolge, am durchschlagendsten in Innerösterreich; auch in Böhmen erstarkte der Katholizismus unübersehbar. Dann freilich schienen mehrere Turbulenzen die habsburgischen Terraingewinne infrage zu stellen: der Lange Türkenkrieg (1593–1606), der Bocskay-Aufstand sowie der „Bruderzwist“ im Hause Habsburg. Damit bewegen wir uns endlich wieder in den Jahren um und nach 1600.
1.5.2 Der „Bruderzwist“ im Hause Habsburg
Die Probleme: Langer Türkenkrieg, Aufstand in Ungarn
Es hat die energische habsburgische Gegenreformation zunächst begünstigt, dass gerade keine gezielten osmanischen Expansionsversuche abzuwehren waren – also ‚lediglich‘ die notorischen kleineren [<<63] Grenzscharmützel. Aber seit 1593 band die Türkenfront wieder erhebliche Mittel. In ihrem Rekatholisierungseifer verprellte die rudolfinische Regierung die von Truppendurchmärschen, türkischer Streifzüge wegen, aber auch finanziell ohnehin schon schwer belasteten Untertanen im Königlichen Ungarn, die sich schließlich von Habsburg abwandten, in einem lockeren Vasallenverhältnis zur Pforte das kleinere Übel sahen: Bocskay-Aufstand (1604–1606), es droht eine Sezessionsbewegung weg von Habsburg.
Das ist der Anlass für die Eskalation des „Bruderzwists“ im Hause Habsburg. Die altertümlich klingende Bezeichnung geht auf den wahrscheinlich bedeutendsten österreichischen Dramatiker zurück, auf Franz Grillparzer, und sein nach einhelligem Urteil der Literaturgeschichten wichtigstes, 1848 niedergeschriebenes Drama „Ein Bruderzwist in Habsburg“. Es handelt sich, auf der Bühne wie in der Realität des frühen 17. Jahrhunderts, um einen in den äußeren Abläufen verwickelten Streit zwischen Rudolf und den anderen führenden Habsburgern, so insbesondere Maximilian, Matthias und Ferdinand. Die zuletzt Genannten werden dann ja übrigens nacheinander die beiden Nachfolger Rudolfs als Kaiser sein.
Die Sorge: Rudolf sei diesen Herausforderungen nicht gewachsen
Der „Bruderzwist“ erwuchs, ganz allgemein formuliert, der Furcht der anderen maßgeblichen Habsburger, Rudolf verspiele die Position der Dynastie in Europa, sei insbesondere der Türkengefahr nicht gewachsen. Man bekam ja an den anderen habsburgischen Residenzen mit, wie es um Rudolfs Gesundheit, auch seine geistige und psychische, bestellt war. Alle Einzelheiten sind für uns entbehrlich; die Eskalation der längst notorischen untergründigen Spannungen leitete der Bocskay-Aufstand ein. Rudolf sah sich genötigt, Matthias zu seinem Statthalter in Ungarn zu ernennen. Er konnte damit nicht mehr verhindern, dass ihm die Brüder im Wiener Abkommen vom April 1606 die Regierungsfähigkeit absprachen; sie erklärten Matthias zum Chef des Hauses und beauftragten ihn, Frieden sowohl mit dem Führer der ungarischen Aufständischen, István Bocskay, als auch mit den Türken zu schließen.
Friedensschlüsse von Wien und Tzvita-Torok
Beides gelang Matthias noch 1606. Der Frieden von Wien mit den ungarischen Aufständischen gewährte große ständische und konfessionelle Freiräume, was den Oppositionsgeist auch der Stände der anderen habsburgischen Länder anstacheln musste; anstelle seines von [<<64] den Ständen abgelehnten Bruders übernahm Matthias die Leitung der Regierung in Ungarn. Der Frieden von Zvita-Torok beendete 1606 den Langen Türkenkrieg. Das ist nicht nur wegen des „Bruderzwists“ wichtig: Denn der Frieden wird währen, über ein halbes Jahrhundert lang, die vordem so bedrängende Sorge vor „türkischen“ Heereszügen konnte zur Memoria verblassen. Und: man stelle sich vor, die Osmanen hätten im Dreißigjährigen Krieg mitgemischt! Aber es sind auch desintegrierende Effekte plausibel (die sich den Zeitgenossen nicht erschließen konnten). Fiel da mit einer gewissen Stabilisierung der Türkengrenze nicht auch Einigungsdruck weg? Entfiel da ein Gefahrenszenario, das bislang dazu animiert hatte, sich an Reichstagen, über allen konfessionellen Hader hinweg, doch am Ende irgendwie zusammenzuraufen und dem Kaiser seine Reichssteuer zu bewilligen, weil die Notwendigkeit, sich dem expansiven Islam entgegenzustemmen, ja auch allen Protestanten einleuchtete? Ist das Fiasko des Reichstags von 1608 auch vor diesen Hintergrund zu stellen?
Der Aufstieg des Matthias; Rudolfs Hausmacht bröckelt
Was in den Augen der Brüder der dynastische Überlebenswille diktierte, addierte sich in Rudolfs Augen zu lauter dreisten Anschlägen auf seine Position. Mit dem Verlust Ungarns begann seine Hausmacht zu bröckeln, und seinem kaiserlichen Renommee konnte nicht zuträglich sein, dass der Bruder den Frieden mit den störrischen Ständen, sogar mit den Osmanen geschlossen hatte. Rudolf zog zuerst die Ratifizierung der Verträge hin, hintertrieb anschließend ihre Realisierung – die innerhabsburgischen Spannungen eskalierten erneut, schließlich marschierte Matthias mit Heeresmacht gen Prag. Wir müssen auch jetzt keine Einzelheiten des multiplen Intrigenspiels kennenlernen, nur das Resultat: Rudolf hatte 1609 neben der Kaiserwürde lediglich noch Böhmen inne. Den Löwenanteil der Habsburgerlande regierte nun Matthias. Übrigens wird auch Böhmen noch an ihn fallen, in den letzten Monaten vor seinem Tod im Januar 1612 ist Rudolf ‚nur‘ noch Kaiser, also gewähltes Reichsoberhaupt, ohne über habsburgischen Erbbesitz zu regieren.
Eigentlicher Gewinner des „Bruderzwists“ scheinen die Stände zu sein
Matthias, der Gewinner des „Bruderzwists“? So kann man es sehen, vor allem aber stärkte diese innerdynastische Rivalität die Landstände. Im „Bruderzwist“ waren alle Seiten auf ihre Unterstützung angewiesen, sie konnten ihre Bedingungen stellen. Es kam zu einer kurzlebigen Renaissance sowohl des Protestantismus als auch ständischer [<<65] Freiheiten. Alle Fortschritte des Katholizismus wie der Zentralgewalt schienen wieder zunichtegemacht.
So auch in Böhmen. Die dortigen Stände trotzten Rudolf (der ja ihre Hilfe gegen Matthias benötigte) 1609 den „Majestätsbrief“ ab – es war ein ultimativ überreichter ständischer Gesetzesentwurf, der große konfessionelle Spielräume vorsah. Er sprach allen Bewohnern Böhmens die freie Auswahl zwischen dem katholischen Bekenntnis und der Confessio Bohemica zu. Adel und königliche Städte dürften, so der Majestätsbrief, evangelische Gottesdienste veranstalten, dürften Kirchen bauen und Schulen einrichten, Geistliche und Lehrer ernennen; Ansätze zu einer überlokalen, ja sogar überregionalen evangelischen Kirchenorganisation wurden dadurch abgesichert, dass der Majestätsbrief ein Konsistorium (eine oberste geistliche Aufsichtsbehörde) zugestand. Mit dem Schutz der ständischen Rechte, insbesondere natürlich des Majestätsbriefs selbst, wurde eigens ein Ständegremium beauftragt, sozusagen eine oberste Beschwerdestelle – die sogenannten „Defensoren“ (lat. defensor = Verteidiger, Beschützer). Mit dem Majestätsbrief hatte die böhmische Krone das Kirchenregiment weitgehend aus der Hand gegeben.
Es sind Streitigkeiten über die rechte Auslegung des Majestätsbriefs, die in Böhmen in den letzten Vorkriegsjahren die Atmosphäre vergiften, und auch den „Defensoren“ werden wir bei den Ereignissen, die zum „Fenstersturz“ hinführen, wieder begegnen.
1.5.3 Streit um den Majestätsbrief
Die vom Majestätsbrief geweckten ständischen und konfessionellen Hoffnungen schlugen in den Jahren vor dem Prager Fenstersturz im Mai 1618 in wachsende Frustration um. Bei Rudolfs Tod im Januar 1612 fühlten sich die böhmischen Stände stark. Sie wollten ihren neuen König, Matthias, sogar zur Unterzeichnung eines Reverses zwingen, der ihnen das Recht zusprach, jederzeit zur Verteidigung der von Rudolf verbrieften konfessionellen wie libertären Standards Truppen aufzustellen, ferner ein Bündnis mit den ungarischen und österreichischen Ständen einzugehen. (Ein Versprechen, ständische Privilegien zu achten, nannte man in der Vormoderne „Revers“.) Matthias wollte einerseits nicht sogleich auf Konfrontationskurs gehen, dachte [<<66] andererseits gar nicht daran, seine Unterschrift unter den Revers zu setzen, und verzichtete deshalb sogar zunächst auf die Erhebung von Steuern – denn dafür hätte es eines Landtags bedurft, und dort wäre Matthias absehbar mit besagtem Dokument konfrontiert worden, mit der Forderung nach Defension und Konföderation.
Generallandtag 1615: unerwartete ständische Schwächen
Die weiterhin instabile Lage auf dem Balkan zwang Matthias schließlich 1614 doch zur Einberufung eines Generallandtags der von ihm regierten Länder in Linz. Heraus kam für ihn nichts, all die ansonsten divergierenden ständischen Kräfte einte die Opposition zum Haus Habsburg. Dem war nicht mehr so, als Matthias im Juni 1615 erneut zum Generallandtag, nun in Prag, lud. Die Exponenten des böhmischen Ständetums hofften auf eine Demonstration ständischer Stärke, oppositioneller Eintracht – und erlebten ihr Debakel. Aus Ungarn kam erst gar niemand, weil die ungarischen Magnaten darüber enttäuscht waren, dass die anderen Länder zögerten, sich an den hohen Kosten für die Stabilisierung der Türkengrenze zu beteiligen. Die Österreicher kamen, lehnten auch ein Bündnis mit den Böhmischen nicht geradewegs ab, wohl deren Führungsanspruch. Schlimmer noch war, dass sogar Mährer, Schlesier und Lausitzer opponierten – nicht gegen Habsburg, sondern ebenfalls gegen die böhmischen Standesgenossen. Die rissen alles an sich, wollten Nebenländer wie Mähren überspielen, wollten, wie der mährische Ständeführer Karl von Zierotin monierte, „selbst der Kopf sein und wir sollen der Schwanz bleiben“. Karl von Zierotin war aber auch für einen anderen Kurs den Habsburgern gegenüber, plädierte für mehr Vorsicht, weniger Konfliktbereitschaft. Habsburg konnte es recht sein.
Anders, natürlich, den Konfliktbereiten unter den Ständevertretern, die es nicht ausschließlich in Böhmen, aber doch vor allem dort gab. Sie verzweifelten an ihren ständischen Mitstreitern, versuchten auf eigene Faust, Fäden mit dem europäischen Ausland, zum Beispiel mit den Heidelbergern, anzuknüpfen, und steigerten sich in eine Stimmung hinein zwischen Verzweiflung und Wut, was die Bereitschaft befördern konnte, eben – eine Verzweiflungstat zu begehen, da man ja doch nichts mehr zu verlieren habe. Das wird für die Ereignisse des Jahres 1618 noch wichtig werden.
Habsburg setzt nach
Wiewohl nur noch zehn bis 15 Prozent der Einwohner Böhmens katholisch waren, sah sich Habsburg nach dem ständischen Debakel [<<67] von 1615 zum Nachsetzen ermuntert. Scharfmacher war gar nicht so sehr Matthias selbst, auch nicht sein wichtigster Berater in Wien, Melchior Khlesl. Es gab vor Ort, in Prag, einige forsche, forciert katholische Mitglieder des Statthalterrats, dort wurden Strategie und Taktik der erneuten Gegenreformation Böhmens ausgetüftelt. Aber Gegner des katholischen Rollback in Böhmen war Matthias keinesfalls. Prag und Wien gingen die Rekatholisierung Böhmens systematisch an und mit langem Atem, auch auf vielen Wegen – die beiden wohl wichtigsten waren konsequent katholische Ämterbesetzungen und die immer restriktivere Auslegung einmal eingeräumter Konzessionen. Die Gegenreformatoren im Hradschin und in der Hofburg saßen, salopp gesagt, am längeren Hebel – arbeiteten nämlich kontinuierlich am ihnen vor Augen stehenden Ziel eines zentral gelenkten katholischen Staatswesens, während sich die (zudem zerstrittenen) Stände ja nur sporadisch trafen.
Wir wissen schon vom Interpretationskrieg um den Augsburger Religionsfrieden in den Kerngebieten des Reiches. Auch der böhmische Majestätsbrief bot einen Ansatzpunkt für gegenreformatorische Auslegungskünste. Klar formuliert war die Wahlfreiheit zwischen katholischem Bekenntnis und Confessio Bohemica, aber um seinen Glauben auch auszuüben (jedenfalls in den Formen der damaligen Zeit), brauchte man Kirchen. Der Majestätsbrief konzedierte den utraquistischen Ständen, dass sie, so sie neue Kirchen für angebracht hielten, solche errichten lassen dürften. Auch auf königlichem Grund, also auf Boden, der privatrechtlich der Krone gehörte? Der Majestätsbrief nimmt ihn nicht aus, ja, im Vergleich zwischen den evangelischen und den katholischen Ständen Böhmens vom selben Tag heißt es: Wenn die Utraquisten „in einem Ort oder einer Stadt, ja selbst auf den Gütern sowohl des Königs wie der Königin“ keine Kirche besäßen, dürften sie eine solche „nach dem Wortlaute des Majestätsbriefes“ erbauen lassen.
Eine gegenreformatorisch nutzbare Lücke im Majestätsbrief
Wie aber verhielt es sich mit Ländereien der Prälaten (also der führenden Geistlichkeit)? Für die böhmischen Protestanten gab es solche geistlichen Güter gar nicht, sie subsumierten diese Gebiete dem Königsgut – die Krone habe eben Teile dieses Königsguts vorübergehend klerikaler Verwaltung überlassen. Die Katholiken sahen das anders, und wenn man ihre Sicht übernimmt, tut sich [<<68] im Majestätsbrief eine Lücke auf. Er bestimmt nicht das Verhältnis zwischen dem hehren Prinzip der Glaubensfreiheit und ganz normalen Besitzrechten (in diesem Fall: der Prälaten über ihre Vermögensmasse). Auf Letztere nämlich geht der Majestätsbrief gar nicht ein, aber die Prälaten reklamierten sie für sich.
Darum also drehte sich der Streit allgemein, konkret waren vor allem zwei Kirchenbauten in Nordböhmen umstritten. In Braunau (heute Broumov) hatten Lutheraner eine Kirche auf Landbesitz des dortigen Benediktinerklosters errichtet; der Abt erklärte, der ihm missliebige Bau auf seinem Grund und Boden sei zu verschließen. Die Prager Statthalterregierung wies die Braunauer schließlich an, den Kirchenschlüssel im Kloster abzugeben, und ließ einige Lutheraner, die sich deswegen in Wien bei Matthias beschwert hatten, kurzerhand arrestieren. In Klostergrab (heute Hrob) ließ der Prager Erzbischof die evangelische Kirche einfach abreißen, weil sie auf seinem Grund und Boden stehe; war die Berechtigung dieser drastischen Maßnahme noch Auslegungssache, verstieß sein Verbot, weiterhin evangelische Gottesdienste zu veranstalten, eindeutig gegen den Majestätsbrief. Allerlei kleinliche Schikanen im ganzen Land kamen hinzu – die Regierung zog, sichtlich ermuntert durch das Debakel des Generallandtags von 1615, die Daumenschrauben an.
Ferdinand wird als künftiger König „angenommen“
Die landständische Opposition war zornig, aber sie war auch eingeschüchtert. Im Juni 1617 gelang es der Regierung, die Nachfolge vorzeitig abzusichern, den konfessionspolitisch bekanntermaßen unnachgiebigen Ferdinand als künftigen böhmischen König zu installieren. Er wurde vom Landtag nicht etwa gewählt, sondern „angenommen“: Die Regierung ließ sich ihren Erbrechtsanspruch von den Ständevertretern einzeln, durch namentlichen Aufruf Mann für Mann, bestätigen. Es war eine demütigende Machtdemonstration. Sie hatte eine bemerkenswerte Vorgeschichte – schon im Vorfeld des Landtags und dann wieder am Tag der Eröffnung wurde den Ständischen auf der Böhmischen Kanzlei klargemacht: Wenn sie etwa an Ferdinands Erbrecht zweifelten, „dann wäre es für sie besser, sie hätten zwei Köpfe“ (zit. nach Bernd Rill). Die Böhmischen ließen ihren Mut sinken, bevor noch Köpfe zu Boden fielen.
Welcher Ruf Ferdinand vorauseilt
Der künftige Böhmenkönig würde also Ferdinand heißen. Jeder überzeugte Protestant konnte sich ausrechnen, dass unter ihm alles [<<69] nur noch schlimmer würde. Weil uns dieser Ferdinand als Kaiser des Dreißigjährigen Krieges noch häufig begegnen wird, lohnt eine kurze Charakterisierung. Er war geistig eher schwerfällig, aber sehr gewissenhaft und sehr, sehr fromm. Stunden verbrachte er täglich in Andacht und Gebet, der Einfluss seiner – durchgehend jesuitischen – Beichtväter war groß; auch auf die Politik: Ferdinand versicherte sich vor wichtigen Entscheidungen grundsätzlich des Standpunkts der Theologen, ging zusammen mit dem momentanen Beichtvater auf Gewissenserforschung. Die politischen Ratgeber hatten die Zweckmäßigkeit einer Maßnahme zu beurteilen, die geistlichen Berater die Übereinstimmung mit Naturrecht und göttlichem Gebot. War eine Entscheidung dann einmal – selten schnell – gefällt, zog Ferdinand das als richtig Erkannte mit der Unerschütterlichkeit dessen durch, der sich in einer unruhigen Zeit mit sich selbst und seinem Herrgott im Reinen weiß. Sein Amt war ihm göttlicher Auftrag, er war vom Himmel nicht an die Spitze seiner Herde gestellt worden, um dort gotteslästerliche Ketzerei zu dulden. Schon als Jugendlicher hatte er sich durch verschiedene Gelübde auf unerbittlichen Glaubenskampf verpflichtet, so soll er auf einer Pilgerfahrt zu Unserer Lieben Frau von Loreto geschworen haben, lieber über eine Wüste als über Ketzer zu herrschen.