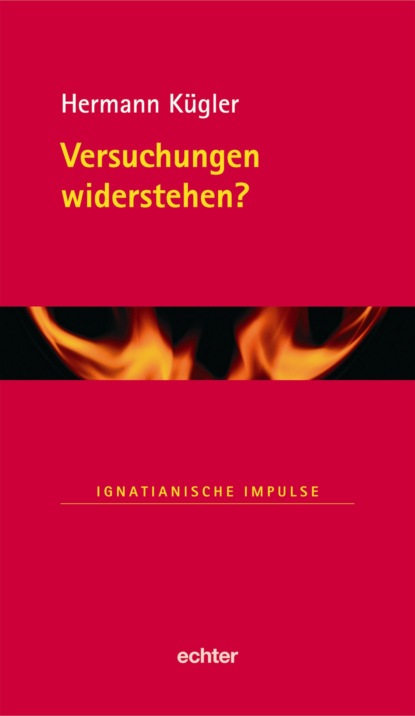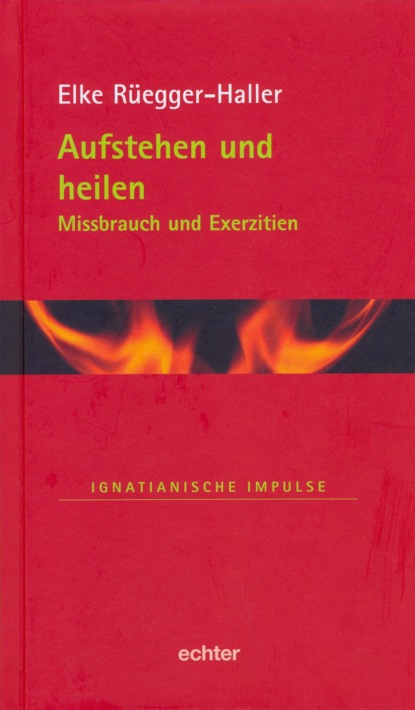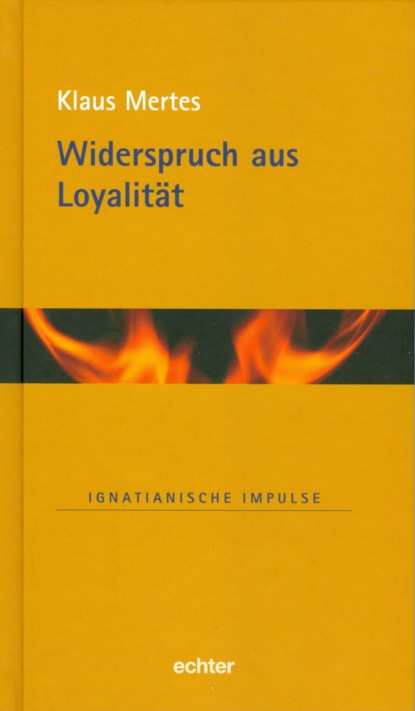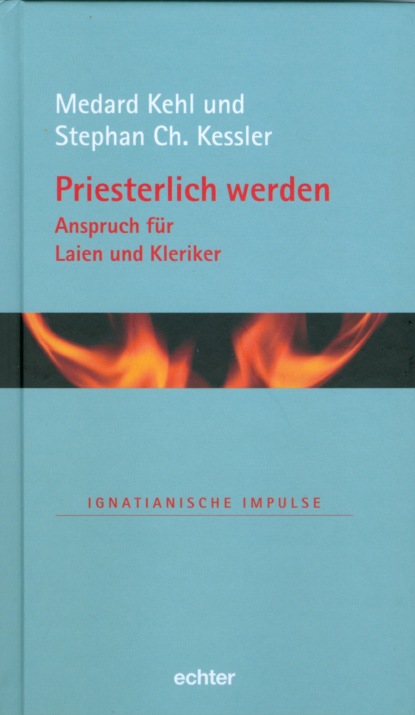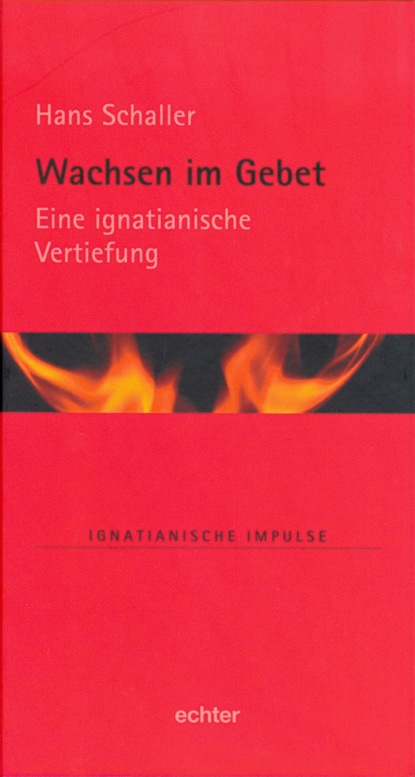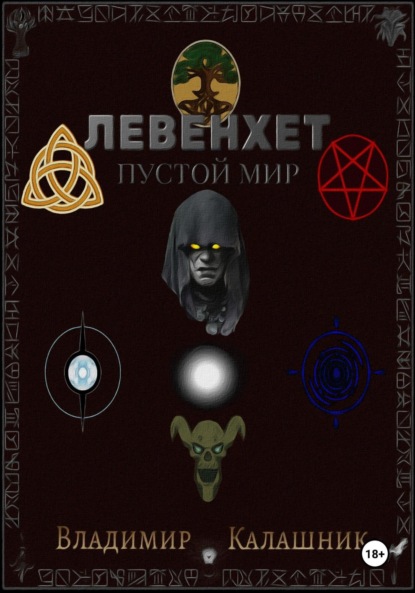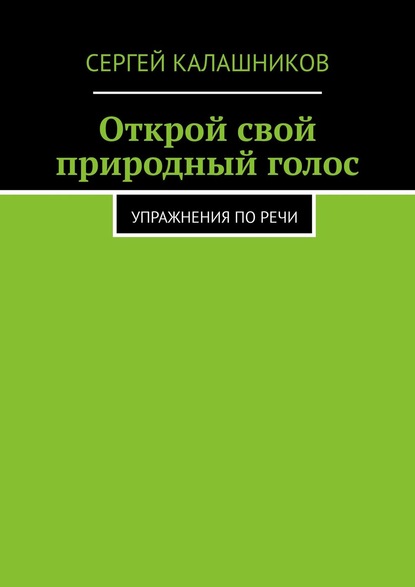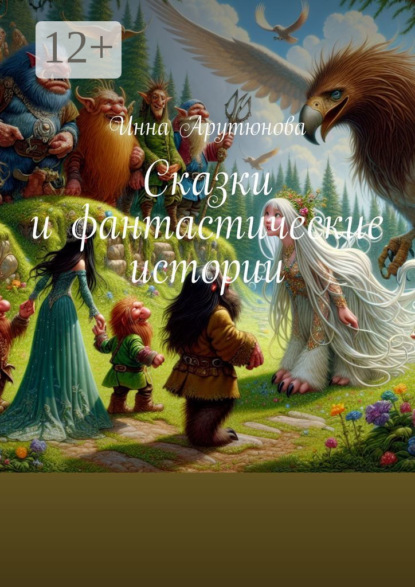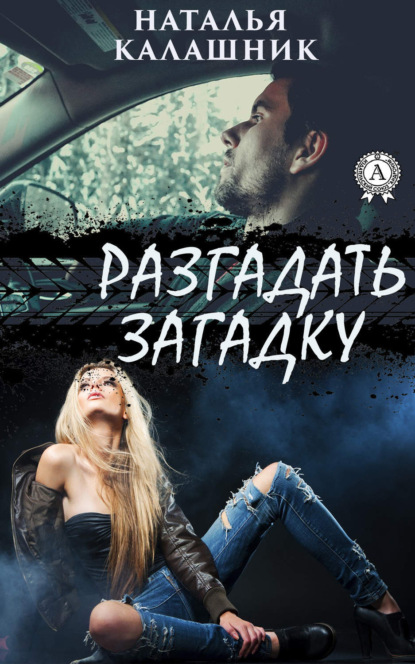Mit Charme gewinnen - kämpfend vorangehen
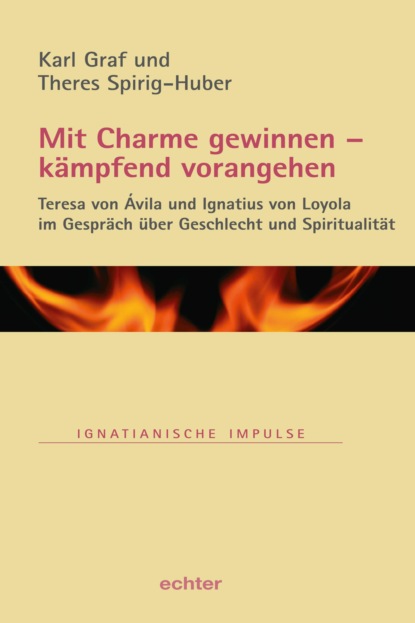
- -
- 100%
- +

Karl Graf und Theres Spirig-Huber
Mit Charme gewinnen – kämpfend vorangehen
Teresa von Ávila und Ignatius von Loyola
im Gespräch über Geschlecht und Spiritualität
Ignatianische Impulse
Herausgegeben von Stefan Kiechle SJ, Willi Lambert SJ
und Stefan Hofmann SJ
Band 87
Ignatianische Impulse gründen in der Spiritualität des Ignatius von Loyola. Diese wird heute von vielen Menschen neu entdeckt.
Ignatianische Impulse greifen aktuelle und existentielle Fragen wie auch umstrittene Themen auf. Weltoffen und konkret, lebensnah und nach vorne gerichtet, gut lesbar und persönlich anregend sprechen sie suchende Menschen an und helfen ihnen, das alltägliche Leben spirituell zu deuten und zu gestalten.
Ignatianische Impulse werden begleitet durch den Jesuitenorden, der von Ignatius gegründet wurde. Ihre Themen orientieren sich an dem, was Jesuiten heute als ihre Leitlinien gewählt haben: Christlicher Glaube – soziale Gerechtigkeit – interreligiöser Dialog – moderne Kultur.
Karl Graf und Theres Spirig-Huber
Mit Charme gewinnen – kämpfend vorangehen
Teresa von Ávila und Ignatius von Loyola im Gespräch über Geschlecht und Spiritualität

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
© 2020 Echter Verlag GmbH, Würzburg
www.echter.de
E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
ISBN
978-3-429-05485-4
978-3-429-05091-7 (PDF)
978-3-429-06486-0 (ePub)
Inhalt
Einleitung
I. Biografischer Zugang
1. Warum wir geschrieben haben
Das Buch meines Lebens — Der Bericht des Pilgers
2. Wie wir aufgewachsen sind und was uns als junge Erwachsene geprägt hat
Das Leben im Kloster — Die Karriere am Hof
3. Grenzerfahrungen in der Lebensmitte und was darin gewachsen ist
Herumgetrieben auf dem stürmischen Meer – Die Verwundung und die Folgen
4. Spiritueller Angelpunkt
Bei Christus verweilen wie bei einem Freund – Gott und seinen Willen suchen und finden
5. Krisenerfahrungen: Skrupel und Ängste
Unwürdig für das innere Beten – Rigorismus als Versuchung
6. Durchbruchserfahrungen durch mystische Heimsuchung
Der leidende Christus — Der Blick in den Fluss
7. Theologie und Spiritualität
Die Bibliothek von Onkel Petro – Latein pauken und Theologie studieren
8. Freundinnen und Gefährten
Der revolutionäre Zirkel in der Klosterzelle – Die Gefährten an der Universität
9. Neuanfänge und wie alles anders kam
Der wankelmütige Obere — Das Schiff, das nicht fährt
10. Spiritualität und gemeinsames Leben
Je zwei Stunden für Kontemplation und Austausch – contemplativus in actione
11. Engagement und Apostolat
»Die Welt steht in Flammen« – Seelen retten«
12. Umgang mit Widerständen und Grenzen
Häuser besetzen – Sich gegenüber der Inquisition verteidigen
13. Beziehung zum andern Geschlecht
»Nicht alle Nonnen dürfen das« – Vorsicht ist geboten
14. Auf den Tod zugehen, sterben
Sterben in den Armen der Freundin – Der einsame Tod
II. Schwerpunkte der teresianischen und der ignatianischen Mystik
Einleitung
1. Gottes- und Menschenbild
Innere Burg – Fundament
2. Christusbeziehung und Nachfolge
Entschlossene Entschlossenheit – Entscheidung für das Banner Christi
3. Selbsterkenntnis und Freiheit
Hühnerschritte – Ungeordnete Neigungen
4. Reifung und Wandlung
Vom Samenkorn zum Schmetterling – Hineinwachsen ins Leben mit Christus
5. Auferstehung und neues Leben
Genährt von göttlichen Brüsten – Gottes Wirken in allem
Anmerkungen
Einleitung
Sie lebten beide im 16. Jahrhundert in Spanien, die Mystikerin Teresa von Ávila und der Mystiker Ignatius von Loyola, sind sich jedoch zu Lebzeiten nicht begegnet. Und beide sind sie heute topaktuell, wenn es um die Frage geht, wie Spiritualität im Alltag konkret gelebt werden kann bzw. genauer, ob und wie sich das Frau- bzw. Mannsein und die soziale Herkunft auf die spirituelle Biografie von Männern und Frauen auswirken.
Zu diesen Fragen treffen sich Teresa, die jüdische Wurzeln hatte und als Frau nicht Theologie studieren konnte, und Ignatius, der einer adligen »altchristlichen Familie« entstammte und nach einer gescheiterten politisch-militärischen Karriere Theologe geworden war.
Vieles verbindet die beiden. Sie haben beide mutig Traditionen und Rollenmuster durchbrochen sowie Orden gegründet, in denen sie auf eine neue Weise Kontemplation und Engagement verknüpften. Doch in manchem unterscheiden sie sich. In diesem Buch treffen sich die beiden – sozusagen posthum – im 21. Jahrhundert an einem fiktiven Ort zu einem fiktiven Gespräch. Sie reden als »Kinder unserer heutigen Zeit« im Rückblick auf ihr Leben in Spanien im 16. Jahrhundert. Da sie jedoch die Schriften beider kennen, können sie ihre Aussagen immer unterlegen, ja manches direkt vorlesen. Im ersten Teil erzählen sie sich ihre Lebensgeschichten mit den je eigenen Gewichtungen und stellen Bezüge zu ihrer Spiritualität her. Im zweiten Teil besprechen sie grundlegende spirituelle Themen und klopfen dazu ihre Schriften auf biografische Prägungen hin ab. Da und dort ergeben sich wie selbstverständlich Bezüge zu Ereignissen nach ihrem Tod oder zu heute aktuellen Fragestellungen. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und Entdeckungen, die Ihre persönliche Spiritualität bereichern.
Folgende Abkürzungen werden verwendet:
Schriften von Teresa von Ávila (übers. von Ulrich Dobhan OCD und Elisabeth Peeters OCD)
VDas Buch meines LebensCCGeistliche ErfahrungsberichteCEWeg der Vollkommenheit(Manuskript vom Escorial)CVWeg der Vollkommenheit(Manuskript von Valladolid)CtBriefe (übersetzt von Erika Lorenz)FDas Buch der GründungenMWohnungen der inneren BurgPGedichteSchriften von Ignatius von Loyola
EBGeistliche Übungen,übers. von Peter Knauer SJPBBericht des Pilgers,übers. von Michael Sievernich SJBUBriefe und Unterweisungen,übers. von Peter Knauer SJGTGeistliches Tagebuch,übers. von Peter Knauer SJI. Biografischer Zugang
1. Warum wir geschrieben haben
Das Buch meines Lebens – Der Bericht des Pilgers
Teresa
Wie schön, lieber Ignatius, dass wir uns begegnen können. Deine Mitbrüder, die Jesuiten, waren für mich wichtige Wegbegleiter und haben mir mit ihrer Spiritualität und ihrer Gabe der Unterscheidung wichtige Impulse gegeben. Wir lebten ja in einer verrückten Zeit. Du wurdest zwar ein Vierteljahrhundert vor mir geboren, aber wir erlebten beide die Zeit der Renaissance mit all den gesellschaftlichen und kirchlichen Veränderungen in Spanien. Vor unseren Augen entstand ein geeintes, mächtiges spanisches Königreich. Allerdings um den Preis der Vertreibung der jüdischen und der maurischen Bevölkerung und ein paar Jahrzehnte später der Ausbeutung der indigenen Bevölkerung in Amerika. Kolumbus war ja kurz nach deiner Geburt 1491 nach Amerika aufgebrochen und – stell dir vor – auch meine Brüder schifften sich später ein, um zum neuen Kontinent aufzubrechen. Eine faszinierende, aber auch schreckliche Zeit …
Nun aber zu uns selber, zu unseren Lebensgeschichten. Von uns beiden gibt es ja autobiografische Berichte. Deiner heißt »Pilgerbericht«. Wie kamst du, Ignatius, eigentlich dazu, deine Biografie zu erzählen und aufschreiben zu lassen – und unter den Titel »Pilgerbericht« zu stellen?
Ignatius
Gute Frage, Teresa, denn meine Biografie interessierte mich nie besonders. Es ging mir vielmehr immer darum, täglich dankend zurückzuschauen und nach dem Weg zu fragen, den Gott mit mir vorhatte, anders gesagt, nach dem »Willen Gottes zu suchen«. Es ging mir nie um ein biografisches Kreisen um meine eigene Person. Meine Mitbrüder drängten mich jedoch gegen Ende meines Lebens dazu, meinen Weg zu erzählen. Sie wollten so das Wirken Gottes in meinem Leben deutlicher erkennen und waren überzeugt, das helfe ihnen, den eigenen Weg mit Gott zu suchen und zu gehen. Das überzeugte mich, und so erzählte ich kurz vor meinem Tod meinem Mitbruder Luís Gonçalves da Câmara wichtige Stationen meiner Lebensgeschichte, und zwar aus der Perspektive eines Pilgers, der seinen Weg sucht und sich darin von Gott geführt und begleitet erfährt. Mein Mitbruder schrieb auf, was ich erzählte. So entstand eben weniger eine Autobiografie als vielmehr ein »Pilgerbericht«, mein Zeugnis vom Wirken Gottes in meinem Leben.
Aber wie war es denn bei dir, Teresa? Du hast in deinen Büchern ja viel aus deinem Leben erzählt, ja gar selber deine Vida, deine spirituelle Autobiografie, geschrieben. Ich gebe zu, dass ich vorerst – aufgrund meiner eher nüchternen Art vielleicht – mit deinem weitausholenden Erzählen meine liebe Mühe hatte. Aber je länger ich mich in deine Bücher vertiefte, desto mehr zog mich deine leidenschaftliche Gottsuche in Bann. So frage ich nun gerne dich: Wie kamst du dazu, von deinem Leben zu erzählen und gar deine Vida, »Das Buch meines Lebens«, zu schreiben?
Teresa
Auch ich wäre nie selber auf die Idee gekommen, meine Biografie aufzuzeichnen. Aber meine ersten geistlichen Begleiter, denen ich meine intensiven spirituellen Erfahrungen anvertraute, reagierten misstrauisch. Ich glaube, sie wussten nicht recht, was sie davon halten sollten. So trugen sie mir auf, meine Lebens- und Glaubenserfahrungen detailliert niederzuschreiben. Dadurch sollte klar werden, ob ich mich auf meinem spirituellen Weg im Rahmen des kirchlich Erlaubten bewegte. Sie forderten mich dadurch auch heraus, Sprache zu finden für die mystischen Erfahrungen, die mich oft überwältigt haben. Das war sehr schwierig. Wie sollte ich diese Erfahrungen für mich selber in Worte fassen? Wie sollte ich gar eine Sprache finden, die diese Erfahrungen andern vermitteln konnte?
Am leichtesten fiel mir immer das Erzählen – vor allem meinen Mitschwestern gegenüber –, das ich dann niederschrieb, quasi frisch von der Leber weg, ohne theologische Systematik. Für meine spirituellen Impulse brauchte ich am liebsten Bilder und Gleichnisse oder ich erzählte von eigenen Erfahrungen. Mir lag es immer daran, möglichst konkret zu reden oder zu schreiben. Ich konnte gar nicht anders. Und so verstanden mich auch die Schwestern am besten, unabhängig von ihrer Herkunft, unabhängig davon, ob sie gebildet waren oder Analphabetinnen. Meine Vida ist somit ebenfalls weniger eine Autobiografie als ein Erzählen meiner inneren und äußeren Erfahrungen, vor allem auch meiner oft schmerzhaften Suche nach Gott. Darin ist sie wohl deinem Pilgerbericht recht nahe, obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass dir mein Stil fremd ist und ab und zu Mühe macht. Denn im Unterschied zu meinem spontanen, erzählenden Stil hast du deine Briefe und Texte mehrfach überarbeitet, bis sie deinem hohen Anspruch genügten. Deine Mitbrüder haben dann nach deinem Tod deine geistlichen Tagebucheinträge veröffentlicht und uns damit ein eindrückliches Zeugnis deines spirituellen Weges geschenkt. Das hat mich besonders berührt, weil auch du darin sehr persönlich von deinem spirituellen Suchen berichtest.
Doch nun möchte ich mich noch über unsere Herkunft, unsere Kindheit und Jugendzeit unterhalten. Das hilft bestimmt, uns besser zu verstehen.
2. Wie wir aufgewachsen sind und was uns als junge Erwachsene geprägt hat
Das Leben im Kloster – Die Karriere am Hof
Ignatius
Gern, liebe Teresa. Also: Ich hatte eindeutig bessere Startbedingungen als du, nicht nur weil ich ein Junge war, sondern auch, weil ich einer alten Adelsfamilie mit tadellosem altchristlichem Stammbaum entstammte, einer Familie »reinen Blutes«, wie es damals hieß. Das war für dich anders und du weißt wohl nur zu gut, welches Privileg meine Herkunft bedeutete. Du wurdest ja 1515 als Nachfahrin eines Conversos, also eines neubekehrten Juden, geboren.
Teresa
Ja, mein Großvater väterlicherseits war Jude und hatte gemäß dem Gesetz des »reinen Blutes« die Wahl, sich zu bekehren, auszuwandern oder des Landes verwiesen zu werden. Also ist er mit seiner Familie zum katholischen Glauben übergetreten. Später mehr dazu, was das für mich bedeutete.
Ignatius
Also, zurück zu mir: Ich war das jüngste von 13 Kindern und erhielt im Schloss meines Vaters in Loyola eine gute Erziehung. Ich konnte dank der Beziehungen meines Vaters schon mit 16 Jahren am Hof des königlichen Großschatzmeisters Velázquez de Cuellar in Kastilien meine höfische Beamtenkarriere beginnen. Dort lernte ich Verwaltungsaufgaben und Verhandlungsführung kennen. Diese Fähigkeiten kamen mir später sehr zugute. Wir Pagen wurden zudem mit der ritterlichen Kultur vertraut gemacht, was mich begeisterte. Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass mein Leben ziemlich abenteuerlich war. Juan de Polanco, mein Sekretär, schrieb später über mich: »Er hütete sich nicht vor Sünden, sondern war besonders ausgelassen im Spiel und in Frauenabenteuern, in Raufereien und Waffenhändeln.«1 Meine Nachfolger in der Leitung der Gesellschaft Jesu hatten später ihre liebe Mühe mit solchen Schilderungen. Allerdings nicht nur sie. Ich selber konnte mich innerlich immer weniger mit der Kultur der Loyolas identifizieren, die, zusammenfassend auf den Punkt gebracht, patriarchal, an männlich-ritterlichen Idealen orientiert, kriegerisch und auf Ehre (honra) fixiert war. Ich hatte noch einen sehr langen und schwierigen Weg vor mir, um mich selber und meine Berufung zu finden. Aber davon später mehr. Vorerst bin ich gespannt zu erfahren, woher du stammst und wie die Anfänge deines Lebens verlaufen sind.
Teresa
Gerne. Meine Herkunft unterscheidet sich deutlich von der deinen, Ignatius. Das hast du ja schon erwähnt. Deine Kindheit und Jugend scheint problemlos und gleichzeitig abenteuerlich gewesen zu sein. Vor allem öffnete dir deine Abstammung aus einer altchristlichen Adelsfamilie viele Türen wie zum Beispiel die zur Ausbildung am Königshaus in Kastilien. Bei mir wäre das undenkbar gewesen. Mein jüdischer Großvater war mit seiner Familie nach seiner Konversion von Toledo nach Ávila gezogen, um dort nicht erkannt zu werden und der Ausgrenzung zu entgehen. Den konvertierten Juden und Jüdinnen wurde nämlich unterstellt, dass sie weiterhin im Verborgenen ihren jüdischen Glauben praktizieren. Kannst du dir vorstellen, was es bedeutete, Enkelin eines Conversos zu sein? Es hieß zum Beispiel, dass mein Großvater in Ávila durch Bestechung einen Adelstitel erwarb, damit er besser geschützt war und an den entsprechenden Privilegien teilhaben konnte. So musste er auch keine Steuern bezahlen und konnte seine Kinder standesgemäß verheiraten. Mein Vater vermählte sich zuerst mit einer »del Peso« und in zweiter Ehe mit einer »de Ahumada«, einer adligen Altchristin aus der Oberschicht von Ávila. Trotzdem blieb der Makel, jüdischer Abstammung zu sein, wenn auch vielleicht manchmal mehr im Gefühl als in der Realität. Da den Converso-Familien über Generationen hinweg Misstrauen entgegengebracht und ihnen bei jeder Gelegenheit unterstellt wurde, dass sie den neuen Glauben nur vortäuschten, wollten wir ihn besonders eifrig leben und uns gesellschaftlich so weit wie möglich absichern. Einige meiner Brüder haben auf diesem Hintergrund wie viele andere Conversos ihr Glück in Amerika versucht.
Ignatius
Das kann ich mir vorstellen, liebe Teresa, denn ich habe selber erlebt, wie die kirchlichen Autoritäten in Spanien verhindern wollten, dass Conversos in die Gesellschaft Jesu aufgenommen werden. Ich habe mich mit allen Kräften erfolgreich dagegen gewehrt und mit Diego Lainez gehörte sogar ein Converso zum engsten Kreis meiner ersten Gefährten. Die Auseinandersetzung mit Kardinal Silíceo, der mit allen Kräften die Durchsetzung der Statuten des »reinen Blutes« verfolgte, war allerdings sehr heftig. Silíceos Argumentation gegen die Conversos enthielt bedenklichste antijüdische Klischees vom Gottesmord der Juden bis zur jüdischen Weltverschwörung. Ich selber habe einmal gesagt, dass es für mich eine Ehre wäre, jüdischer Abstammung zu sein, weil ich so Jesus näher sein könnte.
Teresa
Das zu hören tut mir gut, lieber Ignatius, und ich schätze es sehr. In meinen neu gegründeten Klöstern durften die gesellschaftliche Herkunft und die Statuten des »reinen Blutes« auch keine Rolle spielen. Stell dir vor, ich hätte ja sonst selber nicht eintreten können!
Doch zurück zu unserer Jugendzeit: Ein weiterer grundlegender Unterschied zu dir war, dass ich als Mädchen keine Chance hatte, ritterliche Abenteuer zu bestehen, eine Beamtenlaufbahn einzuschlagen oder Theologie zu studieren. Wenigstens unterstützten mich meine Eltern immer. Sie lehrten mich sogar Lesen und Schreiben, was damals nur sehr wenigen Frauen ermöglicht wurde und das ich sehr liebte. In der Bibliothek meines Vaters fand ich religiöse Bücher. Später, in der Pubertät, las ich Ritterromane, die Lieblingsbücher meiner Mutter. Das gefiel mir. Ich begab mich in die Welt der vornehmen Damen, liebte schöne Kleider und sorgte dafür, dass ich attraktiv aussah. Du siehst, die ritterliche Welt war uns gemeinsam, für dich allerdings real, für mich im Lesen und im Spiel. Aber nicht nur das: Als kleines Mädchen wollte ich unbedingt als tapfere Märtyrerin im Kampf gegen die Mauren sterben. Ich hoffte, mir so den Himmel zu verdienen und der Höllenstrafe, die für jedes kleine Vergehen drohte, zu entgehen. Und tatsächlich zog ich als Kind eines Tages mit meinem Bruder los. Unser Unternehmen endete allerdings kläglich vor den Toren der Stadt, wo mein Onkel uns entdeckte und nach Hause zurückbrachte. Das war schlimm, denn im Unterschied zu dir blieb mir als Frau in der damaligen Gesellschaft nur die Alternative Heirat oder Kloster. Wenn ich mir dazu das Schicksal meiner Mutter vor Augen hielt, die nach der Geburt des zehnten Kindes – ich war damals 13 Jahre alt – mit 35 Jahren ganz entkräftet gestorben war, war Heirat kein Weg für mich. Andererseits wollte ich auch nicht ins Kloster, denn diese Variante hatte ich bereits kennengelernt. Mein Vater hatte mich nämlich mit 14 Jahren ins Internat der Augustinerinnen gesteckt, damit ich gutes Benehmen lerne und überhaupt alles, was ein junges Mädchen aus gutem Hause wissen musste. Dort begegnete ich zwar glaubwürdigen Ordensfrauen und fühlte mich auch bald wohl, aber ich hatte Mühe mit der Art der dortigen Frömmigkeitsübungen. Zudem hatte ich schon damals Ohnmachtsanfälle und Fieberschübe. Deshalb holte mein Vater mich nach eineinhalb Jahren wieder nach Hause. Aber von da an hatte ich zeitlebens mit Krankheiten zu kämpfen. Das kanntest du, lieber Ignatius, ja nur zu gut mit deinen Beschwerden nach der Kriegsverletzung und den Folgen deiner übertriebenen Bußübungen, wie du später selber schriebst.
Also: Es stimmt, unsere Herkunft und unsere erste Lebensphase waren sehr verschieden. Ich war geprägt durch die Folgen, die die jüdische Herkunft mit sich brachte, und durch die gesellschaftliche und kirchliche Diskriminierung als Frau bzw. die Festlegung auf die Rolle zu heiraten und Kinder zu gebären oder ins Kloster zu gehen. Schließlich plagte mich die verbreitete Höllenangst. Mir setzte das alles sehr zu und es machte mir Angst, obwohl ich eigentlich ein fröhlicher Mensch war.
In diesem Dilemma entschied ich mich mit zwanzig Jahren – gegen den Willen meines Vaters – für das Kloster. Nicht aus Begeisterung, sondern um im Kloster zu büßen und so der Hölle zu entgehen sowie mich der Herrschaft eines Mannes so weit wie möglich zu entziehen.
3. Grenzerfahrungen in der Lebensmitte und was darin gewachsen ist
Herumgetrieben auf dem stürmischen Meer – Die Verwundung und die Folgen
Ignatius
Tatsächlich, Teresa, meine Welt war wirklich eine ganz andere. Nach meiner Ausbildung am Hof hoffte ich auf eine große Karriere und träumte von ritterlichen Großtaten. Bald bot sich anlässlich der Verteidigung der Festung Pamplona gegen die Franzosen eine hervorragende Gelegenheit, meinen Mut und meine Tüchtigkeit zu beweisen. Da die Lage aussichtslos war, dachte die kastilische Truppe bereits ans Kapitulieren. Nun wollte ich meinen Mut unter Beweis stellen. Ein Zeuge berichtete später über mich: »Angetrieben von seiner Kühnheit und seinem heißen Wunsch nach Ehre … sprengte [er] mit einer kleinen Gruppe Soldaten im Galopp in die Stadt hinein.«2 Und was geschah? Eine Kugel zertrümmerte mein rechtes Bein – und es kam noch schlimmer: Nach dem mühsamen Transport in das Schloss meiner Familie in Loyola mussten die Ärzte nochmals alles aufschneiden und die Knochen neu richten. Das setzte mir so sehr zu, dass die Ärzte mit meinem Tod rechneten. Ich erholte mich dann zwar, jedoch nur langsam. Die Zeit im Bett vertrieb ich mir mit Ritterphantasien und dem Träumen von Heldentaten. Wie du, Teresa, hätte ich gerne Ritterromane gelesen. Doch es waren keine im Haus. Meine Schwägerin Magdalena brachte mir dann zwei religiöse Bücher, nämlich eine »Vita Christi« und eine Sammlung von Heiligenlegenden. Was mich sowohl bei den Ritterromanen wie bei den Heiligenlegenden interessierte, waren die Heldentaten. Ich träumte immer noch davon, etwas Besonderes zu vollbringen. Manchmal dachte ich an Heldentaten als Ritter, manchmal an ein heroisches Leben als Heiliger.
Teresa
Oh Ignatius! Ich habe dir ja schon erzählt, wie ich als Heldin gegen die Mauren kämpfen und als Märtyrerin sterben wollte. Da das nicht möglich war, entschied ich mich fürs Kloster, um, wie schon gesagt, der Hölle zu entkommen und patriarchalen Zwängen weniger ausgeliefert zu sein. Dort suchte ich über viele Jahre meinen ganz eigenen Weg als Frau. Meine praktische Begabung und meine Kontaktfreudigkeit schützten mich vor allzu verstiegenen Träumen.
Doch wie hast du, Ignatius, vom Träumen ins reale Leben gefunden?
Ignatius
Mit der Zeit brachte mich die radikale Unterbrechung meiner Karriere in eine Krise, die mich zum Nachdenken zwang und zu einer grundlegenden Umorientierung führte. In den langen Stunden auf meinem Krankenbett entwickelte und vertiefte sich meine Selbstwahrnehmung. Ich stellte fest, dass die Träume von Ritterabenteuern und Heldentaten mich leer zurückließen, während ich nach der Beschäftigung mit spiritueller Literatur eine positive Energie in mir spürte und ich mich bestärkt und getröstet fühlte. Die früheren
Karriereziele kamen mir zunehmend leer und sinnlos vor. So entschied ich mich, in meinem Leben neue Prioritäten zu setzen.
Teresa
Ich staune über deine entschiedene Neuorientierung, Ignatius. Bei mir zog sich der Prozess der Umorientierung viel länger hin. Du weißt ja um die Schwierigkeiten in unseren Klöstern. Es gab zwar viele eifrige Mitschwestern, aber die Bedingungen waren für das kontemplative Leben nicht günstig. In »meinem« Kloster der Menschwerdung lebten 180 Nonnen, die auch aus purer wirtschaftlicher Not viele Außenkontakte pflegten. Es ging zu wie in einem Bienenhaus. Die vielen mündlichen Gebete im Auftrag unserer Wohltäter erlebte ich oft als äußerliche Pflichterfüllung und meine Seele fand kaum Nahrung. Aber es gab etwas ganz Entscheidendes, das mich in diesen schwierigen Jahren, in diesem Hin und Her getragen hat, nämlich das innere Gebet. Es war jedoch ein langer und schwieriger Weg. In meiner Vida schrieb ich über diese stürmische Zeit: »Weil ich mich an dieser starken Säule des inneren Gebetes festklammerte, trieb ich mich fast zwanzig Jahre auf diesem stürmischen Meer herum mit diesem Fallen und Aufstehen, aber das nur schlecht – denn ich stürzte wieder … Ich kann nur sagen, dass das eine der mühseligsten Lebensweisen ist, die man sich meines Erachtens vorstellen kann, denn weder erfreute ich mich Gottes, noch fand ich in der Welt mein Glück« (V 8,2). Es war sehr hart und ich litt an meinem inneren Zwiespalt, hin- und hergerissen zwischen meinen vielen Kontakten sowie weltlichen Zerstreuungen und meiner Freundschaft mit Jesus. Trotzdem: Das innere Beten vertiefte sich und wurde immer mehr zur tiefsten Quelle meiner Spiritualität.