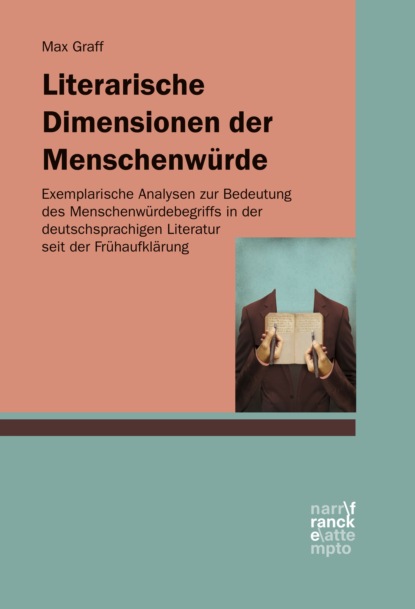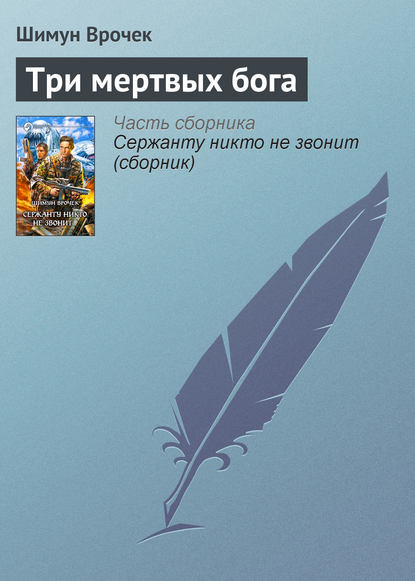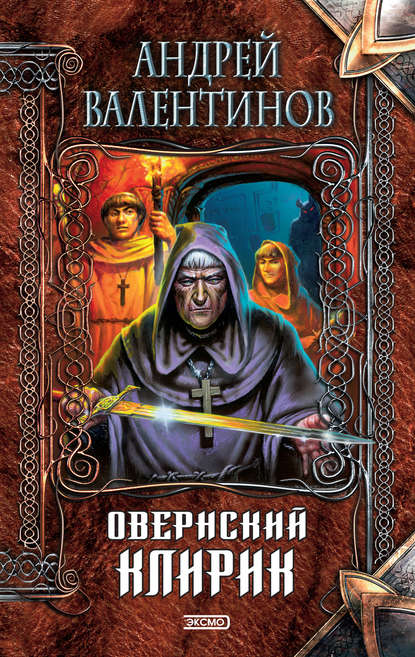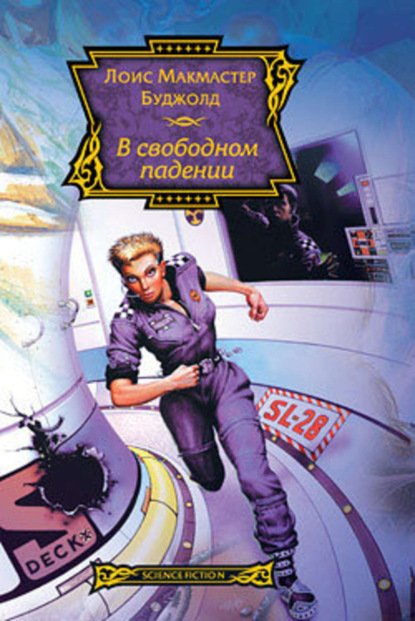- -
- 100%
- +
III.4. MenschenwürdeverletzungenMenschenwürdeverletzung und MenschenrechteMenschenrechte
MenschenwürdeverletzungenMenschenwürdeverletzung in Form von extremer, sadistischer GewaltGewalt und Erniedrigung werden in Die Negersklaven – zumindest im Text des Druckes – keineswegs ausgeklammert oder nur angedeutet. Mit bisweilen expliziter, schockierender Drastik werden sie zum einen in der Figurenrede beschrieben oder narrativ erinnert, zum anderen in konkreten Szenen auf der Bühne dramatisiert. So erzählt z.B. John, wie er ein „wildes Maͤdchen“ durch sadistische Folter dazu brachte, sich ihm hinzugeben: „Ich ließ ihr den ganzen Leib mit Stecknadeln sanft zerprickeln. Dann wurde ihr in Oel getauchte Baumwolle um die Finger gewickelt, und angezuͤndet“ (NS 20). Nur wenig später berichtet der Meisterknecht, der John an Brutalität sogar noch übertrifft, wie er einem alten Sklaven, der seine Arbeit nicht zufriedenstellend verrichtete, den Rücken „auf[ge]hauen [hat], und Salz und spanischen Pfeffer hinein streuen“ ließ (NS 25). Es folgt ein kurzer, menschenverachtender Dialog:
John. […] warum befahlst du nicht ihn aufzuwinden, so haͤtte er es besser gefuͤhlt.
M. Kn. War nicht noͤthig. Die Feuerglut, bey welcher er ewig schwitzt, hat ihn so ausgedoͤrrt, daß bey jedem Hiebe die Haut sich von den Knochen loͤst, wie die Schaale von einer Kaffeebohne. […]
John. Er wird schon zu alt, man muß ihn nach und nach ruhig sterben lassen. […] Ich lasse ihn weniger arbeiten, und gebe ihm weniger zu essen, so verlischt er endlich wie ein Licht. (NS 25–26)
GewaltGewalt und Folter sind alles andere als abstrakte Vorgänge. Mit technokratischer Detailversessenheit werden genüsslich Folterpraktiken diskutiert. Das onomatopoetische Verb „zerprickeln“, die Nennung von Körperteilen und körperlichenKörper Phänomenen, entmenschlichende Vergleiche, schließlich Verben und Nomina der Gewalt evozieren ein frappierendes Bild des Schreckens, angesichts dessen das Publikum vielleicht sogar zunächst eine Art voyeuristische Faszination für das Ekelhaft-Abstoßende verspürt. Die Sklaven erscheinen in diesen Beschreibungen nicht als Personen oder Subjekte, sondern werden zu reinen ObjektenObjekt, Objektifizierung, Ding, Verdinglichung, Dinghaftigkeit sadistischer Lust- und Machtphantasien degradiert, auf ihre KreatürlichkeitKreatürlichkeit reduziert oder, wenn z.B. kurz darauf vom „Negerleder“ (NS 27) die Rede ist, verdinglicht. John verfügt über seinen materiellen Besitz – die Sklaven – nach Belieben und quasi spielerisch. Einen ‚Wert‘ hat ein Sklave perverserweise nur, wenn er verdinglicht wird: als Arbeitskraft und als Lustobjekt – sei es sexuelleSexualität, Sex Lust1 (Ada) oder der Genuss, den John aus Misshandlung und Qual zieht.
Die Geschichten, die die Sklaven selbst aus ihrem Alltag oder ihrer Vergangenheit erzählen, haben denselben Effekt. Sie berichten von Misshandlungen, von gescheiterten Fluchtversuchen, von Verstümmelungen, von Menschenjagd, vom Status der Sklaven, die den Herren weniger als Hunde gelten oder wie Pferde vor den Wagen gespannt werden (vgl. NS 46–52 und 67–68). Alle diese Passagen mit ihren grausigen Details haben eine Kontrastfunktion: Sie dienen als negative Folie für die diskursive wie literarische Konstitution der Menschenwürde. Die explizit verbalisierte und rekapitulierte Missachtung lässt die Behauptung der Menschenwürde umso virulenter erscheinen. Es besteht eine Interdependenz zwischen der Einsicht in die Würde der Sklaven und der Empörung über die geschilderten WürdeverletzungenMenschenwürdeverletzung; deren Darstellung wird durch die Wirkintention gerechtfertigt, eben die Feststellung, dass die Behandlung der Sklaven menschenunwürdig und daher moralisch zu verurteilen ist.
Phänomenologisch betrachtet schildert KotzebuesKotzebue, August von Drama unterschiedliche Formen körperlicher GewaltGewalt.2 Die Entführungen zum Zweck der Ausbeutung durch Zwangsarbeit in Kolonien, von denen etwa Ayos und Zameo erzählen, sind eine Form lozierender Gewalt; der KörperKörper wird zur „verschiebbaren Masse“. Raptive Gewalt – das Benutzen des Körpers mit dem Ziel des sexuellenSexualität, Sex Lustgewinns – droht der Figur Ada von Seiten Johns. Was John und der Meisterknecht den Sklaven antun, ist autotelische Gewalt: Das Beschädigen oder Zerstören der körperlichen Integrität dient nicht wirklich einem bestimmten Ziel – die Gewalt selbst wird zum Zweck.3 Gemeinsam ist allen drei Formen der Gewalt, dass sie die Sklaven depersonalisieren und auf ihren als ‚DingObjekt, Objektifizierung, Ding, Verdinglichung, DinghaftigkeitDing, Verdinglichung, Dinghaftigkeit (s. Objekt, Objektifizierung)‘ wahrgenommenen Körper reduzieren.
Die Figur William verkörpert indes, wie bereits erwähnt, innerfiktional die vom Publikum erwartete Reaktion. In einer Regieanweisung heißt es: „([…] Sein Gesicht gluͤht von Unwillen)“ (NS 26). Der Zuschauer soll wie William mit Betroffenheit registrieren, dass die Sklaven nicht nur entwürdigtEntwürdigung werden, sondern – und hier kommt nun eine entscheidende Dimension hinzu – quasi rechtelos sind. Als das Drama 1794 uraufgeführt wurde, war die Frage nach den MenschenrechtenMenschenrechte, ihrer Kodifizierung und Gültigkeit äußerst aktuell und politisch brisant.4 Im Text wird sie nicht nur implizit verhandelt, sondern ausdrücklich angesprochen. Auf Williams naive Frage, ob die Sklaven nicht einen Gerichtshof anrufen könnten, erwidert Truro:
Ein Gerichtshof? – Nicht einmal als Zeugen duͤrfen wir auftreten, vielweniger als Klaͤger. Ein Neger hat nie Recht. Jeder Europaͤer, selbst der Fremdling, darf ihn ungestraft peitschen, und hebt der Neger die Hand gegen ihn auf, so ist er des Todes. (NS 50)
Für die Sklaven gelten die Bürger- und MenschenrechteMenschenrechte nicht; weder vor Recht und Gesetz noch von den Kolonialherren werden sie als gleichwertige Rechtssubjekte anerkannt. De facto stehen sie außerhalb des Gesetzes. Deshalb reagiert John spöttisch auf Ayos’ Versuch, sich gegen Willkür und Ungerechtigkeit zu wehren:
Ayos. […] ich verklage dich.
John. (laͤchelnd) Wo?
Ayos. Vor GottGott! (NS 87)
John geht hierauf nicht einmal ein; für eine solche Argumentation ist er, der in den Sklaven eine von GottGott wesenhaft anders erschaffene Rasse sieht, nicht empfänglich. Wenn dieser Ausspruch demnach keine primär innerfiktionale Funktion hat, bleibt als Adressat nur der außerfiktionale Rezipient. Bereits im Dialog mit John (I,6) hatte William eine Aufforderung formuliert, die man durchaus als Durchbrechen der innerfiktionalen Kommunikationssituation deuten könnte: „Redet laut, ihr Diener der Kirche! widersprecht laut!“ (NS 37). Da das positive Recht ebenso wie die koloniale Praxis die Gleichheit aller Menschen ignoriert, ist Gott die letzte Instanz. Doch selbst diese ultimative Garantie – die Gleichheit aller Menschen vor Gott – lässt nicht auf eine Veränderung im Diesseits hoffen. Die Zeit, in der „die Natur wieder in ihre Rechte tritt“,5 wie es Ada formuliert, in der mit Lillis Worten „die Farbe kein Verbrechen mehr ist“, in der also die natürliche Gleichheit aller Menschen uneingeschränkt respektiert wird, bleibt innerfiktional eine erst für das Jenseits zu erhoffende Utopie (NS 52). Außerfiktional kann jedoch die Empörung des Rezipienten – über die brutalen EntwürdigungenEntwürdigung und das christlichen Grundsätzen widersprechende Menschenbild – zu einem Movens für Veränderung werden. Indem das Stück hier ex negativo die Forderung nach der universellen Gültigkeit elementarer Rechte wie dem Recht auf leibseelische Integrität oder der Anerkennung der Sklaven als Rechtssubjekte entwickelt, entfaltet es am deutlichsten sein sozialkritisches Potential.
III.5. Kindsmord und Freitod als dramatische Prüfsteine der Menschenwürde
Schockierendes wird auch direkt auf offener Bühne dargestellt. Szenen wie die Misshandlung Zameos (NS 81–82) delegitimieren das Verhalten der Kolonialherren; diese werden als unmenschlich gebrandmarkt, weil sie die Sklaven, die als würdige Menschen EmpathieEmpathie und MitleidMitleid verdienen, entwürdigenEntwürdigung. Die im Folgenden analysierten Szenen jedoch gestalten Mord und SuizidSuizid als einzig mögliche Formen des autonomenAutonomie Widerstandes gegen das entwürdigende System der Sklaverei.
Der Tod als aktiv und selbstbestimmt zu suchende Möglichkeit des Entkommens begleitet die Handlung.1 Am deutlichsten formuliert Ayos das Recht des Einzelnen, den Tod zu wählen: „Alle Wohlthaten des Himmels darf ein Tyrann uns vorenthalten, nur nicht den Tod! Verbittern kann er ihn, aber nicht hemmen!“ (NS 77). Diese Position wird innerfiktional nicht in Frage gestellt; der Freitod als einzig mögliche selbstbestimmte Handlung wird zum Beweis der eigenen Würde, gleichzeitig auch zum Mittel, die eigene Würde zu wahren. Die Kritik trifft also nicht jene, die den Tod wählen, sondern jene, die für die Umstände, die zu dieser Entscheidung führen, verantwortlich sind: die weißen Sklavenhalter.
Dies illustriert etwa die Sympathielenkung in Szene II,2, in der eine Sklavin ihren drei Tage alten Säugling, den sie mit eigenen Händen ermordet hat, auf die Bühne bringt. „[L]aͤchelnd“ erzählt sie ihre abstoßende Geschichte: Kurz nach der Entbindung wurde sie vom Meisterknecht ausgepeitscht, stillte infolgedessen das Kind zwei Tage lang mit Blut; um ihm die bevorstehenden Qualen der Sklavenexistenz zu ersparen, drückt sie ihm einen Nagel ins Herz. Den Kindsmord begreift sie als Beweis ihrer Mutterliebe, als ihre „Pflicht“. Sie selbst wünscht sich, ihre Mutter hätte Ähnliches mit ihr getan. Doch sie wurde als Kind entführt, „fuͤr einen kupfernen Kessel“ verkauft, zur Arbeit gezwungen, schließlich zu einer Gebärmaschine degradiert, „um noch mehr Sklaven in die Welt zu setzen“. Auch als Hochschwangere musste sie arbeiten;2 angesichts dieser EntwürdigungenEntwürdigung scheint ihr der Kindsmord die einzig mögliche würdige Handlung, ein Akt der Liebe und Fürsorge zu sein. Das Intentum dieser Szene wird in Regieanweisungen für andere Charaktere explizit gemacht: William ist zunächst „aufspringend“, dann „schaudernd“, später „zerknirscht“, schließlich „verhuͤllt [er] sein Gesicht, und wirft sich auf die Bank in der Laube“; Truro wischt „sich eine Thraͤne aus den Augen“ (NS 57–61). Das Schreckliche, Ungeheuerliche der Tat soll den Zuschauer schockieren und rühren. Die Mutter wird nicht verurteilt, sondern mitleidigMitleid betrachtet; die eigentliche Schuld trifft das System der Sklaverei und der Ausbeutung.3
Auch der Schluss des Stücks fügt sich in dieses Bild. Das Affektive und Hochpathetische des Dialogs zwischen Ada und Zameo, sprachlich untermalt durch die Vielzahl von kurzen Parataxen und exclamationes, der im von Ada erflehten Mord Zameos an seiner Frau endet, soll die Tat und die Figuren nicht delegitimieren. Ada will sterben, um ihre Würde zu wahren; Zameos Tat wird zum ultimativen Liebesbeweis. Nach der Tötung Adas gerät Zameo in einen Schockzustand: „Der Koͤrper zittert, das Auge rollt“ (NS 134). Es ist das einzige Mal, dass eine der Figuren nicht mehr Herr seiner selbst ist, aufgrund seiner verlorenen AutonomieAutonomie sogar würdelosWürdelosigkeit erscheinen könnte. Zameo ist dem Wahnsinn nahe, hat eine Vision, in der ihn Ada zu sich zu rufen scheint (NS 135–136). Die Szene ist voller Pathos, zielt aber nicht darauf, Zameo als Mörder zu zeichnen, der die Kontrolle verloren hat. Vielmehr enthüllt seine Verzweiflung die Ausweglosigkeit seiner Situation. Er sah sich gezwungen, einen geliebten Menschen zu töten, um ihn zu retten. Sein SuizidSuizid ist letztlich konsequent: Angesichts der sich nähernden Schergen Johns und der zu erwartenden Strafe ist der Tod auch seine letzte Fluchtmöglichkeit. Wie die Sympathie des Zuschauers gelenkt werden soll, belegen die letzten Worte des Textes:
Will. (hastig fortstuͤrzend zu John) Fluch dir Moͤrder!
(Alle stehn unbeweglich. Der Vorhang faͤllt.) (NS 137)
Ein tableau vivant beendet das Drama und steigert die Wirkung der letzten Worte. Der als „Moͤrder“ Angeklagte ist jedoch nicht Zameo, sondern John. Somit wird er zum Urheber allen Leids; ihn trifft in der Logik des Stücks die Schuld an der Katastrophe.
III.6. Problematisierungen
Die Aussage des Stückes scheint bis hierhin eindeutig. Die Sklaverei ist ein Herrschaftssystem, das den Opfern die Anerkennung ihrer Menschenwürde verweigert, sie entwürdigtEntwürdigung und deshalb abzuschaffen ist. Damit stellt KotzebueKotzebue, August von seinem Publikum auch eine Folie zur Verfügung, die sich auf das Problem der Leibeigenschaft und der Bauernbefreiung in seiner estnischen Wahlheimat übertragen lässt. Analysen, die sich den postcolonial studies verpflichtet fühlen, stellen die Radikalität der Kritik Kotzebues allerdings ernsthaft in Frage und problematisieren die entworfenen Schwarzen- und Weißenrollenbilder. Kotzebues Intention und die hohe affektive Potenz des Stücks werden zwar nicht bestritten; dennoch stellt etwa Susanne M. Zantop die Frage, ob Kotzebues Darstellung jene sozialen Strukturen, die sie anprangert, nicht indirekt zementiere.1 Bei genauerem Hinsehen entpuppe sich der Philanthrop William als Vertreter einer patriarchal organisierten GesellschaftGesellschaft, in der weiter Abhängigkeitsverhältnisse bestehen. Als die Sklaven William anflehen, ihr Herr zu werden, erwidert er: „Ich danke euch Kinder! ich will euer Schicksal zu erleichtern suchen“ (NS 65; m. H.). Und nachdem er Zameos FreiheitFreiheit erkauft hat, wirft sich ihm dieser zu Füßen mit den Worten:
Zameo. (umfaßt Williams Kniee) Wer durch Wohlthaten fesselt, der bedarf keiner Ketten. Du hast mich frey gelassen, und ich bin dein Sklave auf ewig; mit gebundenen Armen haͤtte ich entlaufen koͤnnen, aber du fesseltest mein Herz – ich weiche nimmer von dir! (NS 89)
Dass der freigelassene Sklave, der eine menschliche, liebevolle Behandlung erfahren hat, noch bessere Arbeit leistet, sei ein im 18. Jahrhundert weit verbreitetes Klischee.2 Der Sklave ist zwar rechtlich frei; als Arbeiter wird er aber immer noch ausgenutzt. Das suggeriert auch die Figur des verstorbenen Vaters der beiden Brüder. Die Sklaven verehrten ihn als idealen, menschlichen, mitfühlenden Herren, ja als Vater – trotzdem verdankt er natürlich der Sklaverei seinen Reichtum.3
Deshalb ist auch der alternative, melodramatische Schluss des Dramas hochproblematisch: Als William Ada (wie vorher bereits Zameo) freikauft, also durchaus einen Preis für einen Menschen bezahlt, bestätigt er indirekt – wenn auch gegen seine eigene Absicht – das bestehende System. Als einziges wirkliches Entkommen bliebe demnach das selbstbestimmte Sterben.
Nach Dieter Borchmeyer ist dieser alternative Schluss der Negersklaven ohnehin ein Paradebeispiel für das, was die Trivialliteratur künstlerischKunst, Künstler-ästhetisch zweifelhaft macht – und ihren Erfolg begründet. Indem sie „den Bedürfnissen der Leser nach einer Flucht aus den gesellschaftlichen Alltagsrealitäten entgegenkommt, dieses Bedürfnis durch Möglichkeiten der Harmonisierung im fiktionalen Bereich befriedigt und so zu einer Versöhnung mit dem bestehenden Gesellschaftszustand führt“, büßt sie ihr sozialkritisches, intellektuelles Potential, das in der ‚tragischen Version‘ ja zweifelsohne vorhanden ist, willentlich ein.4
Tatsächlich ist KotzebuesKotzebue, August von Drama nicht frei von aus moderner Perspektive schwer hinnehmbaren Klischees, Vorurteilen und Gemeinplätzen – etwa in Bezug auf die Beziehung von Mann und Frau oder das Verhältnis verschiedener Ethnien.5 Auch der entschärfte Schluss ist – wenn man ihm keine „ironisierende Funktion“ zugestehen will6 – angesichts des dramaturgischen Aufwands, den Kotzebue vorher betreibt, kaum akzeptabel. Diese offensichtlichen Defizite sollten jedoch nicht den Blick für das verstellen, was das Stück dann doch leistet: eine durchaus bemerkenswerte begriffliche wie ästhetische Auseinandersetzung mit der Menschenwürde.
KotzebuesKotzebue, August von Drama will wohl nicht radikal revolutionär sein und einen Aufstand oder Umsturz vorantreiben. Indem es aber sowohl an den Sklaverei- als auch an den Menschenwürdediskurs anknüpft, schafft es für beide ein öffentliches Bewusstsein.7
III.7. Dimensionen der Menschenwürde in KotzebuesKotzebue, August von Die Negersklaven
KotzebuesKotzebue, August von Drama macht deutlich, wie Literatur und Theater sich als eigenständige Diskurse entwerfen. Es begründet und konstituiert die Menschenwürde der Sklaven, die außerliterarisch missachtet und bestritten wird.
Die Dialoge zwischen den Figuren John und William etablieren die Menschenwürde als zentrales Thema des Stücks; diskursiv begründet William in deutlicher Abgrenzung zu seinem Bruder die Würde der Sklaven. Deren literarische Konstitution gelingt durch mehrere Strategien: KotzebueKotzebue, August von strebt durch die Zeichnung seiner schwarzen Sklavenfiguren als empfindsame, der europäischen Mentalität entsprechende Menschen (via Sprache, Gestik, Affekthaushalt, Normenhorizont) die IdentifikationIdentifikation des Rezipienten mit den Sklaven an. Identifikation ermöglicht MitleidMitleid – dieses wird nicht nur als menschenwürdige, sondern auch als die Menschenwürde des Bemitleideten sichtbar machende und garantierende Geisteshaltung markiert. Sympathie und Rezeptionshaltung lenkt Kotzebue recht explizit: durch Regieanweisungen, ausdrücklich formuliert in Redeanteilen, durch Kontrasteffekte. Die Figur William wird als innerfiktionaler Stellvertreter des Rezipienten angeboten; ihre Reaktionen und Bewertungen sollen übernommen und nachgeahmt werden. Die rhetorische HerabwürdigungEntwürdigung der Sklaven durch Sprechakte (Tiervergleiche, sowohl in der Fremd- als auch in der Selbstbeschreibung, und Verdinglichungen) sowie die Szenen und Erzählungen extremer GewaltGewalt gegen die Sklaven führen die Entwürdigungen drastisch vor Augen – und dienen ex negativo als Plädoyer für Gleichheit und Menschlichkeit. Nachdrücklich demonstriert das Stück: Die Entwürdigten sind keineswegs würdelosWürdelosigkeit. Vielmehr sind es jene, die Urheber von Entwürdigungen sind sowie des Mitleidens und der EmpathieEmpathie unfähig sind, die ihre Menschenwürde kompromittieren.
IV. Die Menschenwürde im Werk Georg BüchnersBüchner, Georg
Die Menschenwürde ist das zentrale Thema im Oeuvre Georg BüchnersBüchner, Georg.1 Mit beeindruckender Vehemenz fordern seine Texte die AchtungAchtung der Würde des Einzelnen ein. Sein literarisch-ästhetischer Umgang mit diesem Begriff lässt sich als konsequente Abkehr vom Menschenwürdeverständnis der von Heine geächteten „Kunstperiode“ beschreiben, als Distanzierung von seinem „Lieblingsfeind“,2 dem „Idealdichter“3 SchillerSchiller, Friedrich, und dessen Würdebegriff. Doch das greift zu kurz: Zum einen ist in den Gymnasialschriften Schiller durchaus noch die entscheidende Bezugsgröße, zum anderen greift Büchner Tendenzen auf, die auf den vorangegangenen Seiten benannt wurden: die Apologie des IndividuumsIndividuum, die bei J.M.R. LenzLenz, Jakob Michael Reinhold und K.P. MoritzMoritz, Karl Philipp (in der Erfahrungsseelenkunde) zu beobachten ist, der Fokus auf die KreatürlichkeitKreatürlichkeit und die soziale Bedingtheit des Menschen, die Lenz betont, die von LessingLessing, Gotthold Ephraim formulierte MitleidsMitleid- und Empathiepoetik, die in gesteigerter Form auch bei KotzebueKotzebue, August von zu finden ist, schließlich literarisch artikulierte und ästhetisch transportierte Kritik an Ausbeutung und GewaltGewalt. In den im Folgenden analysierten Texten – den Gymnasialschriften über den Freitod, dem Hessischen Landboten, Lenz und schließlich Woyzeck –, die jeweils einen ganz eigenen Beitrag zum Menschenwürdediskurs liefern, radikalisiert Büchner diese Ansätze. Zusammen ergeben sie die Dimensionen einer revolutionären Ästhetik der Menschenwürde.
IV.1. Die Menschenwürde in BüchnersBüchner, Georg Schulschriften und -reden über den Freitod
Der junge BüchnerBüchner, Georg ist noch in traditionellen Denk- und Deutungsmustern verhaftet. In den Schriften und Reden des Gymnasiasten manifestieren sich jedoch bereits Aspekte, die für seine spätere Menschenwürdeauffassung entscheidend sind.
In seiner Ende 1829 / Anfang 1830 entstandenen Schulrede HeldenHeld-Tod der vierhundert Pforzheimer verherrlicht BüchnerBüchner, Georg die kollektive Selbstaufopferung eines Pforzheimer Heeres im Dreißigjährigen KriegKrieg als freie Entscheidung autonomerAutonomie IndividuenIndividuum, für eine Idee in den Tod zu gehen.1 Am Anfang des Textes steht eine Definition des Erhabenen, die stark an SchillersSchiller, Friedrich Terminologie erinnert. In dessen Schriften findet sich neben anderen der Begriff der „erhabenen Würde“; sie ist eine dramenpoetische Kategorie, die auf der anthropologischen Grundannahme beruht, dass der Mensch mit Hilfe seines WillensWille, freier Wille und seiner VernunftVernunft in der Lage ist, sich über die Zwänge der Natur hinwegzusetzen.2 Büchner nimmt diesen Gedanken auf:
Erhaben ist es, den Menschen im Kampfe mit der Natur zu sehen, wenn er mit gewaltiger Kraft sich stemmt gegen die Wut der entfesselten Elemente und, vertrauend der Kraft seines Geistes nach seinem Willen die Kräfte der Natur zügelt. (MA 17)
Das Erhabene ist an dieser Stelle sowohl anthropologisch als auch ästhetisch zu verstehen: Erhaben ist zum einen der Mensch, dessen Geist und Willen mit der Natur kämpfen, zum anderen – und aus syntaktischer Perspektive zuallererst – das „[S]ehen“, die Wahrnehmung des kämpfenden Menschen. Was BüchnerBüchner, Georg hier beschreibt, ist also auch ein ästhetisches Phänomen: Der Mensch in seiner ästhetischen Wahrnehmung rückt in den Fokus.
„[N]och erhabner“ sei der Kampf mit dem Schicksal, das Eingreifen in die Geschichte und die Aufopferung des eigenen Lebens für einen Zweck, der den HeldenHeld einen „rühmlichen Tod“ und „Unsterblichkeit“ einbringe (MA 17): den Kampf „für Glaubens-FreiheitFreiheit“, „für das Licht der Aufklärung, […] für das, was dem Menschen das Höchste und heiligste ist“ (MA 19). Das Eintreten „für das heiligste Recht der Menschheit“ (MA 22–23), mithin für das Recht auf Wissen und eigenständiges Denken, sei Frucht der Reformation. Erst durch ihr Verdienst „erkannte die Menschheit ihre Rechte und ihren Wert“, ohne sie wäre das „Menschen-Geschlecht, das sich jetzt zu immer freieren, zu immer erhabneren Gedanken erhebt, dem TiereTier, Vertierlichung, Theriomorphisierung gleich, seiner Menschen-Würde verlustig“ (MA 19). Dass die Pforzheimer den Tod frei und mit großer Überzeugung wählten, ist für den jungen BüchnerBüchner, Georg eine zutiefst menschenwürdige Handlung. Sie „trieb nicht Wut nicht Verzweiflung zum Kampf auf Leben und Tod (dies sind zwei Motive die den Menschen statt ihn zu erheben zum Tiere erniedrigen)“; vielmehr „hatten [sie] freie Wahl, und sie wählten den Tod“ (MA 21–22). Er fährt fort:
Dies ist das große, dies ist das erhabne an ihrer Tat; dies zeugt von einem Adel der Gesinnung, der weit erhaben ist über die niedrige Sphäre des Alltagsmenschen, dem sein Selbst das Höchste ist, sein Wohlsein der einzige Zweck, der jedes höheren Gefühls unfähig und verlustig der wahren Menschen-Würde, seine VernunftVernunft nur gebraucht um tierischer als das TierTier, Vertierlichung, Theriomorphisierung zu sein. (MA 22)3
Gleich zweimal benutzt BüchnerBüchner, Georg das Kompositum „Menschen-Würde“, das in seinem Werk ansonsten nicht vorkommt.4 Was er darunter versteht, bleibt dem Würdebegriff der Aufklärung und der Klassik verpflichtet: Er greift die traditionelle Bindung der Würde an die VernunftfähigkeitVernunft des Menschen auf („Kraft seines Geistes“), die es ihm erlaubt, seine Wünsche zu reflektieren und autonomAutonomie zu handeln. Die Grenze zwischen Mensch und TierTier, Vertierlichung, Theriomorphisierung ist eindeutig; wer seine Menschenwürde verliert, wird zum Tier, ja fällt sogar noch eine Stufe tiefer. Aus dem besonderen „Wert“ des Menschen ergeben sich die mehrfach erwähnten „heiligsten Rechte“, die hier eine recht unbestimmte „FreiheitFreiheit“ bezeichnen. Bemerkenswert sind die politischen Folgerungen des Gymnasiasten: Den Aufständischen der Französischen Revolution, ebenso Vorbilder wie die Pforzheimer, war „ein freier Tod lieber als ein sklavisches Leben“ (MA 18). Denn das Schlimmste, was einem Staat passieren könne, sei der „Verlust [der] geistigen Selbstständigkeit“ (MA 24). Das Funktionieren des Staates ist demnach an die AchtungAchtung und Gewährleistung der individuellen Menschenwürde notwendig gebunden – hier scheint geradezu eine politische Utopie auf.