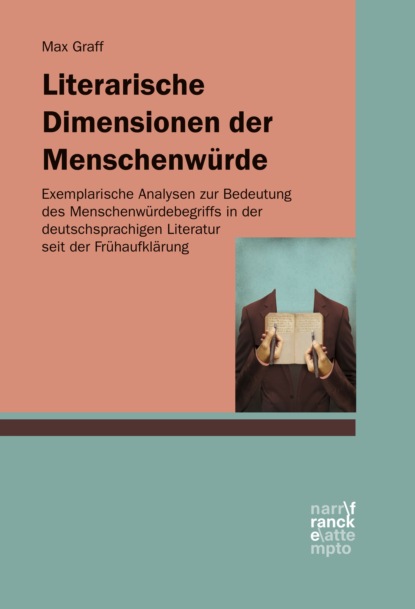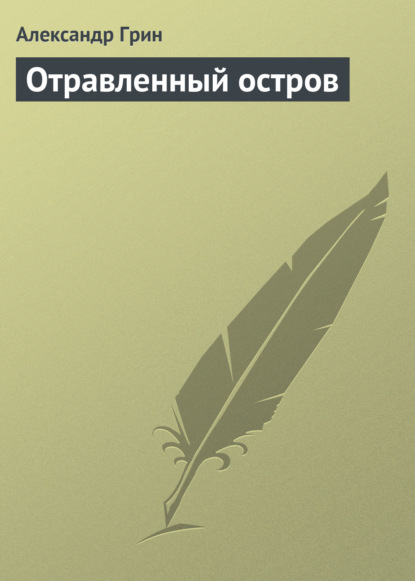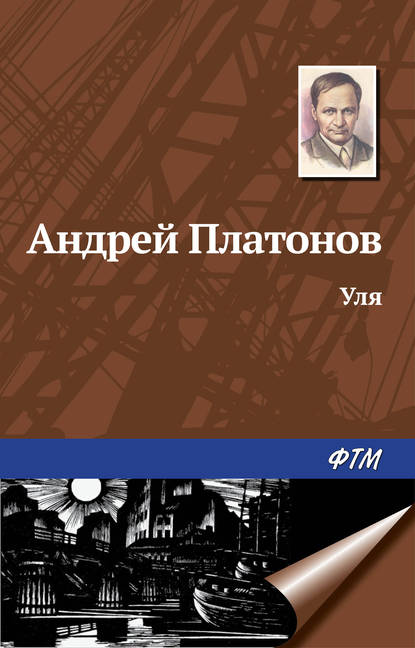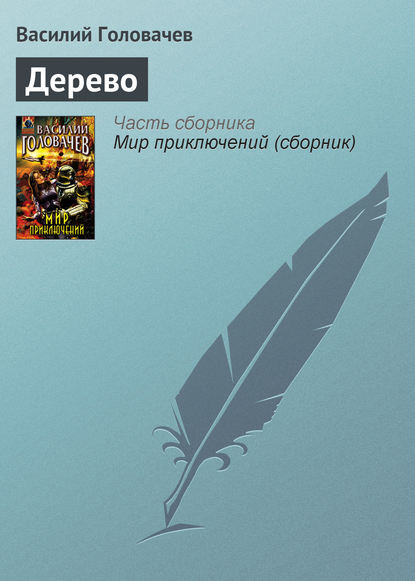- -
- 100%
- +
2. Um zu erklären, worauf die Menschenwürde in concreto gründet, werden verschiedene Paradigmata ins Spiel gebracht. Wetz unterscheidet drei „Bilder“ der Menschenwürde: religiös-christliche, vernunftphilosophische und säkular-ethische.14 Ganz ähnlich argumentiert Schaber, der die drei Schlagworte VernunftVernunft, GottebenbildlichkeitGottebenbildlichkeit und FreiheitFreiheit anführt.15 Sorgner konzentriert sich auf vier paradigmatische Grundpositionen, die vier Begründungsstrategien entsprechen: die menschliche Vernunftfähigkeit in Verbindung mit der Zugehörigkeit zur Spezies Mensch (mit dem paradigmatischen Vertreter CiceroCicero, Marcus Tullius), die Gottebenbildlichkeit (Manetti), der freie WilleWille, freier Wille (PicoPico della Mirandola, Giovanni della Mirandola), schließlich die AutonomiefähigkeitAutonomie (KantKant, Immanuel).16 Schüttauf spricht von drei ideengeschichtlichen Hauptlinien, die er mit jeweils einem Adjektiv qualifiziert: Der Mensch besitzt entweder Würde, weil er gut, frei oder brüderlich ist.17
3. Wie auch immer die Menschenwürde letztlich begründet wird, findet sie ihre Konkretisierung in einer Vielzahl von Begriffs- und Erfahrungsfeldern, in „Momente[n] der Würde“,18 deren Bestimmung und Beschreibung selbst wiederum untrennbar zu bestimmten Menschenwürdekonzepten gehören. Diese ‚Leitbegriffe‘19 gilt es im Auge zu behalten, wenn nach Dimensionen der Menschenwürde in einem literarischen Text gefragt wird. Sie konstituieren das semantische Feld der Menschenwürde, dessen einzelne, bisweilen äußerst disparate Elemente im Sinne der Wittgensteinschen Familienähnlichkeit aufeinander bezogen bleiben.20
1 Der Mensch nimmt als EbenbildGottebenbildlichkeit Gottes und Krone der SchöpfungKrone (der Schöpfung) eine kosmische Sonderstellung ein; er ist durch seinen besonderen Rang dem TierTier, Vertierlichung, Theriomorphisierung wie auch der Natur an sich übergeordnet.
2 Der Mensch ist aufgrund seines absoluten Werts und seines moralischen Status im Sinne des KantschenKant, Immanuel Kategorischen Imperativs stets als Selbstzweck zu betrachten.
3 Den vernunftfähigen Menschen zeichnet seine Personalität aus; er ist autonomesAutonomie Subjekt seiner Handlungen.
4 Menschenwürde impliziert WillensWille, freier Wille- und Entscheidungsfreiheit; der Mensch besitzt ein Recht auf SelbstbestimmungSelbstbestimmung, SelbstverfügungSelbstverfügung und leibseelische Integrität.21
5 Die Menschenwürde verpflichtet die Menschen zu gegenseitiger AchtungAchtung und Anerkennung; diese manifestieren sich in Kommunikation und Interaktion. Nur so ist auch SelbstachtungSelbstachtung als Voraussetzung von VerantwortungVerantwortung und geistiger Integrität möglich. Achtung und Selbstachtung setzen zudem ein Recht auf Intimität und Privatsphäre voraus.
6 Menschenwürde ist ein universelles, egalitäres Konzept, das die Gleichheit aller menschlichen Wesen als Rechtssubjekte und Toleranz gegenüber allen menschlichen Wesen postuliert.
7 Jedes menschliche Leben ist in seiner Würde zu respektieren; jedem Menschen müssen zumindest minimale materielle Existenzgrundlagen zugestanden werden.
8 Demütigungen, Erniedrigungen und Instrumentalisierungen sind grobe Verstöße gegen die Menschenwürde. Die Bestimmung und Beschreibung von MenschenwürdeverletzungenMenschenwürdeverletzung sind ein hilfreicher Weg, um die Menschenwürde ex negativo zu konkretisieren.22
Diese thesenartigen Formulierungen sind nicht als Versatzstücke einer Definition intendiert; sie machen vielmehr den „Sinnhorizont“ der Menschenwürde sichtbar und sichern ihn als Grundlage für das weitere Vorgehen. Gleichzeitig wird die Gefahr eines inflationären Gebrauchs des Menschenwürdebegriffs offensichtlich; wenn er benutzt wird, müssen sein Gehalt, sein Status und sein Funktionszusammenhang stets präzise umrissen werden.
III. Menschenwürde als ästhetisches Problem – Zu Vorgehen, Korpus und Erkenntnisziel
Die vorliegende Studie fragt nach den literarisch-ästhetischen Dimensionen und Implikationen des so wirkmächtigen wie unscharfen Begriffs der Menschenwürde. Sie stellt dem vielstimmigen Menschenwürdediskurs einen genuin literarischen zur Seite und bestimmt die Relevanz des Menschenwürdebegriffs für die Produktion, Rezeption und Interpretation von Literatur.
Aufgrund ihrer Vieldeutigkeit ist die Menschenwürde als analytische Kategorie für eine literaturwissenschaftliche Analyse prädestiniert; die Literatur hält Doppelbödigkeit, Ambiguität und das Fehlen endgültiger Lösungen nicht nur aus, sondern kalkuliert bewusst damit und entfaltet erst so ihre Sinnpotentiale. Die Literatur ist in dieser Sichtweise ein Medium, das gesellschaftliche und wissenschaftliche Diskurse aufnimmt und spiegelt, aber – und darauf kommt es an – auch eigene Lösungen anbietet.
Eine Untersuchung, die diachron literarische Dimensionen der Menschenwürde nachvollziehen will, steht vor zwei grundsätzlichen Schwierigkeiten: Zum einen ist der Begriff keineswegs scharf umrissen, sondern sowohl umstritten als auch historisch einem ständigen Wandel unterworfen. An das Textkorpus mit einem engen oder einem bestimmten historischen Verständnis der Menschenwürde (etwa PicosPico della Mirandola, Giovanni oder KantsKant, Immanuel) heranzutreten und dessen literarische Rezeption zu rekonstruieren, wäre zweifellos erkenntnisreich, würde aber stets nur eine bestimmte Dimension der Menschenwürde erfassen. Ebenso wenig führt eine positivistische Suche nach bestimmten Lexemen – ‚(Menschen-)Würde‘, ‚würdig‘, ‚unwürdig‘ usw. – an der Textoberfläche zum Ziel,1 auch wenn solche Belegstellen, falls es sie gibt, einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. Den Analysen liegt vielmehr ein abstrakter, inhaltsoffener Menschenwürdebegriff zugrunde, der der oben umrissenen Vieldeutigkeit des Konzepts Rechnung trägt. So können unterschiedliche Aktualisierungen, Perspektivierungen und Konzeptualisierungen der Menschenwürde sowie historische Entwicklungen in ihrer literarischen Verhandlung und ästhetischen Vermittlung erfasst werden.2 Intendiert ist ein analytischer Balanceakt: Die Begriffsgeschichte und Problematisierungen durch die Forschung werden zur Kenntnis genommen, gleichzeitig und vor allem aber soll die Literatur ‚unbefangen‘ zu Wort kommen.
Das Korpus der zu untersuchenden Texte ist bewusst breit und heterogen, d.h. gattungs- und epochenübergreifend angelegt. Die literarischen Texte werden in manchen Kapiteln von poetologischen oder anderen theoretischen Schriften flankiert, um die Wechselwirkungen zwischen programmatischen Positionierungen und literarischer Produktion beobachten zu können. Gelegentliche Exkurse und Seitenblicke, etwa auf die Philosophie SchopenhauersSchopenhauer, Arthur und NietzschesNietzsche, Friedrich oder die Flugblätter der Weißen RoseWeiße Rose, Die, sollen den literarischen Diskurs kontextualisieren. Angestrebt wurde eine Mischung aus kanonischen und eher weniger beachteten Texten, und dies mit der doppelten Absicht, sowohl zu neuen Perspektiven auf stark rezipierte Werke zu gelangen als auch zu zeigen, dass die Menschenwürde abseits des Kanons ein zentrales literarisches Thema ist. Ausdrücklich sollen exemplarische Analysen vorgelegt werden; das vollständige Abdecken aller literarischen Epochen und Strömungen seit der Renaissance ist weder intendiert noch im vorliegenden Rahmen realisierbar. Dass der Frühaufklärer GottschedGottsched, Johann Christoph am Anfang steht, ist nicht zuletzt mit dem SelbstbewusstseinSelbstbewusstsein, mit dem er den Neuanfang eines dezidiert deutschen Theaters proklamiert, zu begründen. Dabei steht außer Frage, dass auch eine Beschäftigung mit der frühneuzeitlichen Literatur – etwa mit rhetorischen Delegitimationsstrategien in Flugblättern und -schriften, mit grobianischer Literatur oder Märtyrerdramen – im Hinblick auf die Menschenwürde überaus fruchtbar wäre.
Die einzelnen Kapitel der Arbeit zeichnen paradigmatische Stationen des literarischen Menschenwürdediskurses bis in die Gegenwart nach. Anhand der ausgewählten Texte lassen sich bestimmte literarische Dimensionen der Menschenwürde mit besonderer Anschaulichkeit exemplifizieren. Die Kapitel sind als in sich abgeschlossene Analysen intendiert. Um die Fruchtbarkeit der Analysekategorie Menschenwürde zu illustrieren, stehen ausführliche Detailanalysen einzelner Werke neben tendenziell summarischen und vergleichend konzipierten Untersuchungen mehrerer Texte. Am Ende der Arbeit bündelt eine Zusammenschau die Ergebnisse thesenhaft. Dass dabei literaturhistorische Lücken entstehen – so fehlen etwa eingehende Analysen zur Literatur der Romantik, des Realismus und der Wiener Moderne, zu GoetheGoethe, Johann Wolfgang, Kleist, Thomas MannMann, Thomas, zur Post-DDR-Literatur –, ist zu beklagen, soll aber auch ein Anknüpfungspunkt für weitergehende Studien sein.
Ausgangspunkt für die Analyse des Korpus sind grundlegende Fragen: Wie verhält sich ein bestimmter Text – sei es ein poetologischer oder ein literarischer – zur Vorstellung einer besonderen Würde des Menschen? Wird diese vorausgesetzt, problematisiert, verworfen oder mit literarischen Mitteln inszeniert bzw. wiederhergestellt? Methodisch orientiert sich die Untersuchung an einem doppelten Leitfaden: Zunächst stützt sie sich auf die genaue und eingehende Arbeit am einzelnen Text, auf die präzise Beschreibung bestimmter literarischer Verfahrensweisen oder Mechanismen, um den genuin literarischen Umgang mit für den Fragehorizont einschlägigen Konzepten zu eruieren und deren sprachlich-rhetorische Verarbeitung aufzuzeigen. Dieser bewusste Verzicht auf komplexe theoretische Voraussetzungen und Zugänge lenkt den Fokus auf den eigentlichen Gegenstand literaturwissenschaftlicher Arbeit: den literarischen Text, der in seiner Konstruiertheit und in seinem Kunstcharakter ernstgenommen wird. Im Vordergrund steht die Frage, was die Literatur zum Menschenwürdediskurs beiträgt, worin genau ihre Leistung liegt. Daneben ermöglicht der Blick auf den geistes- und literaturgeschichtlichen Kontext, die spezifische Qualität eines Textes und damit seinen speziellen Beitrag zum Menschenwürdediskurs genauer zu fassen. Stets gilt jedoch das Hauptinteresse der Menschenwürde als literarisch-ästhetischem Problem und nicht vorrangig als inhaltlichem, stoff- oder geistesgeschichtlichem.
Ultimatives Erkenntnisziel dieser Studie ist keine Sammlung von Textstellen zur Menschenwürde, auch keine Begründung oder Definition der Menschenwürde, sondern eine Zusammenstellung von Thesen zum Verhältnis von Menschenwürde und Literatur, zur Bedeutung der Menschenwürde für die Literatur und vice versa – Umrisse einer Ästhetik der Menschenwürde, d.h. der Mittel und Funktionen ihrer literarischen Inszenierung.
IV. Terminologische Zwischenbemerkungen
Bevor die eigentliche literaturwissenschaftliche Analyse beginnen kann, sind einige terminologische und begriffliche Reflexionen geboten. Die Lexeme ‚Würde‘ und ‚Menschenwürde‘ wurden bislang synonym gebraucht; in unterschiedlichen Fachdiskursen werden, um das Konzept eines absoluten inneren menschlichen Werts zu bezeichnen, sowohl diese beiden Substantive als auch die Genitivphrase ‚Würde des Menschen‘ verwendet. Die folgenden semantischen Präzisierungen gelten zunächst dem Paar Würde/Menschenwürde, sodann dem Kompositum und der Phrase, schließlich zwei von der Forschung herausgestellten Paradoxa.
Tiedemann deutet das Kompositum ‚Menschenwürde‘ als „metasprachlichen Namen“ für den Satz: „Dem Menschen kommt Würde zu.“1 Dieser impliziert zwei Fragen, und zwar jene, was der Mensch, und jene, was Würde ist. Letztere ist an dieser Stelle von Belang: Würde (ahd. wirda, wirdî, werdî; mhd. wirde, werde) ist das Abstraktum zum Adjektiv ‚wert‘.2 Würde kommt also zunächst und ganz allgemein jemandem zu, der einen Wert besitzt. Der heutige Sprachgebrauch, so Tiedemann, unterscheidet drei Nuancen des Lexems ‚Würde‘: Würde „im Sinne von Rang, Status, Amt, Dienstgrad oder Titel“, Würde „als Wertprädikat“ in Bezug auf ein Verhalten oder eine Handlung, schließlich Würde als innerer Wert, der auf eine Gleichrangigkeit ihrer Träger abzielt.3 In den ersten beiden Fällen ist Würde kontingent, mit hierarchischen Implikationen. Die dritte Facette ist jene, die im Determinativkompositum ‚Menschenwürde‘ zum Tragen kommt: Diese innere Würde wird als eine spezifisch ‚menschliche‘, ‚dem Menschen eigene‘ gekennzeichnet; der Mensch ist also Träger dieser Würde. Ein Blick auf die lexikographische Geschichte des Kompositums bestätigt dies. Zum ersten Mal erscheint es als Lexem 1809 bei Campe: „Menschenwürde“ wird dort definiert als „die Würde des Menschen als eines vernünftigen über alle Erdgeschöpfe erhabenen Wesens; besonders die sittliche Würde des Menschen“.4 Das Grimmsche Wörterbuch erläutert knapp: „sittliche und geistige würde des menschen“.5 Der Duden schließlich verbucht ganz ähnlich: „geistig-sittliche Würde des Menschen“.6 Alle drei genannten Wörterbücher lösen demnach das Kompositum als Genitivphrase mit erklärendem, deutendem Zusatz auf – wohl nicht zuletzt, um deutlich zu machen, dass eben nicht eine kontingente, sozial konnotierte Form der Würde, sondern eine dem Menschsein innewohnende gemeint ist. Gleichwohl ist festzuhalten, dass alle drei Bedeutungen der Würde zur Begriffsgeschichte der Menschenwürde gehören – kaum eine Darstellung verzichtet darauf, kontingente Formen der Würde zu diskutieren, und sei es nur als Mittel der Abgrenzung. In der vorliegenden Untersuchung wird stets klar sein, welche Art der Würde gerade thematisiert wird: Ist es eine kontingente Form, wird dies explizit herausgestellt, dient ‚Würde‘ als Synonym für ‚Menschenwürde‘, wird der Kontext dies zweifelsfrei erkennen lassen.
Die in den Wörterbüchern – wie ja auch in Art. 1 GG – benutzte Genitivphrase verweist jedoch auf ein weiteres Problem: Besteht ein semantischer Unterschied zum Kompositum? In wissenschaftlichen Untersuchungen, Verfassungstexten und Urteilen des Bundesverfassungsgerichts werden ‚Menschenwürde‘ und ‚Würde‘ (mit oder ohne Genitivattribut ‚des Menschen‘) gemeinhin als quasi-austauschbare Ausdrücke verwendet.7 Dabei sind die zwei Formulierungen keineswegs identisch – nur kann rein linguistisch und ohne Berücksichtigung des Kontexts nur schwer scharf differenziert werden.8 Dennoch kann man sich versuchsweise annähern: Die Genitivphrase, wenn auch nicht so griffig wie das Kompositum, scheint sich aufgrund ihrer deiktischen Qualität (‚des Menschen‘) durch eine größere Emphase auszuzeichnen. Kritisch könnte man allerdings fragen, ob sie nicht durch ihre Bestimmtheit bereits ein philosophisches Programm impliziert – der Mensch etwa als intelligibles Wesen im Sinne KantsKant, Immanuel – oder normative Konnotationen zulässt. Das Determinativkompositum hat demgegenüber nicht mehr dieselbe semiotische Identität und semantische Klarheit wie die Genitivphrase. Es wirkt wie eine Art Verallgemeinerung der Aussage; nominale Komposita haben eine Tendenz zur Wechselbezüglichkeit und zu perspektivischen Verschiebungen, da die semantische Beziehung zwischen Determinans und Determinatum relativ offen ist.9 So könnte ‚Menschenwürde‘ theoretisch nicht nur die Würde des Menschen, sondern auch eines Menschen, der Menschen oder aller Menschen bedeuten. Der Schritt zu einer Formulierung wie ‚die Würde der Menschheit‘, v.a. im 18. Jahrhundert durchaus geläufig, ist nicht weit. Die Genitivphrase betont demnach eher den einzelnen Menschen als Träger der Würde, möglicherweise mit besonderem Akzent auf dem jeweiligen ideengeschichtlichen Hintergrund und dem damit verbundenen Menschenbild; das Kompositum konzipiert Würde eher als eine dem Menschen an sich eignende, egalitäre Qualität. Kurz: Eine Differenz ist durchaus theoretisch beschreibbar und kontextabhängig relevant; für das weitere Vorgehen dürfte sie allerdings kaum von analytischer Virulenz sein.
*
Das Nachdenken über die Menschenwürde lässt bisweilen Paradoxa hervortreten. So beschreibt Franz Josef Wetz das Paradox der Unantastbarkeit der Menschenwürde: Das „Dogma der Unantastbarkeit“10 des deutschen Grundgesetzes lässt sich sprachlich auf zweifache Art deuten – deskriptiv (die Würde des Menschen kann nicht angetastet werden) und normativ (die Würde des Menschen soll/darf nicht angetastet werden). Dies lässt sich, so Wetz, auf die doppelte Konzeptualisierung der Menschenwürde als unzerstörbares menschliches Wesensmerkmal sowie als AchtungAchtung und Schutz verlangenden Gestaltungsauftrag zurückführen.11 Ein Blick auf die alltägliche Realität – nicht nur in Krisengebieten, sondern auch in vermeintlich friedlichen Gesellschaften – führt zudem schmerzhaft vor Augen, dass die als unantastbar geltende Menschenwürde laufend ‚angetastet‘ wird. Wetz führt aus:
Wenn auch die Würde des Menschen unzerstörbar ist, so kann sie offenbar doch verletzt werden, und aus diesem Grund heraus bleibt sie auf staatlichen Schutz angewiesen. Vielleicht darf man sagen: Nur weil die Würde verletzlich ist, wurde sie als unverletzlich normiert […].12
Ralf Stoecker weist in seiner Auseinandersetzung mit Avishai Margalit auf das „Paradox der EntwürdigungEntwürdigung“ hin.13 Im spezifischen Kontext des Würdebegriffs Margalits, der eng mit dem Begriff der SelbstachtungSelbstachtung zusammenhängt, meint dieses Paradox folgendes: „[E]s wirkt paradox anzunehmen, dass eine Behandlung durch andere unsere eigene Selbstachtung beschädigen können sollte.“14 Anders formuliert: Es ist fraglich, wie im Hinblick auf einen entwürdigenden Vorgang die objektive von der subjektiven Ebene klar zu trennen ist, ob eine Entwürdigung überhaupt objektiv bestimmt werden kann oder stets eine Beschreibung vom subjektiven Standpunkt des vermeintlich Entwürdigten notwendig ist.
Wilfried Härle veranlassen ähnliche Überlegungen zu sprachlichen Betrachtungen. Er versteht Menschenwürde als „Anrecht auf AchtungAchtung als Mensch“.15 Dieses Anrecht ist tatsächlich unantastbar; insofern ergibt es wenig Sinn, von ‚EntwürdigungEntwürdigung‘, ‚WürdeverlustWürdelosigkeit‘, ‚WürdeverletzungMenschenwürdeverletzung‘, dem ‚Wiedergewinnen‘ von Würde o.Ä. zu sprechen. All dies würde implizieren, dass die Menschenwürde angetastet werden kann. Stattdessen kann laut Härle nur davon gesprochen werden, dass die Würde ‚missachtet‘ oder ‚abgesprochen‘ wird oder dass etwas mit der Menschenwürde ‚unvereinbar‘ ist:
Mit solchen Formulierungen bewegt man sich auf der zutreffenden sprachlichen Ebene, auf der es nicht um das Antasten des Anrechts auf AchtungAchtung des Menschseins geht, sondern ‚nur‘ um die (Miss-)Achtung dieses Anrechts.16
*
Nun sind solche Überlegungen maßgeblich von ihrem historischen Kontext beeinflusst; im gegenwärtigen Diskurs ist die Menschenwürde kaum noch isoliert von ihrer nationalen wie internationalen verfassungs- und völkerrechtlichen Relevanz und den damit verbundenen Begrifflichkeiten betrachtbar. Der literarische Diskurs ist demgegenüber viel weniger festgelegt; für jeden zu untersuchenden Text wird zu fragen sein, ob er die Menschenwürde als unantastbar, verlierbar, verletzbar oder gänzlich zerstörbar konzeptualisiert und wie er dies dann literarisch inszeniert. Die Analyse kann deshalb nicht darauf verzichten, ggf. von ‚EntwürdigungEntwürdigung‘ – hier und im Folgenden verstanden als Prozess des Angriffs auf oder des Absprechens von Würde – oder von ‚WürdelosigkeitWürdelosigkeit‘ – verstanden als Zustand der Abwesenheit oder des Verlusts von Würde – zu sprechen.
V. Menschenwürde und die Schöne Literatur – Forschungsüberblick
Das ausgeprägte multidisziplinäre Interesse am Begriff der Menschenwürde hat in den vergangenen zehn bis zwanzig Jahren eine erstaunliche Anzahl an Monographien, Sammelbänden und Aufsätzen hervorgebracht. Literaturwissenschaftliche Perspektiven nehmen hier jedoch nur einen marginalen Platz ein. So erscheint etwa im Wörterbuch der Würde lediglich ein Artikel zu SchillerSchiller, Friedrich1 – ein Indiz für das mangelnde Bewusstsein eines genuin literarischen Menschenwürdediskurses. Eine systematische Untersuchung der literarischen Dimensionen der Menschenwürde liegt noch nicht vor, auch wenn es nicht an Ansätzen fehlt. In der Tat lassen sich unterschiedliche Typen der Auseinandersetzung mit dem Komplex ‚Menschenwürde und Schöne Literatur‘ ausmachen.
1. Hans-Joachim Simm und Franz Josef Wetz haben jeweils eine Anthologie mit Texten zum Thema Menschenwürde herausgegeben. Simm bietet eine Art Florilegium, das zeigen will, „was Theologen, Philosophen, Juristen und Dichter […] zu verschiedenen Zeiten unter Würde verstanden haben“.2 Wetzʼ Textsammlung versteht sich als „Überblick über die religiöse, philosophische, politische und rechtliche Entwicklung der Würdeidee von der Antike bis in die unmittelbare Gegenwart“.3 Dass die Dichter nicht einmal eigens erwähnt werden, obwohl doch Texte von Petrarca, ShakespeareShakespeare, William, SchillerSchiller, Friedrich, Gorki und Thomas MannMann, Thomas zitiert werden, ist bezeichnend: Die Literatur wird eher als Spiegel- und Illustrationsmedium denn als eigener Diskurs mit eigenen Mitteln und Aussagen wahrgenommen.
2. Einige monographische Darstellungen, besonders solche, die sich nicht an ein Fach-, sondern an ein größeres Publikum richten, bedienen sich literarischer Verweise, um ihre Ausführungen zu illustrieren. Peter Bieri etwa entwickelt seine Vorstellung von Würde als einer „Art zu leben“ anhand ausführlich beschriebener literarischer (und filmischer) Szenen.4 Bisweilen werden auch isolierte Zitate aus literarischen Werken als Argumentationshilfe oder als rhetorischer Schmuck funktionalisiert.5 In solchen Fällen steht primär der Inhalt des literarischen Textes, die reine ‚Aussage‘, und nicht die untrennbare Verzahnung von Mitteilung und formaler Gestaltung im Fokus.
3. Eine ganze Reihe von Literaten wurde in unterschiedlichen Kontexten mit dem Prädikat ‚Dichter der Menschenwürde‘ oder ähnlichen Formulierungen belegt. So wurde etwa Friedrich SchillerSchiller, Friedrich „Kämpfer für Menschenwürde und FreiheitFreiheit“ genannt, Friedrich Hebbel als Dichter der „verletzte[n] Menschenwürde“ charakterisiert; ein Ausstellungskatalog zu Leben und Werk Ludwig Börnes trägt den Untertitel „Freiheit, Recht und Menschenwürde“, Joseph Roth wurde attestiert, er schreibe von der „Würde des Unscheinbaren“, Siegfried Lenz von der „Würde der Verlierer“.6 Solche Auszeichnungen, aus inhaltlichen Gründen zweifellos berechtigt, sind auch der Versuch einer besonderen ‚Würdigung‘ eines Autors durch den auratischen Begriff der Würde.
4. Literaturwissenschaftliche Beiträge, die die Menschenwürde thematisieren, tun dies mit unterschiedlicher Intensität und verschiedenartigem Anspruch. Bisweilen wird der Begriff prominent in Interpretationen verwendet, ohne dass er jedoch als zentrale analytische Kategorie dient und ohne dass er auf seine spezifisch literarischen Dimensionen hin befragt wird – sein Stellenwert bleibt so eher punktuell.7 Größere Aufmerksamkeit wurde der Menschenwürde im Zusammenhang mit der Literarisierung des Sterbens und des Todes gewidmet. Walter Jens beschreibt schlaglichtartig „[d]ie Literatur über Würde und WürdelosigkeitWürdelosigkeit des Sterbens“.8 Helmuth Kiesel und Christine Steinhoff untersuchen in überblicksartigen Beiträgen, wie die deutschsprachige Literatur in unterschiedlichen Epochen das würdevolle bzw. würdelose Sterben imaginiert und welche Konsequenzen sich daraus für die literarische Darstellung ergeben.9 Karin Tebben beschreibt den SuizidSuizid als paradigmatisches Motiv des literarischen Menschenwürdediskurses und stellt fest:
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wird in der Literatur kein aktiver Beitrag zum rechten Verständnis menschlicher Würde geliefert, sondern ein implizit-passiver: den literarischen Figuren ist die Würde genommen; sie sind Verzweifelte, die die Last des Weiterlebens nicht mehr ertragen können.10
Die Grundthese, dass die nachklassische bzw. nachromantische Literatur die Vorstellung der Menschenwürde nur noch ex negativo aufruft, wird im Folgenden zu prüfen sein.