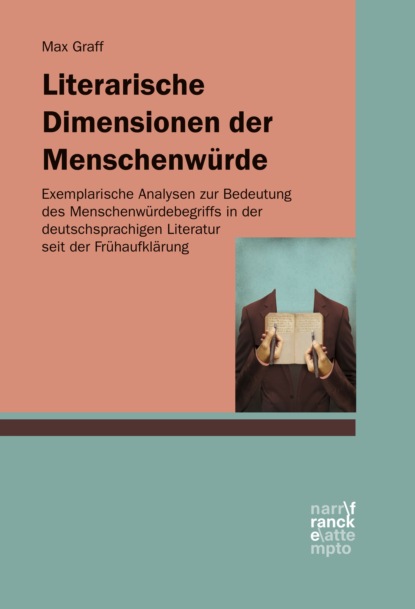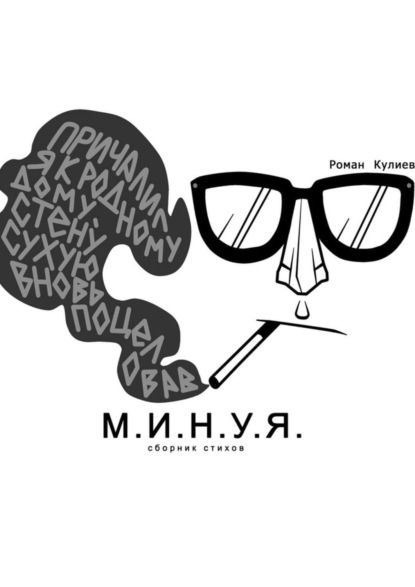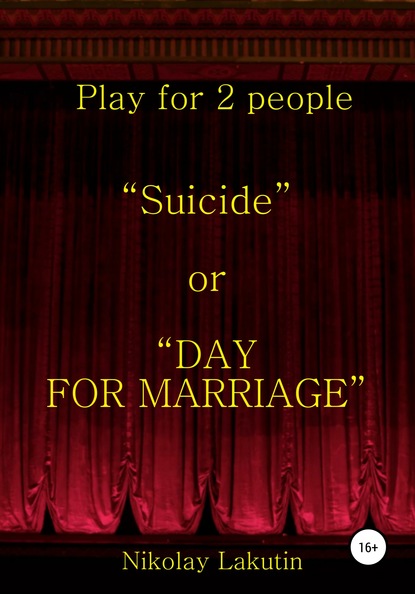- -
- 100%
- +
Eine genuin ästhetische Dimension der Menschenwürde bestimmt Gilbert D. Chaitin in seinem Beitrag über die innovative, ja revolutionäre Qualität des style indirect libre in Émile Zolas LʼAssommoir (1877). Indem Zola nicht nur aus der Innensicht des Proletariats erzähle, sondern auch dessen Sprache in den discours (Genette) aufnehme, verleihe er gerade den in prekären Verhältnissen lebenden Figuren jene für eine demokratische GesellschaftGesellschaft unerlässliche Menschenwürde.11
Daneben stellen einige Interpreten den Begriff der Menschenwürde durchaus ins Zentrum ihrer Auseinandersetzung mit einem einzelnen oder dem Gesamtwerk eines Dichters. Heinz Müller-Dietz untersucht das Werk Georg BüchnersBüchner, Georg aus der Perspektive der naturrechtlichen Menschenwürdevorstellung.12 Udo Ebert – wie Müller-Dietz bezeichnenderweise Rechtswissenschaftler – hat eine Darstellung der unterschiedlichen Facetten der Menschenwürde bei SchillerSchiller, Friedrich vorgelegt, deren methodische Grundvoraussetzung sich mit jener der vorliegenden Studie deckt: Seinen Ausführungen liegt ein abstrakter, inhaltsoffener Würdebegriff zugrunde, dessen Konkretisierungen und Nuancierungen in verschiedenen Schriften Schillers nachvollzogen werden.13 Als Schlüsselbegriff einer eingehenden Faust-Deutung dient die Menschenwürde Thomas Weitin. Er beschreibt GoethesGoethe, Johann Wolfgang Drama als „Gründungstext[], der für die Selbstbehauptung der Menschenwürde am Beginn der normativen Moderne ausschlaggebend ist“, und zeigt, „wie die Menschenwürde ihre universelle normative Geltungskraft aus der Übertragungsleistung einer absoluten Metapher gewinnt“. Weitin betont auch die darstellungsästhetischen Implikationen der Menschenwürde, die im Faust „als etwas [inszeniert werde], das sich der repräsentativen Verkörperung durch eine dramatische Person entzieht“.14
Weniger auf konkrete literarische Verfahrensweisen als auf Status und Potential der Literatur fokussieren sich zwei Ansätze aus der amerikanischen Literaturwissenschaft. Joseph R. Slaughter konstatiert eine „narratologische Allianz“ zwischen dem Bildungsroman der deutschen Klassik und dem internationalen Menschenrechtsdiskurs:15 „Human rights and the Bildungsroman are mutually enabling fictions: each projects an image of the human personality that ratifies the otherʼs vision of the ideal relations between individual and society.“16 Als ‚demarginalisierende‘ Gattung stelle der Bildungsroman ein „kulturelles Surrogat“ dar, das den Glauben an Menschenwürde, MenschenrechteMenschenrechte und deren Allgemeingültigkeit fördert – jenseits rein juristischer Erwägungen, sondern im Prozess der Rezeption und der Diskussion des literarischen Texts.17 In eine ähnliche Richtung geht Elizabeth S. Anker in ihrer Studie Fictions of Dignity, jedoch unter anderen methodologischen Vorzeichen. Ihre dezidiert postkoloniale Herangehensweise ist der Phänomenologie Merleau-Pontys verpflichtet und hinterfragt den „widersprüchlichen Status des KörpersKörper“ im Menschenrechtsdiskurs.18 Anker beklagt, dass liberale Menschenrechtsvorstellungen auf der doppelten Fiktion menschlicher Würde und körperlicher Integrität beruhen, das IndividuumIndividuum hier also quasi körperlos gedacht und die Vorstellung eines „Embodiment“ menschlichen Bewusstseins und Erlebens vernachlässigt wird.19 Ihre Interpretation vierer postkolonialer Romane20 versteht Anker als „embodied politics of reading“; indem sie zeigt, wie literarische Texte ästhetisch das Bewusstsein der körperlichen Verfasstheit des Menschen wiederherstellen, will Anker die vermeintlich vorherrschende Menschenwürdevorstellung, die untrennbar an die körperliche Integrität des Einzelnen geknüpft ist, korrigieren.21
Im Hinblick auf den Anspruch der vorliegenden Arbeit erscheinen diese beiden Positionen ambivalent: Einerseits gehen sie zu Recht davon aus, dass es einen genuin literarischen Menschenwürde- bzw. Menschenrechtsdiskurs gibt und dass dieser als solcher ernst genommen werden muss. Andererseits betrachten sie die Literatur dann doch vor allen Dingen als Korrektur- oder Sensibilisierungsinstanz und beschreiben ihre Funktion für sowie ihren Einfluss auf außerliterarische Diskurse. Gegenüber der präzisen Beschreibung ästhetischer Verfahrensweisen und literarischer Inszenierungen der Menschenwürde tritt das mentalitäts- und bewusstseinsbildende Potential der Literatur in den Vordergrund.22
Paul Michael Lützeler schließlich hat eine Studie vorgelegt, die anhand deutschsprachiger Gegenwartsromane, die sich mit internationalen Bürgerkriegssituationen auseinandersetzen, das Verhältnis von Literatur und einem „Menschenrechtsethos, das auf dem Schutz der Menschenwürde basiert“, untersucht.23 Bei der Analyse dieser Texte, die „Menschenrechtsverletzungen in den Mittelpunk ihrer Darstellungen [rücken]“, greift Lützeler auf ein „Zusammenspiel von Textlektüre, theoretischer Bemühung und historischer Rekonstruktion“ zurück. Er liest die untersuchten Romane als „Teil eines aktuellen Menschenrechtsdiskurses“, an dem Schriftsteller mit ihren eigenen Mitteln, die sich von jenen anderer Disziplinen wesenhaft unterscheiden, partizipieren. Lützeler betont zudem den „ästhetischen Mehrwert“ des literarischen Texts24 – und wählt somit ein Vorgehen, das dem in der vorliegenden Arbeit vorgeschlagenen nahe kommt.
5. Von rein rechtlicher Relevanz ist die Menschenwürde, wenn die Literatur ins Zentrum juristischer Auseinandersetzungen rückt. Das prominenteste Beispiel der letzten Jahre ist Maxim Billers autobiographisch gefärbter Roman Esra (2003), dessen Verbot 2007 vom Bundesverfassungsgericht bestätigt wurde, da es Intimsphäre und Persönlichkeitsrechte der ehemaligen Lebensgefährtin des Autors, die im Roman als titelgebende Figur auftritt, verletzt sah. Konkret konfligierten in diesem Fall die Freiheit der KunstKunst, Künstler (Art. 5 Abs. 3 GG), das absolute Menschenwürdepostulat (Art. 1 GG) und das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 GG).25
6. Gerade wenn den Textanalysen ein inhaltsoffener Menschenwürdebegriff zugrunde gelegt wird, ist die Nähe zu verwandten Fragestellungen groß, etwa zu Fragen nach den Begriffen der HumanitätHumanität oder des Subjekts, nach dem Status des IndividuumsIndividuum und bestimmter Menschenbilder, nach der Literarisierung und der Legitimität von GewaltGewalt, HässlichkeitHässliche und ObszönitätObszönität, nach dem Verhältnis von Literatur und Recht, nach pornographischen oder grobianischen Motiven, nach dem in der KunstKunst, Künstler Erlaubten.26 Umso nachdrücklicher müssen im Folgenden textuelle Befunde auf den Begriff der Würde fokussiert und auf ihren spezifischen Beitrag zum Menschenwürdediskurs hin befragt werden.
B. Literarische Dimensionen der Menschenwürde: Exemplarische Analysen
I. „Was sich vor mich nicht schickt, das werd ich auch nicht tun“ –
Die Menschenwürde in GottschedsGottsched, Johann Christoph Sterbender Cato (1732)
Im deutschsprachigen literarischen Menschenwürdediskurs nimmt der Frühaufklärer und Literaturreformer Johann Christoph GottschedGottsched, Johann Christoph eine Schwellenposition ein. Auf der einen Seite bestimmt er mit einer für den RationalismusRationalismus der Frühaufklärung typischen Systematik die Funktion der Dichtkunst gerade auch im Hinblick auf den Menschen, sein Wesen und seine moralische Disposition. Auf der anderen Seite ist der Begriff der Menschenwürde zwar zentral für sein Verständnis von Literatur und für die Interpretation seiner ‚Mustertragödie‘ Sterbender Cato; die intensive theoretische Fundierung und die explizite programmatische Bedeutung, die die Menschenwürde bei KantKant, Immanuel bzw. bei SchillerSchiller, Friedrich erlangt, ist bei Gottsched jedoch lediglich in Ansätzen nachweisbar. Zudem unterscheidet sich das frühaufklärerische Würdeverständnis noch wesentlich von Kants Begriff einer genuin inhärenten Menschenwürde.
I.1. GottschedsGottsched, Johann Christoph akademische Reden über den Menschen
In den drei Leipziger „Akademische[n] Rede[n], zur Vertheidigung GottesGott und des menschlichen Geschlechts“ (1730),1 die zeitlich dem Erscheinen der Critischen Dichtkunst (1730) sowie der Arbeit am Sterbenden Cato (1732) nahe stehen, entfaltet GottschedGottsched, Johann Christoph mit hohem rhetorischen Aufwand und großem rednerischen Pathos seine Sicht auf Status, Wesen und Würde des Menschen – auch wenn er die Vokabel ‚(Menschen-)Würde‘ nicht explizit benutzt.
Der Menschenwürdebegriff dieser Reden ist eklektisch. Den besonderen Status des Menschen macht der Theologe GottschedGottsched, Johann Christoph nicht überraschend zunächst am göttlichen SchöpfungsaktSchöpfung fest (AW IX/2, 454). Doch nicht nur als GottesGott Geschöpf ist der Mensch ausgezeichnet; GottGott hat ihn vielmehr zur ‚Krone der SchöpfungKrone (der Schöpfung)‘ auserkoren. Die Menschen sind „die Meisterstuͤcke der goͤttlichen Weisheit, Macht und Guͤte“ (AW IX/2, 418), die „Gott zum Fuͤrsten aller uͤbrigen [Geschöpfe] bestimmet, und de[nen] zum Besten er alles uͤbrige so wunderwuͤrdig eingerichtet und angeordnet hat“ (AW IX/2, 420–421). Zwar ist der Mensch auch nur eines „unter den uͤbrigen Thieren“ (AW IX/2, 421), er besitzt aber, gleichsam ein zweiter Schöpfer – wohl in Anlehnung an den Renaissance-Philosophen PicoPico della Mirandola, Giovanni della Mirandola –, die Fähigkeit, mit seiner Umwelt schöpferisch, gestaltend und unterwerfend umzugehen.2 Schließlich beruft sich Gottsched auf die klassische biblische Menschenwürdedefinition; der Mensch sei „die kleine Gottheit auf Erden, das EbenbildGottebenbildlichkeit des allerhoͤchsten Wesens“ (AW IX/2, 425).
Neben diesem christlichen Begründungsmuster steht das für den RationalismusRationalismus der frühen Aufklärung typische vernunftphilosophische:
Die VernunftVernunft, meine Herren, bloß die Vernunft ist dasjenige, was den Menschen zum Koͤnige aller andern Thiere gemachet hat. Die Vernunft ist das Werkzeug, wodurch er alle seine erstaunlichen Thaten tut. (AW IX/2, 422)3
Allerdings assoziiert GottschedGottsched, Johann Christoph mit der Vernunftbegabung des Menschen keine unverlierbare, allen Menschen gleichermaßen eignende inhärente Würde. Das belegen drei Sachverhalte. Erstens wird mit Verweis auf die VernunftVernunft gerade auch die kontingente soziale, auf der gesellschaftlichen Hierarchie beruhende Würde legitimiert:
[Die VernunftVernunft] unterwirft die Knechte ihren Herrschaften, zu Befoͤrderung ihres beyderseitigen Wohls […]. Selbst Republiken, Fuͤrstenthuͤmer, Koͤnigreiche und Kaiserthuͤmer sind bloß ihr Werk. (AW IX/2, 422–423)
Zweitens wird die Vernunftbegabung allein keineswegs als Grund für einen bereits a priori eingeräumten Sonderstatus gedeutet. „[W]ilde[] Menschen“, die außerhalb der menschlichen Zivilisation aufwachsen und ihre VernunftVernunft nicht durch den Umgang mit verständigen Menschen schulen, bezeichnet GottschedGottsched, Johann Christoph als „Bestien“ (AW IX/2, 434). Eindeutig ist die Erlangung von Würde also an ein heteronomes Ideal gebunden; sie ist Ergebnis eines Bildungsprozesses. Darin äußert sich der Glaube an die Möglichkeit – aber auch die Forderung nach – einer geistigen und sittlichen VervollkommnungPerfektibilität, Vervollkommnung des Menschen. Drittens schließlich bezieht sich die moralische Bewertung des Menschen auf das Naturrecht.4 Die Vernunft „unterscheidet Laster und TugendTugend“ (AW IX/2, 422). Maßstab für ein sittliches Urteil ist dabei „das ewige Gesetz der Natur“. Dieses definiert Gottsched als das „Gesetz der Gluͤckseligkeit, welches allen Menschen ins Herz geschrieben ist“ (AW IX/2, 447).5 Das ultimative Ziel der Glückseligkeit ist jedoch bereits bei Christian WolffWolff, Christian nicht auf die subjektive Ebene beschränkt; es ist die naturrechtliche Pflicht des Menschen, für die Glückseligkeit und die Vervollkommnung der gesamten GesellschaftGesellschaft zu sorgen.6 Die folgende Maxime des 7. Stückes der moralischen Wochenschrift Der Mensch ließe sich demnach auf Gottscheds Ausführungen übertragen: „Je mehr jemand tugendhaft ist, je mehr ist er ein Mensch. Je weniger man tugendhaft ist, je weiter entfernt man sich von der Menschheit und ihrer Wuͤrde.“7
Den dritten „Vorzug“ des Menschen – neben seiner Eigenschaft als ‚Krone der SchöpfungKrone (der Schöpfung)‘ und seiner Vernunftbegabung – findet GottschedGottsched, Johann Christoph schließlich „in seinem schoͤnen, starken und dauerhaften Koͤrper“ (AW IX/2, 428), wobei er den KörperKörper und dessen Bau streng teleologisch deutet. Schönheit und Zweckmäßigkeit des menschlichen Körpers als Zeichen der Würde und des planvollen göttlichen Wirkens – diese Argumentation knüpft unverkennbar an humanistisches Erbe an.8 Den Einwand, dass der Körper des Menschen doch schwach und anfällig sei, sieht Gottsched nicht als Widerspruch, sondern dreht ihn geradezu um: „[D]er Mensch [hat] nothwendig so schwach gebohren werden muͤssen; damit er ein vernuͤnftiges Geschöpf, und ein Herr aller andern Thiere werden koͤnnte“ (AW IX/2, 433). Die Krankheit, mithin das Prekäre und HässlicheHässliche der menschlichen Existenz, ist lediglich der Ausnahmefall, der Schönheit und Vollkommenheit des Menschen und seines Körpers bestätigt (vgl. AW IX/2, 435).
GottschedGottsched, Johann Christoph spricht dem Menschen also Würde zu – wenn auch keine eindeutig inhärente – und begründet dies theologisch, vernunftphilosophisch, naturrechtlich und anthropologisch.9 Die Auseinandersetzung mit Wesen und Würde des Menschen ist für Gottsched nun kein rein philosophisches, sondern auch ein ästhetisch-poetologisches Unterfangen, heißt es doch in seiner Critischen Dichtkunst: „Vor allen Dingen aber ist einem wahren Dichter eine gruͤndliche Erkenntniß des Menschen noͤthig, ja ganz unentbehrlich“ (AW VI/1, 156). Wenn der Mensch nämlich der moralischen VervollkommnungPerfektibilität, Vervollkommnung fähig ist, so hat in diesem Prozess nicht zuletzt die KunstKunst, Künstler einen wesentlichen Beitrag zu leisten.10
I.2. Exkurs I: Die Menschenwürde in den moralischen Wochenschriften der Aufklärung
Anders als GottschedsGottsched, Johann Christoph Reden thematisieren die moralischen Wochenschriften der Aufklärung auch explizit die „Würde des Menschen“; die inhaltlichen Überschneidungen sind deutlich.1 Beispielhaft illustriert das 5. Stück des Leipziger Zuschauers (1759) diese Vorstellung von Menschenwürde. Der Grundtenor ähnelt dem der Reden: Der Mensch soll gegenüber jenen verteidigt werden, die „die Wuͤrde des Menschen, und seine erhabne Bestimmung“2 verkennen und seine Schwächen und Laster hervorheben. An die „Sittenlehrer“ ergeht die Aufforderung,
die menschliche Natur in ihrer Wuͤrde zu zeigen, […] ihren Muth anzufeuern, die ebnen Wege der TugendTugend zu gehn, ihnen die Bewegungsgruͤnde zum Guten aus dem Verhaͤltniß, in welchem der Mensch mit seinem Schoͤpfer steht, so dringend vorzustellen, daß das Uebergewicht seiner Neigung auf die Seite der Tugend ausschluͤge.3
Menschenwürde wird jedoch, und hier besteht ein gewichtiger Unterschied zu GottschedGottsched, Johann Christoph, ganz explizit sowohl als „angeborne[]“ Qualität als auch Auftrag an den Einzelnen konzeptualisiert: Der Mensch ist Gottes EbenbildGottebenbildlichkeit, doch wenn er „seine Wuͤrde verkennt“, gereicht ihm dies zur „Schande“.4 Der „tugendhafteTugend“ Mensch nähert sich dem „Engel“ an, der „lasterhafte“ dem „Thier“.5 Ziel des Menschen muss es sein, „GottGott, die Tugend, und den unschaͤtzbaren Werth seiner Seele kennen [zu] lern[en]“.6 Auch hier ist Würde letztlich heteronom definiert; der Mensch ist zwar ein würdevolles Wesen, riskiert aber, diesen Status zu verlieren, wenn er sein Potential nicht ausschöpft und die Tugend verfehlt. Der Leipziger Zuschauer verbindet nun den menschlichen Auftrag zur VervollkommnungPerfektibilität, Vervollkommnung mit den Wirkmöglichkeiten der Literatur; nicht nur die „Sittenlehrer“ sind in der Pflicht, den Menschen an seine Würde zu erinnern, sondern auch die Dichter.7
I.3. Exkurs II: Die Ständeklausel – kontingente Würde als problematische Voraussetzung für Tragödienfähigkeit
In seinem Versuch einer Critischen Dichtkunst stellt GottschedGottsched, Johann Christoph unmissverständlich klar, wie der HeldHeld einer Tragödie (im Gegensatz zur Komödie) gestaltet werden muss. Um seinen moralischen Lehrsatz zu illustrieren, „sucht [der Dichter] in der Historie […] beruͤhmte Leute“, die dafür geeignet scheinen, „und von diesen entlehnet er die Namen, fuͤr die Personen seiner Fabel, um derselben also ein Ansehen zu geben“ (AW VI/2, 317). Es sind die „Großen dieser Welt“ (AW VI/2, 312), an deren Schicksal Gottscheds Wirkintention gekoppelt ist. Der Held der Tragödie muss einen hohen sozialen Status haben und moralisch vorbildlich sein; trotzdem muss er auch ein mittlerer Held sein, d.h. gemäß des hamartia-Modells des Aristoteles einen charakterlichen Fehler haben, der sein Scheitern erklärt, rechtfertigt und somit die erhoffte Reflexion beim Publikum in Gang setzt.1 Im Hinblick auf die Würdeproblematik formuliert: Kontingente Formen der Würde (soziale Würde, Ansehen, Annäherung an ein TugendidealTugend) werden zur wirkästhetischen Voraussetzung der Tragödie. Die Würde (sowohl die soziale als auch die sittliche) des Protagonisten muss bewundert, sein Scheitern betrauert werden, damit der Zuschauer, nachdem er aus dem beklagten Scheitern die richtigen Schlüsse gezogen hat, zur Nachahmung angeregt wird. Doch dies führt zu einem Widerspruch: Kontingente Würde ist auf der einen Seite Bedingung für die Tragödienfähigkeit eines Charakters, was durch Berufung auf tradierte Regeln legitimiert wird; auf der anderen Seite ist das Ziel des Aufklärers die Förderung und Verankerung eines für alle Menschen geltenden Norm- und Tugendsystems.2 Durch diesen Widerspruch entsteht eine logische Spannung, die der Dichter ästhetisch bewältigen muss.3
I.4. Sterbender Cato
GottschedsGottsched, Johann Christoph zunächst erfolgreiche und wirkmächtige Tragödie Sterbender Cato wird heute meist mit Skepsis betrachtet. Die Forschung prangert die kühle Regelhaftigkeit des vermeintlich unoriginellen Dramas an und weist auf konzeptionelle Schwächen in der Figurenzeichnung hin.1 Gottscheds in der Vorrede formulierte Wirkabsicht, Bewunderung und zugleich „MitleidenMitleid“, „Schrecken und Erstaunen“ zu wecken,2 gehe vollkommen fehl.
Tatsächlich liegen dieser Wirkabsicht unterschiedliche Aspekte des Gottschedschen Menschenwürdebegriffs zugrunde, die unauflösliche Widersprüche zur Folge haben. Die unterschiedlichen Auslegungen der Menschenwürde spitzen sich in der Bewertung des Freitods Catos zu; die Art der Inszenierung des SuizidsSuizid an sich bringt schließlich eine zusätzliche darstellungs- und rezeptionsästhetische Dimension der Menschenwürde ins Spiel. Die Herausforderung des Sterbenden Cato ist demnach die Explikation der Grundspannung des Dramas, die sich aus folgenden Faktoren ergibt: der vermeintlich vorbildlichen TugendhaftigkeitTugend des Protagonisten, dem eindeutig als Fehlhandlung verstandenen Suizid, der genauen Bestimmung des tragischen Fehlers des HeldenHeld sowie der von der historischen Überlieferung merklich abweichenden Darstellung des Selbstmordes.
I.4.1. Catos Handeln als Beweis und Garant seiner Menschenwürde
Damit Cato außerfiktional zum bewundernswerten und somit letztlich zum „mitleidswürdig[en]Mitleid“ (SC 112) HeldenHeld der Tragödie werden kann, muss sein Handeln innerfiktional so geschildert werden, dass er tugendhaftTugend und würdig erscheint, und zwar nicht nur im Sinne des Stoizismus (bei aller Kritik GottschedsGottsched, Johann Christoph an dieser Doktrin), sondern auch und vor allem im Sinne des bereits umrissenen frühaufklärerischen Menschenbildes.1 Deshalb muss der SuizidSuizid, an dessen Illegitimität für Gottsched keine Zweifel bestehen,2 zumindest als Folge einer nachvollziehbar positiv besetzten Eigenschaft inszeniert werden. Dies soll dadurch gelingen, dass Cato als standhafter, seine Affekte reflektierender und überwindender Charakter gezeichnet wird, der autonomAutonomie entscheidet und handelt. Arsene/Portia dient in dieser Hinsicht als Spiegelfigur, die gleichzeitig als vorsichtiges Korrektiv angelegt ist.
In Szene I,4, in der Cato und sein Diener Phocas die Enthüllung der wahren IdentitätIdentität Arsenes diskutieren, wird das, was Cato als bewundernswerte Figur, die menschenwürdig handelt, auszeichnen soll, besonders augenfällig. Die Nachricht, dass seine totgeglaubte Tochter Portia lebt, jedoch als Königin der Parther seinem republikanischen Ideal zutiefst widerspricht, ruft heftigste Emotionen hervor: „Wie? Soll mein eigen Blut mir Brust und Herz zerreißen?“ (SC 28, V. 209). Vaterliebe und politische Gesinnung konfligieren: „Mein Blut erlaubt es zwar“, Portia zu lieben, „doch Rom“, und das heißt: seine tiefsten politisch-moralischen Überzeugungen, „verbeut es allen!“ (SC 28, V. 218). Dass Cato seinen Überzeugungen den Vorrang vor jeder affektiven Regung gibt, wird noch deutlicher, als er die Versuchung, mit Hilfe der Königin Portia Cäsar zu bekämpfen, ablehnt. „Was recht und billig ist, sonst rührt mich nichts auf Erden!“ (SC 29, V. 246) – der Zweck heiligt also keineswegs die Mittel, denn: „[…] wer die TugendTugend liebt, geht lieber selbst darauf“ (SC 29, V. 248). Cato legt seinem Handeln und seinem Entscheiden eine strenge sittliche Maxime zugrunde, die zu diesem Zeitpunkt durchaus bewundernswert erscheint, gleichzeitig aber proleptisch auf seinen Tod verweist – ein Signal, dass seine standhafte Tugendhaftigkeit später zu problematisieren sein wird. Noch aussagekräftiger ist Catos Reaktion auf Phocasʼ Vorschlag, die Götter durch ein Opfer um Rat zu fragen. „Die Götter fehlen nie“, so Phocas (SC 29, V. 254), doch Cato lehnt es ab, in „toten Opfertieren / Des GottesGott, der mich treibt, Befehl und Willen [zu] spüren“ (SC 30, V. 261–262). Dieser GottGott habe ihm
[…] doch damals schon, eh ich das Licht erblickt,
Den Trieb zur Billigkeit in Herz und Sinn gedrückt.
Der lenkt ohn Unterlaß mein Tichten und mein Trachten
Und treibt mich, lebenslang die TugendTugend hoch zu achten,
Dem Laster feind zu sein, so mächtig es auch ist;
Gesetzt, daß ich dabei zugrunde gehen müßt!
Der lehrt mich, Rom sei nur zur FreiheitFreiheit auserkoren
Und habe die Gewalt der Könige verschworen.
Ja, der beut uns auch itzt der Parther Zepter an,
Zur Prüfung, ob man ihn beherzt verschmähen kann?
Drum laßt uns standhaft sein und solchen Beistand fliehen!
Die Tugend weiß uns schon aus der Gefahr zu ziehen. (SC 30, V. 263–274)
Auffälligerweise spricht Cato an dieser Stelle von einem GottGott,3 und dieser „treibe“ ihn; dass dies aber nicht bedeutet, dass Cato nicht alleiniger Herr seiner Handlungen ist, beweisen zum einen die gehäufte Anzahl von Personal- und Possessivpronomina der ersten Person Singular, zum anderen seine weiteren Ausführungen. Er spricht von seinem ihm in einem SchöpfungsaktSchöpfung von diesem Gott verliehenen Willen, einem Streben nach TugendhaftigkeitTugend – eine bemerkenswerte (anachronistische) Anspielung auf die christliche Vorstellung der menschlichen Gottebenbildlichkeit als Grund von WillensfreiheitWille, freier Wille, Tugendfähigkeit und Menschenwürde. Die stoische Konzeption des vernunftautonom tugendhaft handelnden, nicht affektgebundenen Menschen wird damit nicht aufgehoben, jedoch um eine dezidiert christliche Dimension ergänzt. Indem Cato aber ausdrücklich ablehnt, sich von einer metaphysischen Entität nach dem Schöpfungsakt noch in seinem Handeln bestimmen zu lassen, sich vielmehr einem streng rationalenRationalität – dem ‚göttlichen Trieb‘ korrespondierenden – Moralkodex verpflichtet sieht, entspricht er der Würdevorstellung des frühaufklärerischen Publikums.4 Die absolute, beinahe rücksichtslose FreiheitFreiheit seines Willens bildet auch die Peripetie der Tragödie: „Wenn ich nicht hoffen darf, die Freiheit zu erwerben, / So bin ich alt genung und will ganz freudig sterben“ (SC 55, V. 943–944; m. H.). Kurz darauf noch einmal: „Ich will viel lieber sterben“ (SC 57, V. 1008; m. H.), als auf Cäsars Angebot einzugehen. So wird Catos SuizidSuizid zu einem mehrfach angekündigten „Akt der Freiheit“,5 der es ihm erlaubt, seine Würde zu wahren – und damit ist hier eine kontingente Form der Würde gemeint, die durch autonomesAutonomie Handeln6 begründet wird, jedoch von heteronomen Idealen abhängt. Als reflektierter Akt der Freiheit, als eine Handlung, die Cato „mit Wissen und Willen thu[t]“, die „ein gewisses vorhergehendes Erkenntniß [sic], und ein Urtheil des Verstandes zum Voraus setzet“7 und die sich letztlich aus der rationalen Tugendhaftigkeit des Protagonisten erklären lässt, ist der Suizid prinzipiell nachvollziehbar.