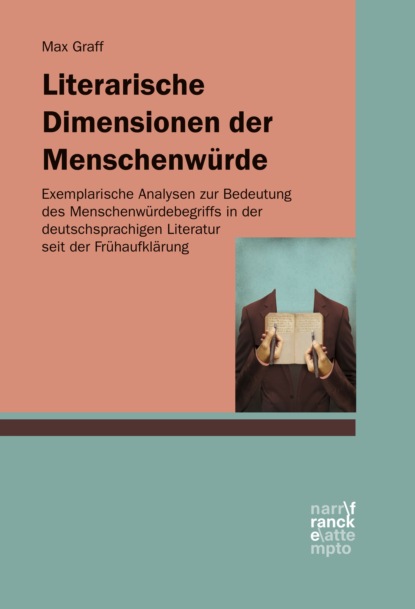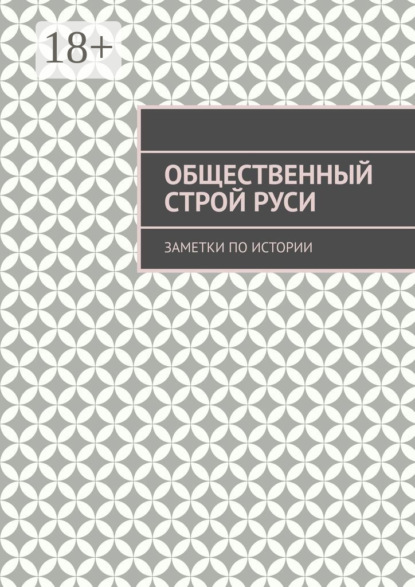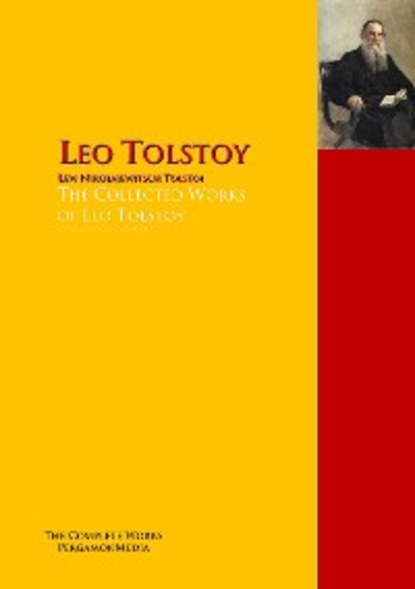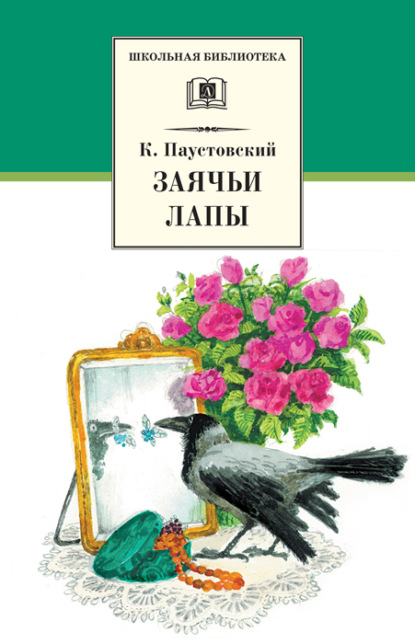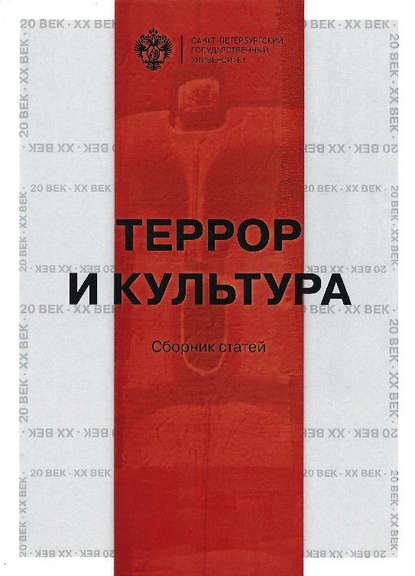- -
- 100%
- +
Dass die Bewertung Catos trotzdem schnell zu kippen droht, beweist der Dialog mit Portia in IV,2. Bereits in der ersten Szene des Dramas ist Portia/Arsene als mündige, selbstbestimmt und reflektiert handelnde Frau eingeführt worden, die sehr genau um ihren Platz in der GesellschaftGesellschaft und die damit verbundenen Handlungsspielräume weiß. Als sie in der Szene IV,2 erfährt, dass sie Catos Tochter ist, leugnet sie keineswegs die Existenz von Affekten und starken Emotionen (SC 61, V. 1163), doch indem sie diese verbalisiert und reflektiert, schafft sie die Basis für einen souveränen, autonomenAutonomie Umgang damit. Aufschlussreich ist ihre Reaktion auf Catos Forderung, ihre „Schwäche“ (SC 66, V. 1203), d.h. ihre Emotionen, zu überwinden: „Ich bin dein Vater nicht, wo Cäsars Liebe noch / In deiner Seelen brennt. Ersticke solche Flammen!“ (SC 65, V. 1198–1199). In der folgenden Passage wird Catos innerfiktionaler Menschenwürdebegriff, der darauf beruht, seine Affekte freiwillig der TugendTugend unterzuordnen, in Frage gestellt, indem Portia ihn polemisch zuspitzt und zeigt, wie er sich ins Unmenschliche wandeln kann: „Sagt, muß ein Römer denn, um Rom getreu zu scheinen, / In seiner Seelen gar die Menschlichkeit verneinen / Und unempfindlich sein?“ (SC 66, V. 1211–1213). Portia bringt hier den entscheidenden Begriff der „Menschlichkeit“ ins Spiel, der Catos kühl-rationalerRationalität, tugendbasierter Menschenwürdevorstellung eine versöhnlich-weibliche Revisionsmöglichkeit entgegenstellt. Cato jedoch beharrt auf seinem Standpunkt und postuliert eine klare Hierarchie Tugend > Natur: „Was sagst du? Rede nun! / Sprich, soll denn die Natur der Tugend Eintrag tun?“ (SC 66, V. 1213–1214). Für einen kurzen Moment scheint Portia die Möglichkeit eines Kompromisses zu sehen: „Und muß die Tugend denn Natur und Trieb ersticken?“ (SC 66, V. 1215). Sie erkennt klar den Konflikt zwischen Pflicht und Neigung, der für das nach-kantischeKant, Immanuel, klassische Drama kennzeichnend sein wird; wahre Menschlichkeit, mithin sogar Würde, ist für Portia in einem harmonischen Verhältnis von Trieb8 und Tugend denkbar. Doch es bleibt bei diesem kurzen, geradezu utopischen Moment; bereitwillig ergibt sie sich schließlich Catos Forderung und will „mein eigen Herz und Cäsars Glut bekämpfen“ (SC 66, V. 1220).9
Dass Cato selbst den Freitod als logische und einzig mögliche Konsequenz seiner Lage und somit nicht nur als legitime, sondern als eine seine Würde in keiner Weise verletzende Handlung versteht, belegt sein längster Monolog, zu Beginn des fünften Aktes. Nachdem er sich diskursiv und mit Bezug auf Plato von der Unsterblichkeit der Seele zu überzeugen versucht hat und nun zuversichtlich dem Tode und der Möglichkeit, die letzte Unsicherheit ob der Existenz GottesGott10 durch eigene Erfahrung zu beseitigen, entgegentritt, will er sich ausruhen:
Ich überlasse mich dem Schlummer, den ich merke;
Daß mein erwachter Geist hernach mit voller Stärke
Die Flucht ergreifen kann und denn an Kräften neu
Dem Himmel, den er ehrt, ein würdig Opfer sei.
Wen sein Gewissen plagt, dem stört die Angst den Schlummer:
Davon weiß Cato nichts. Kein Laster macht mir Kummer! (SC 76, V. 1461–1466)
„Ein würdig Opfer“ – im Sinne seines persönlichen, stoischen Würdeverständnisses handelt er „würdig“, da er selbstbestimmt, überlegt, kühl-rationalRationalität und aktiv („ergreifen“) zu sterben beschließt, um seine Würde, die persönliche und politische FreiheitFreiheit, zu bewahren.11
I.4.2. Die problematische Bewertung der Figur Cato
Wenn der bewundernswerte, tugendhafteTugend HeldHeld am Ende den Freitod wählt, mithin für seine Ideale eher in den Tod gehen will, als sie zu kompromittieren, dann nähert sich die Tragödie dem Schema des Märtyrerdramas an.1 Doch gerade das bestreitet GottschedGottsched, Johann Christoph in seiner „Vorrede“: Er habe Cato keineswegs als „vollkommenes Tugendmuster“ darstellen wollen, vielmehr sei er Aristotelesʼ hamartia-Konzept gefolgt. Cato sei ein „regelmäßiger Held“, der zwar „sehr tugendhaft“ sei, doch „gewisse Fehler an sich“ habe:
Man bewundert, man liebet und ehret ihn: Man wünscht ihm daher auch einen glücklichen Ausgang seiner Sachen. Allein, er treibet seine Liebe zur FreiheitFreiheit zu hoch, so daß sie sich in einen Eigensinn verwandelt. Dazu kommt seine stoische Meinung von dem erlaubten SelbstmordeSuizid. Und also begeht er einen Fehler, wird unglücklich und stirbt: Wodurch er also das MitleidenMitleid seiner Zuhörer erwecket, ja Schrecken und Erstaunen zuwege bringet. (SC 17)
Demnach geht Catos Fehler auf eben jene Quellen zurück, die auch seine TugendTugend begründen: seine Freiheitsliebe, seine Standhaftigkeit.2 Anders formuliert: Sein vermeintlich menschenwürdiges Verhalten führt zu einer aus GottschedsGottsched, Johann Christoph Sicht als menschenunwürdig zu bewertenden Handlung: „[N]ein, den SelbstmordSuizid wollen wir niemals entschuldigen, geschweige denn loben“ (SC 17). In einer Akademie-Rede führt Gottsched seine Kritik an Cato aus:
Die Liebe zur roͤmischen Freyheit, muß seinem Eigensinne zum Vorwande dienen; und die Begierde, sich durch eine unerhoͤrte That einen unsterblichen Namen zu erwerben, muß mit dem Deckmantel einer stoischen Großmuth verhuͤllet werden. So siegete denn die Furcht vor der Sklaverey, uͤber die Liebe des Lebens; die Zaghaftigkeit uͤber die Großmuth; die Verzweiflung uͤber die Weisheit und TugendTugend. Cato stirbt; aber nicht aus Verachtung des Todes, sondern aus Ueberdruß eines ungluͤcklichen Lebens. (AW IX/2, 489)3
So entpuppt sich Catos vermeintlich bewundernswerte und vernunftgeleitete TugendhaftigkeitTugend als verstecktes Laster, als affektgeleiteter „Eigensinn“.4
Dies steht jedoch in eklatantem Widerspruch zu der oben aufgestellten These, dass Cato durchaus die stoische und frühaufklärerische Würdeauffassung erfüllt, sein SuizidSuizid somit für den Zuschauer zumindest nachvollziehbar ist. Wenn sich Cato aber doch von seinen Affekten leiten lässt, also keineswegs ‚erhaben‘ und autonomAutonomie handelt, ist sein Handeln auch nicht menschenwürdig. Der Selbstmord wäre dann nicht nachvollziehbar, sondern vollkommen illegitim – was GottschedGottsched, Johann Christoph selbst in seiner Vorrede bestätigt.5 Diese doch beachtliche Diskrepanz legt präzise das Grundproblem der dramatischen Konzeption offen: Um beim Rezipienten Bewunderung hervorzurufen, muss Gottsched seinen Cato, dessen Geschichte und Ende ja historisch fixiert sind, autonom handeln lassen und sein Handeln als Beleg seiner Menschenwürde inszenieren; gleichzeitig unterläuft sein Bemühen, Cato mit einem Fehler auszustatten, um den Zuschauer zum MitleidenMitleid anzuregen und Schrecken hervorzurufen, diese Darstellung, und Cato wird, vor dem Hintergrund der Würdeauffassung der Stoa und der Frühaufklärung, zu einem höchst fragwürdigen Charakter.6
Ein nicht nur fragwürdiger, sondern von GottschedGottsched, Johann Christoph eindeutig als Verstoß gegen die Menschenwürde gekennzeichneter Akt ist der SuizidSuizid Catos zudem auf einer Ebene, die die Forschung nicht immer gebührend beachtet.7 In seiner Cato-Rede verweist Gottsched auf einen für seine Menschenwürdevorstellung und seine Moralphilosophie bedeutenden Aspekt:
Der Mensch, lehren die Stoiker, lebt nicht fuͤr sich, sondern fuͤr andere. Er ist ein Glied in der Kette aller Dinge; ein Theil der Welt, ein Buͤrger in der Republik aller vernuͤnftigen Geschoͤpfe. So lange er nun diesen nuͤtzen und dienen kann, muß er sie seines Beystandes durchaus nicht berauben. (AW IX/2, 490)
Der Mensch ist, nicht nur als Mitglied eines gesellschaftlich-staatlichen Gebildes, verpflichtet, „anderer Leute Gluͤckseligkeit zu befoͤrdern“.8 Dieses naturrechtliche, auf die Philosophie WolffsWolff, Christian zurückgehende Gebot wird in dem Moment missachtet, in dem Cato es vorzieht, für seine Ideale oder aus Sturheit und Eigensinn – je nach Sichtweise – zu sterben, statt sich im Sinne der Gemeinschaft verhandlungsbereit zu zeigen.9 Diese Kritik ist zentral für die Interpretation der Tragödie – wie der Blick auf die Art der Darstellung des SuizidsSuizid belegt.
I.4.3. Die Dramatisierung des SuizidsSuizid
„Was sich vor mich nicht schickt, das werd ich auch nicht tun“, verkündet Cato in V,2 (SC 78, V. 1498). Innerfiktional ist dieser Ausspruch die Apologie des SuizidsSuizid im stoischen Würdeverständnis der Figur Cato: Die bewusste, reflektierte Entscheidung zum Freitod ist nicht nur eine moralisch erlaubte, sondern eine würdevolle Handlung. Außerfiktional gelesen, wird der Satz zum metadramatischen Kommentar über die Art und Weise, wie GottschedGottsched, Johann Christoph Catos Selbsttötung inszeniert. Bei der dramatischen Gestaltung des Suizids weicht der Dichter merklich von den grausigen Umständen ab, die etwa bei Plutarch und Seneca überliefert sind.1 Statt sich ‚aufzuschlitzen‘, sodass die Eingeweide herausquellen, sich sogar einen zweiten Stich zu setzen, um schneller zu sterben, tötet sich Cato hinter einem inneren Vorhang, der ihn auf der Bühne verdeckt. „(Man höret einen Tumult drinnen)“ (SC 82, nach V. 1588) – dann verkündet Portius: „Er hat sich selbst entleibet!“ (SC 82, V. 1600). In einer zeitgenössischen Rezension wird Gottsched diese Missachtung der historischen Wahrheit explizit angekreidet, und er sieht sich veranlasst, sein Vorgehen zu rechtfertigen. Nicht nur sei Cato „kein historischer, sondern ein poetischer“ Charakter, was Abweichungen von der historischen Wahrheit erlaube,2 wenn es der Vermittlung der „Sittenlehre“ diene; außerdem ließe sich der historisch überlieferte „schreckliche“ Suizid „auf der Schaubühne unmöglich zeigen“, da Cato sonst zum „Scheusal“ würde, von dem sich die Rezipienten sofort distanzieren (SC 111–112).3 Wirkästhetische Überlegungen, die über bloße Abwägungen in Bezug auf die Angemessenheit, das aptum oder decorum hinausgehen, stehen eindeutig über dem Gebot der historischen Wahrheit.4
Das Verlegen der Entleibung hinter den inneren Vorhang entzieht dem Akt letztlich die Legitimation.5 Denn bevor Cato sterbend seine letzten Worte spricht, betonen andere Figuren auf der Bühne, allen voran Portius und Portia, dass gerade ein lebender Cato für das Wohlergehen sowohl der eigenen Familie als auch Roms die letzte Hoffnung darstellt.6 Durch diesen dramaturgischen Kniff wird besonders deutlich, dass Cato mit seinem SuizidSuizid seine Mitmenschen und Mitbürger im Stich lässt;7 er entzieht sich der naturrechtlichen Pflicht, sein Handeln an der Maxime der Glückseligkeit aller Menschen auszurichten. Catos Sich-Entziehen wird durch das auffällige Aussparen optischer Details gleichsam negativ visualisiert. Er handelt demnach falsch und egoistisch; er verstößt gegen einen wesentlichen Aspekt der frühaufklärerischen Menschenwürdevorstellung.
Als der tödlich verwundete Cato schließlich auf die Bühne getragen wird, setzt er zu einem letzten Monolog an, in dem er dann doch Selbstzweifel äußert:
[…] Ihr Götter! hab ich hier
Vielleicht zu viel getan: Ach! So vergebt es mir!
Ihr kennt ja unser Herz und prüfet die Gedanken!
Der Beste kann ja leicht vom Tugendpfade wanken.
Doch ihr seid voller Huld. Erbarmt euch! – – Ha!
Der Rückgriff auf die Götter, d.h. vorchristliche Vorstellungen einer höheren Macht, erlaubt GottschedGottsched, Johann Christoph, Cato als im letzten Moment doch verunsicherten Menschen zu zeigen, sodass der moraldidaktische Impetus umso stärker wirksam werden kann.8 Dass nun aber an dieser entscheidenden Stelle nicht mehr von „GottGott“ im Singular, sondern von „Göttern“ die Rede ist, Cato also deutlich als ‚Heide‘ gekennzeichnet wird, hat den bemerkenswerten und widersprüchlichen Effekt, dass genau in dem Moment, in dem seine Unsicherheit ihn mitleidswürdigMitleid werden lässt, eine deutliche Distanz zum christlichen Rezipienten entsteht, die zur Reflexion auffordert und die Legitimation des SuizidsSuizid wirkungsvoll in Frage stellt. Auch Cato zweifelt nun an der Legitimität seines Handelns, das bis hierhin problemlos mit seinem Würdeverständnis vereinbar war. Angesichts einer doch noch möglichen Rettung erscheint der Freitod als vorschnell.9
Doch obwohl der SuizidSuizid eindeutig als schwerer moralischer Fehler verurteilt wird, der mit vernünftigerVernunft Reflexion unvereinbar ist,10 will GottschedGottsched, Johann Christoph den Selbstmörder Cato ganz offensichtlich nicht, wie es in der Wissenschaft des 18. Jahrhunderts üblich ist, in die Nähe des TieresTier, Vertierlichung, Theriomorphisierung rücken11 – sonst hätte sich Cato durchaus auf offener Bühne und möglichst grausam entleiben können. Nicht einmal per Botenbericht oder Teichoskopie wird die historisch und literarisch verbürgte Todesart geschildert. Grund für das Verbergen und die Abschwächung der Grausamkeit ist ebenjene widerspruchsvolle wirkästhetische Strategie, die dem Drama geradezu eingeschrieben ist. Catos Charakter und Handeln müssen sowohl bewundernswert als auch fehlerhaft sein; trotz seines unwürdigen Fehlers darf er nicht verachtungswürdig,12 also auch nicht würdelosWürdelosigkeit und tierhaft, erscheinen. Für die dramatische Darstellung bedeutet das konkret: Der menschliche KörperKörper darf als etwas an sich Schönes und Würdiges nicht angetastet werden. Durch das Aussparen des Gewaltaktes, der radikal auf den Körper zielt und damit einen der Vorzüge des menschlichen Geschlechts kompromittiert, bleibt die Menschenwürde unangetastet im wörtlichen Sinne; der grundsätzliche Wert des Menschen sowie seine Überlegenheit über den Rest der SchöpfungSchöpfung werden bestätigt.13 In Ansätzen deutet dieses Postulat mit seinen poetologischen Implikationen vielleicht sogar auf das Konzept einer inhärenten Würde voraus, gerade weil ein möglicher Verstoß nicht im Hinblick auf poetische Aussagen funktionalisiert wird. Dass Gottsched bei aller moralischen Verurteilung Catos den Menschen prinzipiell als bewundernswertes Wesen ansieht, ist Ausdruck seines optimistischen Weltbildes, in dem der Mensch eindeutig Würde besitzt und ihm gerade deshalb die Aufgabe zukommt, sich persönlich und moralisch zu vervollkommnenPerfektibilität, Vervollkommnung.14
I.5. Dimensionen der Menschenwürde bei GottschedGottsched, Johann Christoph
GottschedsGottsched, Johann Christoph Menschenwürdebegriff, wie er in seinen Akademiereden explizitiert wird, ist eklektisch; er vereint theologische, vernunftphilosophische, naturrechtliche, humanistische und ethische Dimensionen. In der Tragödie Sterbender Cato wird die Menschenwürde insofern zu einem ästhetischen Problem, als verschiedene Aspekte dieses Menschenwürdebegriffs eine bisweilen konfligierende Rolle spielen. Catos SuizidSuizid wird als prinzipiell nachvollziehbare Handlung geschildert, indem er – als vernunftgeleiteter, reflektierter und freier Akt – als Beweis seines menschenwürdigen Handelns und als Garant seiner Menschenwürde, und das heißt hier: seiner FreiheitFreiheit und TugendTugend, erscheint. Obwohl der Suizid an sich für Gottsched inakzeptabel ist, überschneidet sich der innerfiktionale Menschenwürdebegriff der Dramenfigur Cato mit dem frühaufklärerischen – so wird die Bewunderung des Protagonisten ermöglicht. Gleichzeitig unterminiert Catos Fehler im aristotelischen Sinne, sein Starr- und Eigensinn, die vernunftgeleitete Reflektiertheit und Triebkontrolle und stellt somit – vor dem Horizont beider Menschenwürdebegriffe – Catos Handeln ernsthaft in Frage. Zudem missachtet Cato sträflich seine naturrechtliche Pflicht, die Glückseligkeit aller Menschen zu befördern. Cato muss also gegen bestimmte Aspekte der frühaufklärerischen Menschenwürdevorstellung verstoßen, damit sein Niedergang gerechtfertigt ist – und das MitleidenMitleid der Zuschauer geweckt werden kann.
Dass GottschedGottsched, Johann Christoph bei der Dramatisierung des SuizidsSuizid von der historischen Überlieferung abweicht, hat schließlich drei Gründe. Cato entzieht sich dem Gebot, für das Wohl seiner Mitmenschen zu kämpfen; dies wird in seiner Absenz von der Bühne augen- und sinnfällig. Um die Bemühungen, den HeldenHeld sowohl bewundernswert als auch mitleidswürdigMitleid zu zeichnen, nicht vollkommen zu konterkarieren, wird der Suizid nicht auf eine abstoßende, schockartige Weise inszeniert. So bleibt das Bild des Menschen als schönes Wesen mit einem schönen, intakten KörperKörper letztlich unbeschädigt.
Dass Cato, trotz seines moralisch eindeutig verurteilten Freitods, die Vorstellung einer besonderen Würde des Menschen nicht vollständig kompromittieren darf, um den Wirkimpetus des Dramas nicht zu gefährden, belegt, dass Menschenwürde, gemäß dem moraldidaktischen Optimismus der Aufklärung, vor allem als Auftrag des einzelnen IndividuumsIndividuum verstanden wird.
II. Die Menschenwürde als idealisches Ziel des Menschengeschlechts und als Auftrag der Literatur (1750–1810)
II.1. Friedrich SchillerSchiller, Friedrich: Die KünstlerKunst, Künstler (1789)
SchillersSchiller, Friedrich programmatisches Lehrgedicht Die KünstlerKunst, Künstler, mit dem er 1789 „feierlich die Schwelle zur Klassik [überschreitet]“,1 offenbart exemplarisch, in welchen diskursiven Kontext der Begriff der Menschenwürde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eingebettet ist: In diesem (literarischen!) Text verbinden sich (Geschichts-)Philosophie, Ästhetik und Anthropologie auf eine nicht nur für Schiller, sondern für diese Zeit im Allgemeinen typische Weise. Entscheidend sind nun zwei Aspekte der Künstler: das von Schiller entworfene Menschenbild und die Stellung der Menschenwürde im Verhältnis zu seiner Bestimmung der Funktion von Kunst.
Auffällig und für den Würdediskurs zwischen Aufklärung und Klassik geradezu symptomatisch sind die dem Gedicht eigenen gegenläufigen, ja widersprüchlichen Grundpositionen. Der Text beginnt mit einer hymnischen, uneingeschränkt positiven Charakterisierung des aufgeklärten Menschen am Ende des 18. Jahrhunderts: „Wie schön, o Mensch, mit deinem Palmenzweige / stehst du an des Jahrhunderts Neige“.2 Der Mensch, der „reifste Sohn der Zeit“ (NA 1, 201, V. 6), ist auf seiner derzeitigen Entwicklungsstufe quasi vollkommen – das suggerieren der Superlativ („reifste“) und die ihm zugeschriebenen Attribute: Er ist „frey durch VernunftVernunft, stark durch Gesetze“ (NA 1, 201, V. 7), hat die Natur gebändigt und unterworfen („Herr der Natur, die deine Fesseln liebet“ [NA 1, 201, V. 10]) und wird in dieser ersten Strophe mit zahlreichen auszeichnenden, fast verherrlichenden Adjektiven belegt.3 In den ersten Versen zeichnet SchillerSchiller, Friedrich als überzeugter Aufklärer den Menschen als in höchstem Maße würdiges Wesen; diese Würde wird präzisiert als „Geisterwürde“ (NA 1, 201, V. 18), d.h. als in der besonderen, schrankenlosen Vernunftfähigkeit des Menschen begründeter Wesenszug, auf dem seine Schönheit, seine „erhabne[] TugendTugend“ (NA 1, 201, V. 24) und seine Emanzipation vom „schwere[n] Sinnenpfad“ (NA 1, 202, V. 69) beruhen. Doch unmittelbar darauf schlägt Schiller bereits die entscheidende Volte: Was den Menschen vor allen anderen Wesen auszeichnet, mithin seine Würde ausmacht,4 ist die KunstKunst, Künstler – „die Kunst, o Mensch, hast du allein“ (NA 1, 201, V. 33). Sie wird zur „fundamentale[n] anthropologische[n] Kategorie“,5 denn im Schönen liegen die Keime der Erkenntnis, der Wahrheit, der Sittlichkeit, der FreiheitFreiheit und der menschlichen Bestimmung – für den Menschen intuitiv erfassbar, noch bevor sie von der Vernunft erschlossen werden.6 Die Künstler werden voller Pathos zu Vorkämpfern der wiederholt beschworenen HarmonieHarmonie7 erklärt – Harmonie zwischen Schönheit und Wahrheit, zwischen Freiheit und Sittlichkeit, zwischen dem autonomenAutonomie Menschen und den Gesetzen der Natur.
SchillersSchiller, Friedrich Gedicht präsentiert sich in der Folge als kulturhistorischer Abriss: Die in der Antike auf idealtypische Weise vorhandene Einheit von Schönheit und Erkenntnis ist im Laufe der Menschheitsentwicklung verloren gegangen, dank des Wirkens der KünstlerKunst, Künstler wieder errungen worden, droht in der Gegenwart aber wieder verfehlt zu werden. Der kulturgeschichtliche Abriss mündet demnach gerade nicht in das in den Anfangsversen beschworene Bild des schönen, aufrechten, aufgeklärten Menschen; aus Kulturgeschichte wird vielmehr Kulturkritik. Grund für die Skepsis, die nicht zuletzt Skepsis gegenüber einer verabsolutierten VernunftVernunft ist, ist die Marginalisierung der Kunst, die als Folge des Siegeszuges der Wissenschaften den „ersten Sklavenplatz“ (NA 1, 211, V. 390) bekleidet. Die Errungenschaften des „Forscher[s]“ (NA 1, 211, V. 384) und des „Denker[s]“ (NA 1, 212, 402) müssen jedoch „der Schönheit zugereifet, / zum Kunstwerk […] geadelt“ (NA 1, 212, V. 404–405) werden – dann erst kann die Menschheit ihre wahre Bestimmung erreichen. Auf dem Höhepunkt des Gedichts8 wird diese Schlusspointe als emphatischer Appell an die Künstler formuliert:
Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben,
bewahret sie!
Sie sinkt mit euch! Mit euch wird die Gesunkene sich heben!
Der Dichtung heilige Magie
dient einem weisen Weltenplane,
still lenke sie zum Ozeane
der großen HarmonieHarmonie! (NA 1, 213, V. 443–449)
Nicht weniger als die Würde der Menschheit steht auf dem Spiel, die, das impliziert der Text, (noch) nicht vollständig (wieder)hergestellt ist. „[D]er Vollendung KroneKrone (der Schöpfung) / schwebt glänzend“ über dem „Haupt“ der KünstlerKunst, Künstler (NA 1, 212, V. 391–392); sie sind es, die den „Einen Bund der Wahrheit“ (NA 1, 214, V. 480) gründen sollen. Der sakralisierten Kunst, hier der Dichtung, fällt so eine ungeheure Aufgabe zu: Nur sie kann das menschheitsgeschichtliche Ziel verwirklichen. Als eben solches wird die Menschenwürde gekennzeichnet: „[A]m reifen Ziel der Zeiten“ (NA 1, 213, V. 429) – das wieder aufgenommene Adjektiv „reif“ (vgl. V. 6) revidiert die am Anfang des Gedichts entfaltete Menschenwürdevorstellung! – werden sich „Wahrheit“ und „Schönheit“ vereinigen (NA 1, 213, V. 432 bzw. 212, V. 404), und genau diese zukünftige Vereinigung bedeutet den Aufschwung des Menschen zu wahrer Würde. Sprachlich markiert werden diese Vorstellungen durch den Gebrauch des Futurs und des Imperativs9 sowie durch eine vor allem das letzte Fünftel des Gedichts durchziehende Motivik der Erhebung, der räumlichen Aufstiegsbewegung.10
Die Menschenwürde hat in SchillersSchiller, Friedrich Schwellentext eine vielsagende doppelte Stellung: Sie ist – im Sinne des Gedichtanfangs – sowohl eine Qualität des Menschen als auch – im Sinne des weiteren Textverlaufs – sein Entwicklungsziel, ein utopisches Ideal, das, wenn überhaupt, nur über den Weg der KunstKunst, Künstler zu erreichen ist. Insofern ist Menschenwürde tatsächlich ein genuin ästhetisches Problem, ein Problem der Ästhetik, nämlich Aufgabe und Ziel der Kunst.11
*
SchillersSchiller, Friedrich „Programm einer kunsttheoretisch erweiterten Aufklärung“12 repräsentiert allerdings nur eine – wenn auch besonders konsequente und elaborierte – der spezifisch ästhetischen Dimensionen der Menschenwürde im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Die folgenden Seiten rekonstruieren diese literarisch-ästhetischen Facetten und Implikationen des Menschenwürdebegriffs im Zeitalter der Aufklärung und der Klassik, stets vor dem Hintergrund der für Definition und Legitimation der Menschenwürde eminent wichtigen geistesgeschichtlichen Kontexte.
Kaum eine Periode der deutschen Literaturgeschichte hat eine derart lange, umfangreiche und tiefgehende wissenschaftliche Durchleuchtung erfahren wie die Jahrzehnte zwischen 1750 und 1810, von den ersten literarischen Versuchen LessingsLessing, Gotthold Ephraim bis hin zu den großen Werken der Weimarer Klassiker GoetheGoethe, Johann Wolfgang und SchillerSchiller, Friedrich. Anstelle einer (redundanten) erneuten Detailanalyse kanonischer Texte stehen daher im Folgenden die literarischen und literaturtheoretischen Implikationen der Menschenwürde im Vordergrund – unter Berücksichtigung der wichtigsten Forschungsliteratur und mit kurzen Blicken auf die wichtigsten Primärtexte.