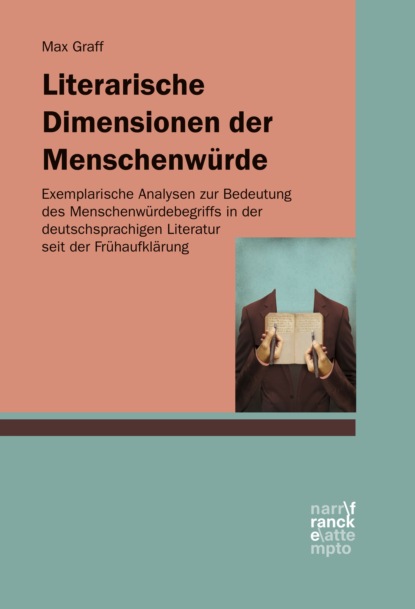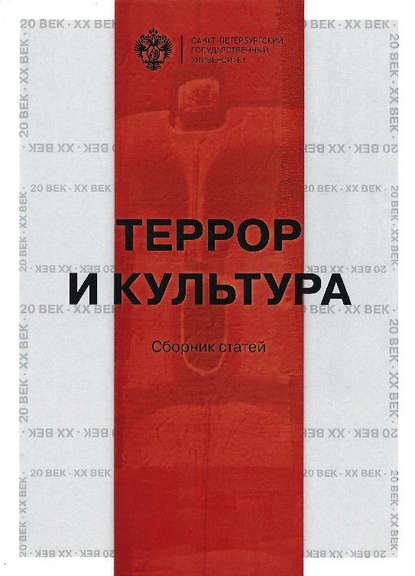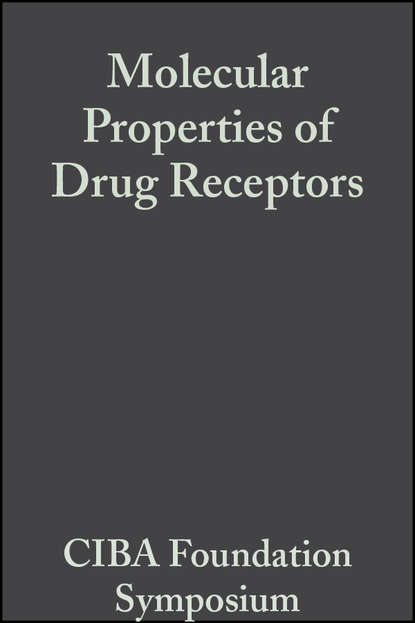- -
- 100%
- +
II.2. Die Menschenwürde im 18. Jahrhundert zwischen Philosophie, Anthropologie und Literatur
Im Jahr 1809 erscheint das Lexem „Menschenwürde“ erstmals in einem deutschen Wörterbuch. In Joachim Heinrich Campes Wörterbuch der Deutschen Sprache wird es definiert als „die Würde des Menschen als eines vernünftigen über alle Erdgeschöpfe erhabenen Wesens; besonders die sittliche Würde des Menschen“. Auch die Belege im Grimmschen Wörterbuch lassen auf eine erste Blüte des Begriffs um 1800 schließen.1 In den Jahrzehnten davor – literaturgeschichtlich gesprochen: im Zeitalter der Aufklärung, der Empfindsamkeit, des Sturm und Drang, schließlich der Weimarer Klassik – war der Menschenwürdediskurs demnach virulent, auch wenn das Wort selbst nicht unbedingt explizit im Zentrum stand. Dieser Diskurs war nicht zuletzt ein literarischer, ästhetischer.
*
Begreift man die Aufklärung nicht einseitig als Zeitalter eines strengen Vernunftoptimismus, sondern als eines, das von grundlegenden Spannungen geprägt ist (RationalismusRationalismus vs. Empirismus, Vernunftideal vs. radikale ‚Rehabilitation der SinnlichkeitSinnlichkeit‘, Intellektualisierung vs. Naturalisierung des Menschen, Normativität vs. Kausalität, Sollen vs. Sein),2 ergeben sich für die Auseinandersetzung mit der Vorstellung der Menschenwürde – und v.a. mit ihrer Beziehung zur Literatur – aufschlussreiche Perspektiven. In einer Epoche, die dezidiert den Menschen ins Zentrum des philosophischen wie literarischen Interesses stellt, befindet sich dieser in einer merkwürdig ambivalenten Stellung: Wird er einerseits als Vernunftwesen emphatisch über die Natur erhoben und aus den Fesseln der religiösen Orthodoxie und der staatlichen wie gesellschaftlichen Bevormundung emanzipiert, droht ihm andererseits die Erniedrigung zu einem von rein triebhaften Zwängen bestimmten Naturwesen.
Die geistesgeschichtliche Stellung und die Wirkmächtigkeit des Menschenwürdebegriffs in der Aufklärung lassen sich anhand von drei Beobachtungen bestimmen. Zunächst verliert die primär theologische Begründung der Menschenwürde zunehmend an Bedeutung. Das Theologem der GottebenbildlichkeitGottebenbildlichkeit des Menschen sowie die daran gekoppelte Lehre von der Erbsünde, die die Sündhaftigkeit und die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen erklärt, sind für die Vorstellung einer besonderen Menschenwürde nicht mehr entscheidend.3 Weiterhin spielt die Menschenwürde in den Werken der großen europäischen Aufklärer überraschenderweise eine eher untergeordnete oder vielmehr implizite Rolle.4 Ausnahmen bilden die Naturrechtslehre des Frühaufklärers und Juristen Samuel Pufendorf und die Moralphilosophie Immanuel KantsKant, Immanuel. Kants Würdeverständnis prägt den Würdediskurs der folgenden Jahrhunderte, markiert ideengeschichtlich betrachtet aber eher einen Kulminationspunkt der aufklärerischen Philosophie am Übergang zum Idealismus.5 Schließlich hat der Begriff der Menschenwürde im 18. Jahrhundert, und diese These ist für die weiteren Ausführungen entscheidend, eine doppelte Stoßrichtung: Er bezeichnet sowohl ein Wesensmerkmal des einzelnen Menschen als auch einen Gestaltungsauftrag für das IndividuumIndividuum und das gesamte Menschengeschlecht.6
Die kosmische Sonderstellung des Menschen wird im 17. und im 18. Jahrhundert nicht mehr durch den Verweis auf seinen göttlichen Schöpfer garantiert; auf der anderen Seite erscheint der Mensch im Lichte naturwissenschaftlicher Erkenntnisse als Teil der Natur, mithin als den Naturnotwendigkeiten vollkommen unterworfen. Die Berufung auf die VernunftVernunft erlaubt es nun, diese beiden ‚Angriffe‘ auf die Würde des Menschen abzuwehren, indem sie aus ihm ein autonomesAutonomie, nicht determiniertesDetermination Wesen macht – was für die Moralphilosophie im Besonderen unerlässlich ist. Die vernunftanthropologische Argumentation findet sich etwa in der Naturrechtsphilosophie Pufendorfs. Würde hat der Mensch als rationales Wesen; gleichzeitig ist sie an das Befolgen der Prinzipien von MoralMoral, Moralität und Naturrecht gekoppelt. Jeder Mensch besitzt Würde; hieraus ergibt sich die Gleichheit aller Menschen, aber auch die Verpflichtung zu gegenseitiger AchtungAchtung und zu sozialem Handeln.7 Auch für Christian WolffWolff, Christian, den für die Popularisierung aufklärerischen Gedankenguts bedeutendsten deutschen Philosophen vor 1750, besitzen alle Menschen als von GottGott als Gleiche erschaffene vernünftige Wesen Würde. Zudem ist Würde aber ein zu erreichendes Ziel des sich stets perfektionierenden Menschen;8 Wolff glaubt wie GottschedGottsched, Johann Christoph an die Unfehlbarkeit der Vernunft, die die VervollkommnungPerfektibilität, Vervollkommnung des Menschen – seines Wissens, seiner TugendTugend, seiner Glückseligkeit – garantieren soll.9 Im Zuge der Säkularisierung der philosophischen Argumentationsverfahren10 verschiebt sich auch der Fokus des Menschenwürdebegriffs hin zu einer immer stärkeren Betonung der Aspekte Moral, Autonomie und FreiheitFreiheit. Paradigmatisch heißt es in der moralischen Wochenschrift Der Mensch: „Ein vernuͤnftiger Mensch muß als freyes Wesen die Tugend ausuͤben.“11 Christian Fürchtegott Gellert definiert 1767 die „Tugend“ gar als „die wahre Würde“.12 Systematischen Charakter bekommt die Verbindung von Würde, Freiheit und Moral in der Philosophie KantsKant, Immanuel, der versucht, eine unabhängig von der Anerkennung der Naturgesetze gültige und verbindliche Sittenlehre zu entwerfen.13 Sein Menschenbild ist streng dualistisch: Als Sinneswesen und selbst als vernünftiges Wesen (homo phaenomenon) ist der Mensch Teil des Systems Natur, verhaftet in seiner Tierhaftigkeit. Als geistiges Vernunftwesen (homo noumenon) jedoch besitzt der Mensch Personalität, ist Subjekt einer moralisch-praktischen Vernunft und nicht von sinnlichenSinnlichkeit Reizen und Trieben determiniert. Das Vernunftwesen Mensch besitzt die Fähigkeit, sich selbst die moralischen (kategorischen) Imperative aufzuerlegen, an dem es sein vernünftiges – und das heißt: sittlich richtiges – Handeln ausrichtet; es handelt autonom (selbstbestimmt) sittlich. Die Fähigkeit zur Selbstgesetzgebung begründet die Würde des Menschen; diese ist ein absoluter, unverlierbarer innerer Wert, der von anderen, aber auch in der eigenen Person geachtet werden muss. Würde ist somit ein subjektives und objektives moralisches Prinzip; sie ist Grund für das eigene sittliche Handeln und stellt ein Verhaltensideal gegenüber Mitmenschen dar.14
Die Menschenwürde hat im Jahrhundert der Aufklärung demnach einen Status begrifflicher Ambivalenz: Sie wird sowohl als inhärente Qualität des Menschen,15 die dem Menschen als Menschen zukommt, als auch als kontingente Eigenschaft, als normatives Ideal, verstanden.
*
Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts gewinnt eine philosophische und akademische Disziplin an Bedeutung, die einen vollkommen anderen Blick auf den Menschen und seine Würde wirft: die Anthropologie.16 Ihr Ausgangspunkt ist die Doppelnatur des Menschen, doch betrachtet sie diese nicht im Sinne des wirkmächtig von René DescartesDescartes, René entworfenen, streng zwischen KörperKörper und Seele/Geist differenzierenden dualistischen Menschenbildes,17 das letztlich die Vormachtstellung des Geistes gegenüber dem Körper sichern soll, sondern sie bemüht sich um eine angemessene Würdigung des Menschen in seiner durchaus spannungsvollen Gesamtheit. Programmatisch formuliert diese Lehre vom ‚ganzen Menschen‘ – eine Wendung, die sowohl bei SchillerSchiller, Friedrich als auch bei GoetheGoethe, Johann Wolfgang belegt und auch in der Forschung zum Schlagwort geworden ist18 – 1772 der ‚philosophische Arzt‘ Ernst Platner.19 Schillers medizinische Dissertation aus dem Jahr 1780 (Versuch über den Zusammenhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen [NA 20, 37–75]) wird von einem ähnlichen Impetus getragen.20
Diese anthropologische Sicht auf den Menschen bewirkt nicht nur eine radikale Aufwertung des KörpersKörper und der SinnlichkeitSinnlichkeit – auch und besonders als Erkenntnisvermögen, wie bereits in der Ästhetik Alexander Gottlieb Baumgartens21 –, sondern auch eine Hinwendung zum „Anderen der VernunftVernunft“, d.h. zu all jenem, was die einseitige Betonung der Vernunft als unvernünftig ausschließt und verdrängt.22 Diese Neubestimmung des Menschen, seines Wesens und seiner Grenzen23 – ein Ansatz, von dem sich KantKant, Immanuel übrigens scharf distanziert24 – hat Folgen für die Vorstellung der Menschenwürde:
Wiewohl seit je um die Bestimmung der ‚Sonderstellung‘ des Menschen im KosmosKosmos, der ‚dignitas hominis‘, bemüht, sind Anthropologie und anthropologisches Denken […] dadurch gekennzeichnet, daß sie diese Würde des Menschen nicht um den Preis der Negation seines tellurischen Teils, seiner ‚tierischen Natur‘, erkaufen wollen.25
Neben dem vernunftphilosophischen der KantschenKant, Immanuel Transzendentalphilosophie existiert mit dem anthropologischen demnach noch ein weiteres einflussreiches Menschenwürdeparadigma. Auch dieses impliziert jedoch eine Ziel- oder Idealvorstellung: die harmonische Vereinigung aller Kräfte und Vermögen des Menschen, wie sie HerderHerder, Johann Gottfried oder SchillerSchiller, Friedrich vorschwebt.
*
Nun stellt sich die Frage nach dem Verhältnis der Menschenwürde zu einem Schlüsselbegriff des letzten Drittels des 18. Jahrhunderts: dem für die Literatur der Weimarer Klassik entscheidenden Begriff der HumanitätHumanität. Dieser hat besonders im Werk Johann Gottfried HerdersHerder, Johann Gottfried eine überragende Bedeutung:26 Humanität beschreibt sowohl das Wesen der Mittelgattung Mensch zwischen „Angelität“ und „Brutalität“ als auch das geschichtliche Entwicklungsziel des Menschen – und offenbart die gleiche Ambivalenz wie die Menschenwürde.27 Explizit verbindet Herder sogar die Begriffe Humanität und Menschenwürde, jedoch in unterschiedlicher Akzentuierung. Einerseits ist Humanität der „Zweck der Menschen-Natur“; daher kann Herder die „ganze Geschichte der Völker“ als „Schule des Wettlaufs zu [sic] Erreichung des schönsten Kranzes der Humanität und Menschenwürde“ betrachten.28 Humanität und Menschenwürde (wie auch „VernunftVernunft und Billigkeit“29) erscheinen hier als fast synonyme Umschreibungen eines teleologischen Endpunkts. Später definiert Herder andererseits „Menschheit, Menschlichkeit, MenschenrechteMenschenrechte, Menschenpflichten, Menschenwürde, Menschenliebe“ als „Teilbegriffe“ des „Wort[s] Humanität“.30 In Bezug auf den menschlichen Ist-Zustand ist Herders Diagnose niederschmetternd: „Das Menschengeschlecht, wie es jetzt ist und wahrscheinlich lange noch sein wird, hat seinem größesten Teil nach keine Würde; man darf es eher bemitleidenMitleid als verehren. Es soll aber zum Charakter seines Geschlechts, mithin auch zu dessen Wert und Würde gebildet werden.“31 Menschenwürde ist – wie ihr Oberbegriff Humanität – in dieser Hinsicht eine zu fördernde und herauszubildende Anlage des Menschen. Wenn die Menschenwürde derart deutlich in den Dunstkreis des Humanitätsbegriffs tritt, sich sogar mit ihm überschneiden kann, erweitert sich auch ihr Bedeutungsinhalt: Neben den bereits genannten sowie traditionellen Begriffskomponenten wie Vernunft, FreiheitFreiheit und TugendTugend können Aspekte wie Toleranz, Glückseligkeit, Bildung, Kultur, Wahrheit, Schönheit und sogar Religion hinzukommen.32
Das Ideal, das am Ende der menschlichen Entwicklung steht, ist jenes der neuen Anthropologie: der ganzheitliche Mensch, der selbstbestimmt die unterschiedlichen in ihm wirkenden Vermögen auf harmonische Weise synthetisiert.33 HerderHerder, Johann Gottfried steht insofern prototypisch für das Denken der deutschen (Spät-)Aufklärung, als er die Auseinandersetzung mit dem Menschen auf den Prozess der Humanisierung – im vorliegenden Kontext könnte man präzisieren: des Aufstiegs zu wahrer und vollkommener Menschenwürde – fokussiert.34 Diese begreift Herder als Bildungsprozess, bei dem gerade die Auseinandersetzung mit den „schöne[n] Wissenschaften“ – „Sprachen und Poesie, Rhetorik und Geschichte“ sowie Philosophie – dazu beitragen soll, sich dem „Gefühl der Menschlichkeit“, dem „Sinn der Menschheit“ zu nähern.35
*
Das Nachdenken über die Menschenwürde hat im 18. Jahrhundert auch weitreichende politische und soziale Konsequenzen. Aus der menschlichen VernunftfähigkeitVernunft und dem Vermögen zur SelbstbestimmungSelbstbestimmung wird nun das Recht auf Selbstbestimmung, Selbstgestaltung und Selbstzweckhaftigkeit des einzelnen Menschen abgeleitet. Das IndividuumIndividuum und sein absoluter Wert, unabhängig von Kontingenzen wie Stand, Herkunft oder Ehre, werden als relevante Größen politischen Handelns und gesellschaftlichen Gestaltens eingefordert und in der Idee allgemeiner Menschen- und Bürgerrechte 1789 in Frankreich kodifiziert. Vor allem aber ist die Menschenwürde in dieser Hinsicht ein genuin bürgerlicher Begriff, der sowohl emanzipatorische (gegenüber dem Adel) als auch abgrenzende (gegenüber den unteren sozialen Schichten) Funktion hat36 – und insofern aus heutiger Sicht nicht unproblematisch ist, als er auf diese Weise die Idee einer allen Menschen als inhärente Qualität eignenden Würde konterkariert.37
Gleichwohl werden Menschenwürde und MenschenrechteMenschenrechte Schlagworte in der publizistisch-literarischen Auseinandersetzung mit der französischen Revolution, ihren Motiven und Folgen, etwa bei Johann Heinrich VoßVoß, Johann Heinrich. Schon als er sich um den Posten des badischen Hofpoeten bewirbt, avisiert er, seine literarische Tätigkeit in den Dienst der Menschenwürde der sozial Benachteiligten zu stellen, indem er „dem verachteten Landmann feinere Begriffe und ein regeres Gefühl seiner Würde beizubringen“ beabsichtige.38 In seinem Gesang der Deutschen beschwört er einen revolutionären Umsturz in Deutschland – mit einschlägigen Vokabeln: „Der Wild […] / Wird Mensch“, die „VernunftVernunft, durch Willkür erst befehdet“, „redet / von Menschenrecht, von Bürgerbund“. Der Begriff der Würde wird neu definiert: „Nur TugendTugend, nicht Geburt, gibt Würde“ – dann kann das „Volk“ „[v]eredelt“ zur „FreiheitFreiheit“ aufsteigen.39 Würde wird somit abgekoppelt von der sozialen Stellung, bleibt allerdings kontingent, ist doch auch die Tugend als Grund der Würde ein heteronomes Ideal.40
Im „4ten Jahr der Frankenrepublik“ erscheinen ohne Ortsangabe die Poetische[n] Sammlungen zur Erweckung des Gefuͤhls fuͤr Menschenwuͤrde, eine Zusammenstellung deutschsprachiger lyrischer Texte und Fabeln.41 In seiner Vorrede gibt der anonyme Herausgeber an, die Texte wollten für die „unterdruͤckte Menschenwuͤrde“ werben. Zwar preist er die Demokratie als die der „hohe[n] Wuͤrde der Menschheit“ angemessenste Staatsform; als Aufruf zum Aufruhr will er seine Sammlung jedoch nicht verstanden wissen. Vielmehr dienen die Texte als „redender Beweis“, dass die Ideale der französischen Revolution – „Gleichheit, Freyheit, Haß gegen gekroͤnte und ungekroͤnte Tyrannen“, MenschenrechteMenschenrechte und Menschenwürde – bestimmende Themen und Anliegen der deutschen Literatur, auch vor der Revolution, waren und sind.42
*
Die Spannung, die durch den doppelten Impetus des Menschenwürdebegriffs am Ende des 18. Jahrhunderts (Wesenszug und Ideal, Eigenschaft und Zielvorstellung) entsteht, macht ihn für die Literatur in Theorie und Praxis besonders attraktiv und fruchtbar. Der Zusammenhang zwischen Menschenwürde und Literatur eröffnet nun drei grundsätzliche Perspektiven:
1. Literatur fungiert nicht nur als Spiegelmedium, in dem sich zeittypische Diskurse niederschlagen – anders formuliert: Die Literatur der Aufklärung thematisiert nicht nur die Menschenwürde, ihre Bedingungen und Grenzen. Vielmehr versteht sie sich auch als Mittel, den Menschen zu bessern, ja zu vervollkommnenPerfektibilität, Vervollkommnung, und das heißt: ihn durch die genuin ästhetischen Potentiale der Literatur43 dem Ideal der wahren Menschenwürde anzunähern. Dies führt speziell in der Weimarer Klassik zu regelrechten literarischen Bildungsprogrammen und zu SchillersSchiller, Friedrich ästhetischer Theorie, die die Menschenwürde explizit ins Zentrum stellt. Die Literatur als gesellschaftliche Kraft, gleichsam als Institution, erfährt durch ihren Auftrag, die Menschenwürde als Ziel des Menschengeschlechts zu fördern, eine ungeheure Aufwertung.44
2. Diese hehren Ziele bergen die Gefahr eines verengten, normativ höchst aufgeladenen Literaturverständnisses, das bestimmte Themen, Lebens- und Erfahrungsbereiche, aber auch Darstellungsweisen als unwürdig ausschließt – unwürdig in einem doppelten Sinne, nämlich die Würde des Menschen verletzend und deshalb der künstlerischenKunst, Künstler Darstellung nicht würdig. Die Menschenwürde droht so im literarischen Diskurs und in der Literaturkritik zu einer Art Totschlagargument zu werden, das dazu dient, ein bestimmtes Bild von Literatur zu konservieren.45
3. Diametral steht dem die sog. „literarische Anthropologie“ entgegen.46 Aus ihrer Sicht ist Literatur „der Diskurs des Anderen der VernunftVernunft“,47 neben der philosophischen oder medizinischen Anthropologie also ein eigenes anthropologisches Medium, das den Menschen in seiner Gesamtheit anspricht, darstellt und untersucht, gerade auch das vermeintlich Unwürdige und Grenzwertige als Erkenntnisfelder mit eigener Berechtigung betrachtet und so dem Wissen um den Menschen und das Menschliche dient. Dies hat zum einen Konsequenzen für die Beschaffenheit der Literatur selbst, etwa durch das Aufkommen neuer Gattungen – (Auto-)Biographie, Fallgeschichte, Roman48 –, zum anderen für die Vorstellung der Menschenwürde. Lehmann hat zu Recht festgestellt, „daß die anthropologische Offensive zur Herstellung des sogenannten ganzen Menschen die Tendenz hat, eben diesen Menschen in seiner Dignität bzw. seiner Sonderstellung in der Natur zu unterminieren“.49 Wenn das Wissen um und das Bild vom Menschen erweitert werden, steht auch die Definition seiner Würde zur Diskussion.
II.3. LessingsLessing, Gotthold Ephraim Poetik der IdentifikationIdentifikation und des MitleidsMitleid
LessingsLessing, Gotthold Ephraim literarisches und publizistisches Schaffen kann zweifellos als Kampf für die Menschenwürde gelesen werden – als Kampf für die politische wie gesellschaftliche Emanzipation des Einzelnen, gegen den vernunftwidrigen und menschenfeindlichen religiösen Dogmatismus, für Toleranz und Menschlichkeit, für eine Erziehung des Menschen zu Selbstbestimmtheit und FreiheitFreiheit.1 Eine tatsächlich poetologische und ästhetische Bedeutung erhält die Menschenwürde jedoch in Lessings Ablehnung der Ständeklausel und in der Begründung der Mitleidspoetik.2
Die konzeptionelle Widersprüchlichkeit der Ständeklausel3 beruht auf der problematischen Tatsache, dass kontingente Würde die Voraussetzung für Tragödienfähigkeit darstellt, die Tragödie gleichzeitig aber beansprucht, für den Menschen an sich relevante moralische Lehren zu vermitteln. LessingLessing, Gotthold Ephraim und andere Theoretiker des sich als eigene Gattung etablierenden bürgerlichen Trauerspiels erkennen diese Diskrepanz – und fokussieren sie auf den Begriff der Würde. Grundlegend ist Lessings wirkästhetische Bestimmung der Tragödie: „Die Tragödie soll Leidenschaften erregen.“4 Um beim Zuschauer „Rührung“ zu provozieren, führt Lessing im 14. Stück der Hamburgischen Dramaturgie aus, sind die „Namen von Fürsten und HeldenHeld“ jedoch nicht nötig, ja sie erschweren sogar die unerlässliche IdentifikationIdentifikation mit den Bühnenfiguren: „Das Unglück derjenigen, deren Umstände den unsrigen am nächsten kommen, muß natürlicher Weise am tiefsten in unsere Seele dringen; und wenn wir mit Königen MitleidenMitleid haben, so haben wir es mit ihnen als mit Menschen, und nicht als mit Königen.“5 Dramenpoetisch relevant sind Figuren, insbesondere Helden, nicht aufgrund ihres Standes, sondern allein als Menschen. In Anlehnung an den französischen Schriftsteller Marmontel stellt Lessing fest, dass der „geheiligte[] Name[] […] des Menschen überhaupt […] pathetischer, als alles“ sei; einer in Not geratenen Familie etwa fehle nichts, „um der Tragödie würdig zu seyn“.6 Poetische oder tragische Dignität sind demnach nicht von kontingenten sozialen Formen von Würde abhängig; tragische Würde spricht Lessing vielmehr dem Menschen an sich zu.7 Den Stoff für die Tragödie liefern das Allgemeinmenschliche sowie grundlegende, ständeübergreifende menschliche Probleme und Situationen.8 Christian GarveGarve, Christian lehnt in seinen Ausführungen zum bürgerlichen Trauerspiel die Fixierung auf die vermeintlich „größre Würde der Könige“ als Voraussetzung für Tragödienfähigkeit mit einem vielsagenden Argument ab: „In der Tat, bei dem aufgeklärten edlern Teile der Zuschauer existiert diese Idee von Würde gar nicht […].“9 Garve zufolge ist in den Augen des aufgeklärten, selbstbewusstenSelbstbewusstsein – bürgerlichen – Publikums die Vorstellung einer besonderen, auf gesellschaftlicher Stellung, Herkunft oder Macht beruhenden Würde, die sich eben nicht nur in der realen politisch-sozialen Realität, sondern auch in der dramatischen Praxis manifestiert, obsolet geworden. Dies impliziert aber auch: Es existiert eine andere Idee von Würde, ein essentiell anderer Würdebegriff, eine Würde nämlich, die ‚dem Menschen‘ (im Singular!) eignet – und diese Idee der allgemeinen Menschenwürde äußert sich poetologisch im Postulat der Tragödienwürdigkeit ‚des Menschen‘.10 Diese Redefinition der Tragödienwürdigkeit, die das Moment der Identifikation des Zuschauers mit der Bühnenfigur betont, hängt nun unmittelbar mit jenem Begriff zusammen, den Lessing ins Zentrum seiner Wirkästhetik stellt: dem Mitleid.
LessingLessing, Gotthold Ephraim präzisiert seine Tragödiendefinition; diese soll nicht nur Leidenschaften erregen, sondern „sie soll unsre Fähigkeit, MitleidMitleid zu fühlen, erweitern“.11 Beim Zuschauer Mitleid hervorzurufen, ist allerdings nur möglich, wenn sich dieser mit dem Bühnengeschehen und den Bühnenfiguren identifizierenIdentifikation kann. Dies ist deshalb von entscheidender Bedeutung, weil Lessing das Mitleid und die Mitleidfähigkeit als zentrale Momente einer Idealvorstellung des Menschen definiert:
Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch, zu allen gesellschaftlichen TugendenTugend, zu allen Arten der Großmut der aufgelegteste. Wer uns also mitleidigMitleid macht, macht uns besser und tugendhafter, und das Trauerspiel, das jenes tut, tut auch dieses, oder – es tut jenes, um dieses tun zu können.12
Dieses vielzitierte Theorem enthält ein eindeutiges relatives Werturteil: Sowohl das MitleidMitleid als auch das Menschsein sind abstufbar; impliziert wird ein Entwicklungs-, ein VervollkommnungszielPerfektibilität, Vervollkommnung,13 das über das ästhetische Spiel erreicht werden soll. Vervollkommnungspotential eignet dem Mitleid, wenn der Zuschauer sich auf der Bühne wiedererkennt, eine Beziehung zur eigenen Existenz herstellt und deshalb Furcht empfindet: „Furcht ist das auf uns selbst bezogene Mitleid.“14 Mitleidswürdig ist eine Bühnenfigur also nur, wenn der Zuschauer sie als (Mit-)Menschen er- und anerkennt.15
Dies ist insofern ein genuin ästhetischer Beitrag zum Menschenwürdediskurs, als die vorausgesetzte mitleidendeMitleid IdentifikationIdentifikation mit der Bühnenfigur der dramatischen KunstKunst, Künstler zwei Möglichkeiten eröffnet: Im Prozess der Identifikation, die sich bei der Rezeption einstellt, steht zum einen die Menschenwürde – sowohl als abstrakte Vorstellung als auch als Eigenschaft des einzelnen Menschen – zur Diskussion.16 LessingsLessing, Gotthold Ephraim Mitleid ist reflexiv. Der Zuschauer soll nicht nur die dramatisierten Affekte nachvollziehen, sondern selbst empfinden und sich so seines Menschseins bewusst werden;17 das Mitleid ist die „sich fühlende[] Menschlichkeit“.18 Dies führt zu einer Integration vermeintlicher und tatsächlicher menschlicher Charakterschwächen, Fehler und Deformationen, die auf der Bühne thematisiert werden, in den Würdebegriff.19 Da vorausgesetzt werden kann, dass der Zuschauer seine eigene Menschenwürde ganz selbstverständlich behaupten und im Zweifelsfall auch verteidigen würde, erlaubt Lessings Bestimmung der Tragödie somit eine Verhandlung des Menschenwürdebegriffs im Bereich der Ästhetik, gleichsam in der ästhetischen Erfahrung, mit dem tendenziellen Ziel, dem Menschen als Menschen Würde zuzuschreiben und streng normative Würdevorstellungen zu transzendieren.20 Zum anderen, und durchaus in einem gewissen Widerspruch hierzu, dient das Erhöhen der Mitleidfähigkeit der VervollkommnungPerfektibilität, Vervollkommnung des Menschen (des Zuschauers!) – und ist somit doch wiederum an einem Ideal orientiert. Lessings Mitleid ist eine spontane sinnlicheSinnlichkeit, prärationale21 und genau deshalb zutiefst menschliche Empfindung, die durch die Tragödie zwingend geweckt und gefördert werden soll – und die einen a priori moralischen Charakter besitzt.22 Die aristotelische kátharsis, die Lessing als Fähigkeit der Affekte deutet, sich selbst zu reinigen und dadurch zu mäßigen, bewirkt die „Verwandlung der Leidenschaften in tugendhafteTugend Fertigkeiten“.23 Entscheidend ist, dass diese Tugendhaftigkeit ihren Ursprung in der menschlichen Sinnlichkeit hat, und genau deshalb kommt dem ästhetischen Medium, das diese Sinnlichkeit anregt, mehr als eine Vermittlerfunktion zu. Die Ästhetik, die Kunst, die Literatur – sie haben überragende anthropologische Bedeutung. Das Tugendideal, das Lessings Dramentheorie zugrunde liegt, ist somit auch kein kaltes, vernünftelnd-abstraktes, sondern das einer empfindsamen, praktisch orientierten Menschlichkeit.24