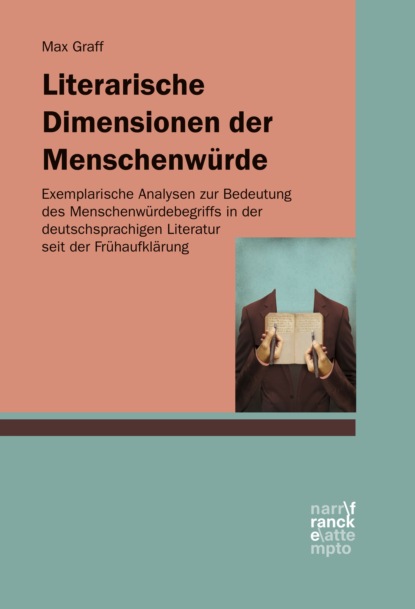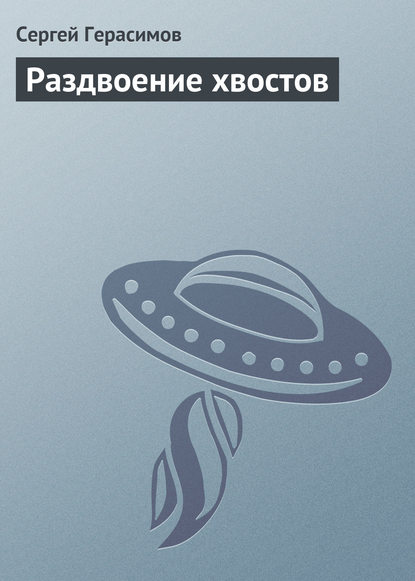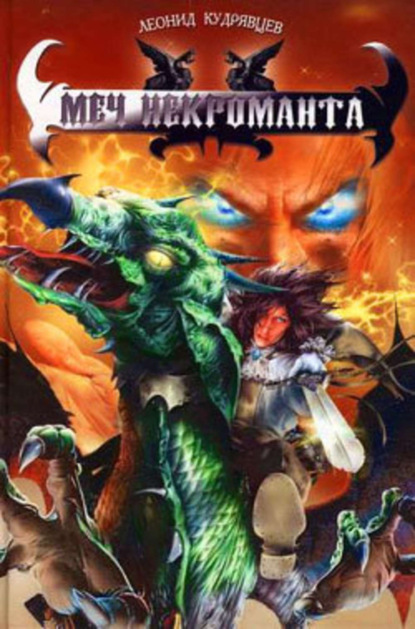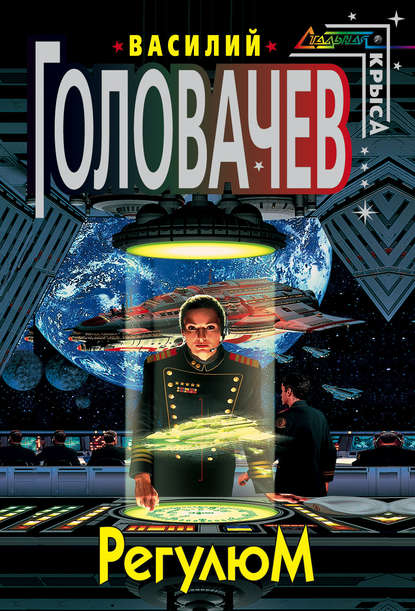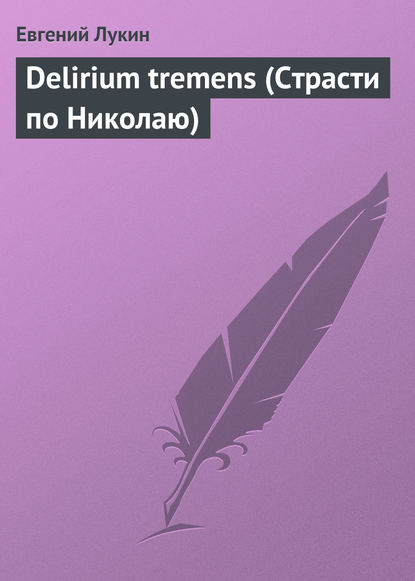- -
- 100%
- +
Diese Aufwertung der SinnlichkeitSinnlichkeit ist zwar bemerkenswert, doch keineswegs radikal. Zwar ist sie – im Sinne empfindsamer Menschlichkeit und Empathiefähigkeit – wesentlicher Bestandteil der Vorstellung menschlicher Würde; die menschliche SexualitätSexualität, Sex etwa und die sensualistische Triebhaftigkeit bleiben von dieser Vorstellung aber vollkommen ausgeschlossen.25
LessingsLessing, Gotthold Ephraim Poetik spiegelt die Ambivalenz des aufklärerischen Menschenwürdebegriffs: Die Ablehnung der Ständeklausel, die Betonung von IdentifikationIdentifikation und MitleidswürdigkeitMitleid deuten die Idee inhärenter Würde an; das Beharren auf der zu befördernden Mitleidfähigkeit und der daraus abgeleiteten TugendhaftigkeitTugend verweisen auf ein Würdeideal, das weiterhin als Gestaltungsauftrag verstanden wird.
II.4. Menschenwürde, SinnlichkeitSinnlichkeit und Tat bei J.M.R. LenzLenz, Jakob Michael Reinhold
Jakob Michael Reinhold LenzʼLenz, Jakob Michael Reinhold ästhetische Schriften illustrieren eine bemerkenswerte Akzentverschiebung innerhalb der aufklärerischen Auseinandersetzung mit Wesen und Würde des Menschen. In der Eingangspassage seines Textes Über Götz von Berlichingen1 formuliert Lenz eine Diagnose des zeitgenössischen Menschenlebens. „Wir werden geboren –“, und in der Folge verläuft die menschliche Existenz in festgelegten, vorhersehbaren sozialen, beruflichen und familiären Bahnen, die kaum Raum für die Entfaltung von IndividualitätIndividualität lassen: „und was bleibt nun der Mensch noch anders als eine vorzüglichkünstliche kleine MaschineMaschine, die in die große Maschine, die wir Welt, Weltbegebenheiten, Weltläufte nennen besser oder schlimmer hineinpaßt“ (LW 2, 637). Lenz beklagt die totale Entfremdung des Menschen von seiner Bestimmung, mithin seiner – aus der Sicht des Theologen letztlich von GottGott gegebenen – Würde: „Aber heißt das gelebt? heißt das seine Existenz gefühlt, seine selbstständige Existenz, den Funken von Gott?“ (LW 2, 637–638). Das Verfehlen des ‚wahren Lebens‘ stürzt den Menschen gar in eine „ewige Sklaverei“, eine „nur künstlichere, eine vernünftigeVernunft aber eben um dessentwillen desto elendere Tierschaft“ (LW 2, 638). Die sprachliche Präsentation dieser Diagnose verweist eindringlich auf für die gesamte Bewegung des Sturm und Drang leitmotivische Gedanken. Die erste Person Plural suggeriert die Unmöglichkeit von Individualität und Selbstgestaltung, das Passiv die Einbuße von Handlungsmacht,2 die den Menschen nicht zum Subjekt seiner eigenen Handlungen, sondern zum ObjektObjekt, Objektifizierung, Ding, Verdinglichung, Dinghaftigkeit von fremdgesteuerten Vorgängen macht. Die dreifach variierte Metaphorik – der Mensch als Maschine,3 als Sklave und als TierTier, Vertierlichung, Theriomorphisierung – weist in dieselbe Richtung: Sie beschreibt eine Degradierung des Menschen, ein Nicht-Erfüllen von Anlagen und Möglichkeiten. Die hieran geknüpfte Kritik ist ebenfalls eine dreifache: Zunächst zielt sie ganz allgemein auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, die dem IndividuumIndividuum eine unabhängige Selbstverwirklichung verwehren. Konkret ist es dann die zunehmende Rationalisierung, die mechanische Organisation der Existenz, die paradoxerweise den menschlichen Handlungs- und Entscheidungsspielraum massiv beschneidet. Auf einer anthropologischen Ebene greift Lenz schließlich das mechanistische Menschenbild des französischen Materialismus an, das den Menschen zu einer dem Tier ähnlichen, determiniertenDetermination Maschine reduziert. Energisch stellt Lenz seiner Diagnose die Utopie des handelnden Menschen entgegen:
Was lernen wir hieraus? Das lernen wir hieraus, daß handeln, handeln die Seele der Welt sei, nicht genießen, nicht empfindeln, nicht spitzfündeln, daß wir dadurch allein GottGott ähnlich werden, der unaufhörlich handelt und unaufhörlich an seinen Werken sich ergötzt: das lernen wir daraus, daß die in uns handelnde Kraft, unser Geist, unser höchstes Anteil sei, daß die allein unserm KörperKörper mit allen seinen SinnlichkeitenSinnlichkeit und Empfindungen das wahre Leben, die wahre Konsistenz den wahren Wert gebe […]. (LW 2, 628)
Formal geschickt ist die rhetorische Gestaltung: Die subiectio sowie die zahlreichen Wiederholungsfiguren untermauern den Vortragsgestus, sodass die fundamentalen Bestimmungen in dieser Passage selbst zu einer Art (Sprech-)Handlung werden. Inhaltlich bemerkenswert sind die Kommentare zu Geist und KörperKörper. Ersteren definiert LenzLenz, Jakob Michael Reinhold hier nicht etwa als erkennende oder urteilende, sondern als im Menschen „handelnde Kraft“. Diese ist zum einen ein analogon jener Handlungs- oder Bewegungskraft,4 die die „Seele der Welt“ ist; zum anderen ist es aber auch das Handeln, und nicht primär die TugendTugend, die VernunftfähigkeitVernunft, das Denken o.Ä., das den Menschen adelt und aus der SchöpfungSchöpfung heraushebt. Der handelnde Geist schließlich verleiht nun auch dem Körper seinen „wahren Wert“. Bedeutsam ist nicht nur, wie selbstverständlich Lenz den Körper aufwertet, sondern auch, dass er ausdrücklich die SinnlichkeitenSinnlichkeit – im Plural, ja sogar „alle“ – in die Vorstellung des Menschen als wertvolles Wesen integriert sehen will.
Die Forschung beschreibt LenzʼLenz, Jakob Michael Reinhold Menschenbild, wie er es vor allem in seinen moralischen und theologischen Schriften entwickelt, meist im Hinblick auf seine Auseinandersetzung mit den französischen Materialisten Holbach, Helvétius und La Mettrie.5 Deren Apologie des KörpersKörper und der Leidenschaften nimmt Lenz auf, verwirft jedoch ihren strengen DeterminismusDeterminismus. Auch für Lenz ist Bewegung eine anthropologische Fundamentalkategorie; die Leidenschaften, das menschliche Begehren werden als gottgewollter Motor von Bewegung legitimiert. Die „Konkupiszenz“ ist somit Ursprung und Anlass jeder menschlichen Handlung – trotzdem handelt der Mensch nicht unfrei. Vielmehr ist die Konkupiszenz in ständigem Konflikt mit dem göttlichen Verbot, und genau in diesem Spannungsfeld erwächst die FreiheitFreiheit des Menschen.6 So ist das Begehren, auch und vor allem das sexuelleSexualität, Sex, gar die Voraussetzung für menschliche Freiheit. Der Trieb soll keineswegs unterdrückt, sondern muss sublimiert werden7 – dann ist moralisches Handeln möglich.8 Aus dieser Perspektive besteht kein Antagonismus zwischen Trieb und Leidenschaften auf der einen und VernunftVernunft und Verstand auf der anderen Seite; jene setzen diese erst in Bewegung.9
Unter diesen Voraussetzungen wird LenzʼLenz, Jakob Michael Reinhold enthusiasmierte Apologie der Handlung und der Tat in Über Götz von Berlichingen verständlich. Gegen das Pathos zeitgenössischer Dramen und gegen deren HeldenHeld polemisiert er heftig: „Schurken und keine Helden! was habt ihr getan, daß ihr Helden heißt?“ (LW 2, 638). Die Vehemenz erklärt sich aus der streng wirkästhetischen Argumentation; Lenz lenkt den Blick auf die „Folgen“ und die „Wirkung“ der Dramen. Von diesen verlangt er einen „lebendige[n] Eindruck, der sich in Gesinnungen, Taten und Handlungen hernach einmischt“, einen „prometheische[n] Funken“ (LW 2, 639), der auf den Zuschauer überspringt und dessen zukünftiges Verhalten beeinflusst. Genau deshalb verteidigt er GoethesGoethe, Johann Wolfgang Götz: „[D]a ist der ganze Mann, immer weg geschäftig, tätig“. Geschäftigkeit, Tätigkeit, Handeln, Bewegung – „Wer so gelebt hat, wahrlich, der hat seine Bestimmung erfüllt“ (LW 2, 640), und zwar aus folgendem Grund: „FreiheitFreiheit“ besteht für den Menschen nur dort, wo die „handelnde Kraft“ im Menschen „Platz zu handeln“ findet. Kultiviert er die handelnde Kraft in solchem Maße, dass er frei handeln kann, ahmt der Mensch GottGott nach und erreicht den Gipfel menschlichen Seins: „Seligkeit! Seligkeit! Göttergefühl das!“ (LW 2, 638). Als Handelnder erweist sich der Mensch seiner Würde würdig; genau deshalb kann das Theater, in dem „alles auf Handlung an[kommt]“ (LW 2, 641), nicht nur zu einem analogon, sondern sogar zur schönsten „Vorübung“ für das „große[] Schauspiel des Lebens“ werden (LW 2, 640). Denn hier lernt der Mensch das Handeln, wenn der „prometheische Funken“ überspringt.
In den Anmerkungen übers Theater (1774), seiner Auseinandersetzung mit Aristotelesʼ Poetik und deren Rezeption, stellt LenzLenz, Jakob Michael Reinhold – ähnlich wie später Arno HolzHolz, Arno10 – nicht so sehr die Begriffe des Handelns und der Tat, sondern jene des Charakters und des IndividuumsIndividuum in den Fokus. Zunächst liefert er eine spezifisch auf den poetischen Kontext gemünzte Definition des Menschen. Der Mensch, die „erste Sprosse auf der Leiter der freihandelnden selbstständigen Geschöpfe“ (LW 2, 645), ist, mit Aristoteles, ein zur Mimesis neigendes Wesen, ja empfindet überhaupt nur durch Nachahmung Vergnügen11 und unterscheidet sich genau dadurch vom TierTier, Vertierlichung, Theriomorphisierung.12 Dies begründet den „Wert“ des Dramas (LW 2, 642) und den „Reiz“ der Poesie (LW 2, 645), ist deren „Wesen“ doch ebenfalls Nachahmung (LW 2, 645), und zwar durch den Dichter, der „Standpunkt [nimmt]“ (LW 2, 648) und „alles scharf durchdacht, durchforscht, durchschaut – und dann in getreuer Nachahmung zum andernmal wieder hervorgebracht“ (LW 2, 649). Seiner Aristoteles-Exegese legt Lenz nun die Leitfrage zugrunde, ob „der Mensch“ oder das „Schicksal des Menschen“ „Hauptgegenstand der Nachahmung“ sei (LW 2, 650). Lenz positioniert sich deutlich, und das ist die entscheidende Akzentuierung: Weder das Schicksal, eine für Lenz durch und durch antike Vorstellung, noch die Begebenheiten, noch die Fabel oder Handlung im poetologisch-dramaturgischen Sinne, noch „bloß Leidenschaften“ oder allgemeinmenschliche Lehren und „Gesetze der menschlichen Seele“ (LW 2, 652) machen die Tragödie aus, sondern die Charaktere in ihrer IndividualitätIndividualität. In deutlicher Abgrenzung zu LessingLessing, Gotthold Ephraim formuliert Lenz: „[D]ie Hauptempfindung in der Tragödie ist die Person, die Schöpfer ihrer Begebenheiten“ (LW 2, 668).13 Charaktere sind jene, „die sich ihre Begebenheiten erschaffen, die selbstständig und unveränderlich die ganze große MaschineMaschine selbst drehen“, sich also nicht durch Umstände und äußere Faktoren in ihren Handlungen bestimmen lassen und nicht, wie Lenz im Götz-Text klagt, selbst nur Rädchen einer großen Maschine sind. In diesem Fall spricht man „nicht von Bildern, von Marionettenpuppen – von Menschen“ (LW 2, 654). Der Gedankenstrich legt nahe, die Vokabel „Menschen“ hier in einem ganz emphatischen Sinn zu lesen; nur solche Charaktere, die tatsächlich autonomAutonomie, tatkräftig und frei, gleichsam als selbstbewussteSelbstbewusstsein, emanzipierte Subjekte, handeln, übrigens unabhängig von ständischen Überlegungen, entsprechen vollständig Lenzʼ Menschenwürdevorstellung14 – die durch die Darstellung in der Tragödie propagiert werden soll. In der Figur des Brutus aus ShakespearesShakespeare, William Julius Caesar erkennt Lenz einen Charakter, der seinen Vorstellungen entspricht, und lobt sie – lakonisch, aber mit bedeutungsschweren Worten: „[W]em die Würde menschlicher Natur nicht dabei im Busen aufschwellt und ihm den ganzen Umfang des Worts: ‚Mensch‘ – fühlen läßt –“ (LW 2, 665).15 Somit macht Lenz den Zusammenhang zwischen seiner Auffassung des Charakters, der Literatur und der Menschenwürde explizit. Würde und Menschsein bestimmt er dabei gerade nicht als rationalRationalität erschlossene oder erkannte Konzepte, sondern als zu fühlende, betont also ihre ästhetischen Dimensionen. Gleichzeitig legt er besonderen Wert darauf, jede Tendenz zur Idealisierung und zur Typisierung zu delegitimieren. „Genauigkeit und Wahrheit“ (LW 2, 653) sind die obersten Kriterien der Figurenzeichnung; die „Mannigfaltigkeit der Charaktere und Psychologien“ (LW 2, 661) ist es, die das Genie reizt. Es geht, um einen Erzählerkommentar aus Lenzʼ Zerbin abzuwandeln, nicht primär um die Würde der Gattung, sondern um die Würde der Individuen.16
Würde und FreiheitFreiheit des IndividuumsIndividuum postuliert LenzLenz, Jakob Michael Reinhold freilich in seiner eigenen Dramenproduktion ex negativo. Seine Dramen Der Hofmeister (1774) und Die Soldaten (1776) etwa sind keine konventionellen Tragödien; vielmehr entwickelt Lenz in der Praxis eine tendenziell offene Dramenform,17 die es ihm erlaubt, den Blick auf das Individuum – die „Hauptempfindung“ der Tragödie – und auf die „Begebenheiten“ – die „Hauptempfindung“ der Komödie – zu lenken, d.h. jene Umstände, Bedingungen, Verhältnisse und inneren Pathologien, die das freie Handeln in Frage stellen.
Prägnant formuliert: LenzʼLenz, Jakob Michael Reinhold Werk durchzieht zum einen die Idee, dass die Anerkennung des menschlichen Triebes, seiner SinnlichkeitSinnlichkeit, Körperlichkeit und SexualitätSexualität, Sex die Vorstellung der menschlichen Wesenswürde nicht konterkariert, sondern vielmehr ihre notwendige Korrektur darstellt. Zum anderen inszeniert Lenz das Scheitern des Menschen daran, seiner Würde vollends gerecht zu werden – und aktiviert so das sozialkritische Potential der Literatur, lenkt er doch den Blick auf jene Zwänge und Hindernisse, die die Sublimierung des menschlichen Triebes und somit emanzipiertes, autonomesAutonomie Handeln verhindern.18 Würde ist in diesem Sinne ein Gestaltungsauftrag nicht nur für das IndividuumIndividuum, sondern für die gesamte GesellschaftGesellschaft.19
II.5. Ästhetische Menschenwürde: Karl Philipp MoritzMoritz, Karl Philipp
Karl Philipp MoritzʼMoritz, Karl Philipp Beiträge zum Menschenwürdediskurs sind insofern von grundlegender Bedeutung, als der vielseitige, produktive Autor unterschiedliche, mitunter konfligierende Positionen artikuliert und so beispielhaft für die geistes- und literaturgeschichtlichen Strömungen zwischen Aufklärung und Weimarer Klassik und darüber hinaus steht.1
MoritzʼMoritz, Karl Philipp Magazin zur Erfahrungsseelenkunde (1783–1793) war die erste deutsche psychologische Zeitschrift. In einer Ankündigung seines Projekts skizziert er das Menschenbild, das das Interesse an den „Krankheiten der Seele“2 rechtfertigt – und verbindet damit auch programmatische Aussagen zur Literatur. Methodisch setzt Moritz bei seinem Unternehmen, das er als ein dezidiert moralisches mit „praktischem Nutzen“ versteht, auf „Beobachtungen und Erfahrungen“ (MW 1, 794) statt auf ein apriorisches System.3 Das IndividuumIndividuum als Objekt der Beobachtung, als Nutznießer der erfahrungsseelenkundlerischen Praxis, aber auch als Subjekt von MoralMoral, Moralität, erhält eine emphatische Aufwertung4 – zunächst unabhängig von normativen Vorstellungen des Menschlichen. Gerade vermeintlich Würdelose wie Verbrecher, Selbstmörder, sozial Benachteiligte, Charakterschwache, Lasterhafte, Verrückte, wie auch immer Beeinträchtigte – d.h. all jene Menschen, die von der ‚Norm‘ abweichen oder menschliche Grenzbereiche und Dysfunktionen verkörpern – rücken in den Fokus der Beobachtung. Auch „Karaktere und Gesinnungen aus vorzüglich guten Romanen und dramatischen Stücken, […] welche ein Beitrag zur innern Geschichte des Menschen sind“, lässt Moritz als Erkenntnisquelle gelten, freilich mit der Einschränkung, dass der „praktische Wert“ von „Beobachtungen aus der wirklichen Welt“ um ein Vielfaches höher sei (MW 1, 796). Tatsächlich formuliert Moritz ein anthropologisches Realismuspostulat;5 den Hang zur Idealisierung des Menschen gerade in der Fiktion kritisiert er als realitätsfern und -verfälschend.6 Vielmehr solle – und dies ist eine Bestimmung von zentraler Bedeutung – „auch den geringsten Individuis“ ihr Wert bewusst gemacht werden (MW 1, 804). Denn obwohl Moritz sowohl in der Natur als Ganzem als auch innerhalb der Menschheit von natürlichen Rangunterschieden ausgeht, ist der Mensch trotz aller „Verschiedenheit“ stets ein würdevolles Wesen: „Der Allerunterste auf der Staffel der Menschheit bliebe doch noch immer ein Meisterstück auf Erden, wenn er der einzige in seiner Art wäre“ (MW 1, 807).7 Diesen „Gedanke[n]“ – nämlich die „Würde“ bzw. den „Wert der Menschheit“ (MW 1, 808 bzw. 809) – bezeichnet Moritz als „versöhn[end]“; er stiftet das „Herz“ zu „Liebe“ an, statt „Haß und Verachtung“ gegenüber menschlichen Pathologien und Deformationen hervorzurufen (MW 1, 808). Zwei Aspekte sind auffällig: Die Würde der Menschheit ist in diesem Text zum einen etwas, das, wie bereits bei HerderHerder, Johann Gottfried und LenzLenz, Jakob Michael Reinhold,8 „[ge]fühl[t]“ (MW 1, 808), mithin sinnlichSinnlichkeit empfunden wird, also ein durchaus ästhetisches Konzept – und nicht (nur) Inhalt philosophischer oder theologischer Überlegungen. Zum anderen erscheint Menschenwürde an dieser Stelle als eine von ethischen Bestimmungen unabhängige Qualität.9
Das Verhältnis von Erfahrungsseelenkunde und Literatur ist für MoritzMoritz, Karl Philipp klar definiert. Literatur als solche ist nur bedingt geeignet, die Kenntnisse vom Menschen zu erweitern. Gerade deshalb muss sie sich zwingend an der neuen Disziplin orientieren: „[Der] Dichter und Romanenschreiber wird sich genötigt sehn, erst vorher Erfahrungsseelenlehre zu studieren, ehe er sich an eigene Ausarbeitungen wagt“ (MW 1, 798). Diese nicht nur wissenschaftlich-philosophische, sondern indirekt auch literarische Aufwertung des vermeintlich Würdelosen, die bereits bei LenzLenz, Jakob Michael Reinhold vorbereitet ist, weist voraus auf BüchnerBüchner, Georg, der seine Figur Lenz im Kunstgespräch postulieren lässt, dass „einem keiner zu gering“ sein dürfe, aber auch auf den Naturalismus und den Expressionismus10 – jedoch besteht ein entscheidender Unterschied: Das Bestehen auf der Menschenwürde auch des Geringsten bleibt im Endeffekt doch stets untrennbar an das Ziel der VervollkommnungPerfektibilität, Vervollkommnung der Menschheit als Gattung gekoppelt. Sein Magazin, so Moritz, sei deshalb ein „wichtiges Werk für die Menschheit“, weil durch ein solches Projekt „das menschliche Geschlecht durch sich selber mit sich selber bekannter werden, und sich zu einem höhern Grade der Vollkommenheit empor schwingen könnte“ (MW 1, 797).11 Würde ist demnach noch kein eindeutig absoluter Wert.
Gleichwohl ist MoritzMoritz, Karl Philipp ein „radikale[r] Anthropozentriker“,12 der mit dem Hinweis auf die Menschenwürde bisweilen scharfe Gesellschaftskritik übt. Explizit problematisiert und missbilligt er etwa die Vorstellung kontingenter sozialer Würde;13 sein reges Interesse gilt den sozial Benachteiligten und den Unterdrückten. Nachdrücklich postuliert Moritz die AutonomieAutonomie und die freie SelbstbestimmungSelbstbestimmung14 des IndividuumsIndividuum als unmittelbar mit der Menschenwürde verbundene Wesenszüge; als EntwürdigungEntwürdigung geißelt er deren Einschränkung oder Negation durch Gesellschaftsordnung und Staat.15
In seinem moralphilosophischen Essay Das Edelste in der Natur (1786)16 begründet MoritzMoritz, Karl Philipp – freilich ohne den Begriff zu benutzen – die Menschenwürde als (auch) ästhetische Qualität:
Was gibt es Edleres und Schöneres in der ganzen Natur, als den Geist des Menschen, auf dessen VervollkommnungPerfektibilität, Vervollkommnung alles übrige unablässig hinarbeitet, und in welchem sich die Natur gleichsam selbst zu übertreffen strebt. (MW 2, 15)
MoritzʼMoritz, Karl Philipp Bestimmung der Würde des Menschen stützt sich hier gleich auf mehrere Motive: Es ist die ratioVernunft – und nicht der KörperKörper –, die den Menschen aus dem übrigen Naturzusammenhang heraushebt, deren „VervollkommnungPerfektibilität, Vervollkommnung“ gleichzeitig auch das Telos der Natur darstellt. Den Geist belegt Moritz mit Epitheta, die ihn als ethisch („edel“) und ästhetisch („schön“) auszeichnen. Darüber hinaus ist der menschliche Geist ein zweiter Schöpfer, der nicht nur die ihm untertane Natur formt und transformiert, sondern künstlerischKunst, Künstler „im Kleinen“ nachahmt und so „ihre Schönheiten im verjüngten Maßstabe dar[stellt]“ (MW 2, 16). Der Künstler17 schafft das die Schönheit der in sich vollendeten Natur spiegelnd aktualisierende Kunstwerk und ist deshalb der Gipfel der SchöpfungSchöpfung, der Würdigste unter allen Würdigen (vgl. MW 2, 17);18 durch die „Betrachtung [der] Kunstwerke“ kann wiederum der „menschliche Geist“ „veredelt und verfeinert werden“ (MW 2, 18).19 Zudem nimmt Moritz die von KantKant, Immanuel kurz zuvor formulierte Selbstzweckformel auf: „Der einzelne Mensch muß schlechterdings niemals als ein bloß nützliches sondern zugleich als ein edles Wesen betrachtet werden, das seinen eigentümlichen Wert in sich selbst hat […]“ (MW 2, 19; Herv. i.O.). Die Selbstzweckhaftigkeit aller „denkenden Wesen“, die wiederum eine prinzipielle Gleichheit aller Menschen insinuiert, muss der Mensch „empfinden“ und „fühlen“ (!) (MW 2, 18). Grund dieser Selbstzweckhaftigkeit ist die Tatsache, dass der menschliche Geist „ein in sich selbst vollendetes Ganze [sic]“ ist (MW 2, 19) – und genau das ist Moritzʼ Definition der genuin ästhetischen, von allen Nützlichkeitsabwägungen freien Qualität eines Kunstwerks.20
MoritzMoritz, Karl Philipp parallelisiert somit die Würde des Menschen mit der Würde des Kunstwerks. Noch deutlicher als oben wird die Menschenwürde zu einem ästhetischen Begriff: Zwar wird sie argumentativ begründet und definiert als Selbstzweckhaftigkeit des rationalenRationalität und schöpferischen Menschen, der – in seiner Rationalität! – ein in sich selbst vollendetes Ganzes ist, vom Einzelnen jedoch soll sie mit den unteren Erkenntnisvermögen sinnlichSinnlichkeit empfunden werden. In seiner großen ästhetischen Programmschrift Über die bildende Nachahmung des Schönen, während Moritzʼ Italienreise entstanden und 1788 publiziert, erhält das Verhältnis von Schönheit, KunstKunst, Künstler und Menschenwürde schließlich eine folgenschwere Präzision. Der Text, eine für die Weimarer Klassik grundlegende ästhetische Positionierung, postuliert die AutonomieAutonomie der Kunst sowie die Zweckfreiheit des Schönen und explizitiert die bereits in Moritzʼ früheren Schriften umrissene Vorstellung, dass das Schöne ein nicht rational, sondern ausschließlich mit den unteren Erkenntnisvermögen erfassbares Phänomen ist.21
Zunächst taucht die Vokabel „Würde“ auf, als MoritzMoritz, Karl Philipp das Verhältnis zwischen den Begriffen „schön“ und „edel“ untersucht. Zwar beziehe sich dieser auf die „innre Seelenschönheit“, jener auf die „Schönheit auf der Oberfläche“, und deshalb bedürfe der Mensch, „um edel zu sein, der körperlichenKörper Schönheit nicht“. Trotzdem sei – eine Art physiognomische Gleichung – die äußere ein Spiegel innerer Schönheit, die Moritz auch als „innere Seelenwürde“ bezeichnet. Diese Korrelation dient sogar als Erklärung des „edlen Stils in Kunstwerken“; diesen bestimmt Moritz als Schönheit, die zugleich die „innre Seelenwürde des hervorbringenden Genies“ sichtbar macht (MW 2, 961). Diese eigentlich recht konventionelle Argumentation in der Tradition Winckelmanns und der Antikerezeption des 18. Jahrhunderts22 weist dem Begriff der Würde im Kontext der Ästhetik einen bestimmten Rang zu: Die Seelenwürde als Synonym des Edlen bezeichnet eine Art erhabene Würde, eine ethische Grundhaltung, die innere Größe – oder, um einen strapazierten Begriff zu benutzen: die HumanitätHumanität – eines Menschen. Durch diesen „Mittelbegriff des Edeln“, so Moritz, „wird der Begriff des Schönen […] zum Moralischen hinübergezogen und gleichsam daran festgekettet“ (MW 2, 962). Dieser enge Würdebegriff hat Auswirkungen darauf, was als schön gelten darf. Gleichzeitig ist er mit einem ganz konkreten Ideal verbunden: Die „höchste[] Mischung“ von äußerer und innerer Schönheit, „da wo das äußere Schöne ganz in Ausdruck innrer Würde und Hoheit übergeht“ (MW 2, 968), kennzeichnet Moritz als das „Majestätische“. Dieses ist der Gipfel der Schönheit und, realiter, der SchöpfungSchöpfung, mithin auch der Menschheit. Von dem tendenziell integrativen Würdebegriff des Erfahrungsseelenkundlers unterscheidet sich diese Würde merklich.
Doch von viel größerer Tragweite als die Bedeutungsverengung an dieser Stelle ist die Verbindung von Ästhetik und Geschichtsphilosophie, die den Schluss des Textes prägt und die Vorstellung der Menschenwürde und der unbedingten Hochschätzung des IndividuumsIndividuum und seiner Selbstzweckhaftigkeit vollkommen zu kompromittieren scheint. Ausgangspunkt ist die Idee eines universellen Naturzusammenhangs, in dem alle Dinge und Wesen verkettet sind und den ein ständiger Vollendungsprozess in Bewegung hält. Dieser Vollendungs- oder Vervollkommnungsprozess basiert auf den Prinzipien Zerstörung und Bildung: „Daher ergreift jede höhere Organisation, ihrer Natur nach, die ihr untergeordnete, und trägt sie in ihr Wesen über“ (MW 2, 979).23 Von diesem Naturgesetz ist der Mensch nicht ausgenommen. Entsprechend rücken das Leiden und die Zerstörung des Individuums in den Fokus – und ihre mögliche ästhetische Rechtfertigung.24 „[D]as Individuum muß dulden, wenn die Gattung sich erheben soll“; letzteres ist notwendig, weil sie ihren „Endzweck […] nicht mehr außer sich, sondern in sich hat“ und deshalb „bis zur Empfindung und Hervorbringung des Schönen, sich in sich selber vollenden muß“ (MW 2, 985; Herv. i.O.). Die Selbstzweckhaftigkeit des Individuums überlagert der Endzweck der Gattung; diesen Endzweck beschreibt MoritzMoritz, Karl Philipp zum einen anhand seines eigenen Schönheitsbegriffs, nämlich des in sich selbst Vollendeten, zum anderen definiert er die Vollendung in Bezug auf die künstlerischKunst, Künstler-ästhetische Affinität und Produktivität der Menschheit. Für die Vollendung der Gattung ist „das duldende Individuum“ notwendig;25 in der (künstlerischen) „Darstellung“ aber, so Moritz, wenn das Leiden des Einzelnen in die „Erscheinung“ überführt wird und sich „dem höchsten Vollendungspunkt des Schönen“ annähert, „löst“ es sich „auf“ (MW 2, 985). Durch die Darstellung werde auch die individuelle Dimension überhöht: Sie zeitigt das „erhabnere MitleidenMitleid“, das wiederum die Vollendung der Gattung fördert (MW 2, 985). Das Mitleid stellt nämlich eine Verbindung zwischen dem Leiden und einem Rezipienten her – und garantiert so die Überhöhung.26 Die sowohl als ästhetisch vermittelt gedachte als auch ästhetisch konzeptualisierte VervollkommnungPerfektibilität, Vervollkommnung der Gattung hat demnach absoluten Vorrang vor der Wirklichkeit des Individuums und seines Leidens27 – doch was bedeutet dies für die Vorstellung einer besonderen, individuellen Menschenwürde?