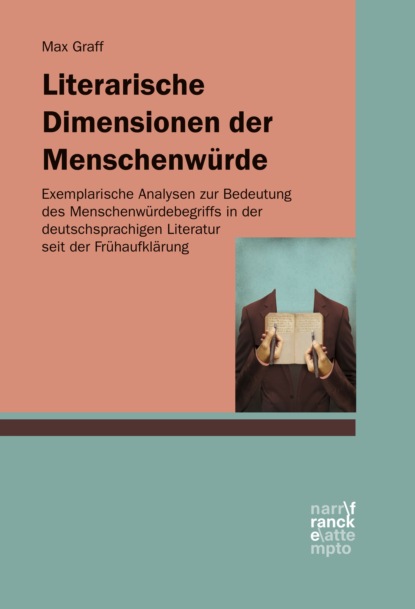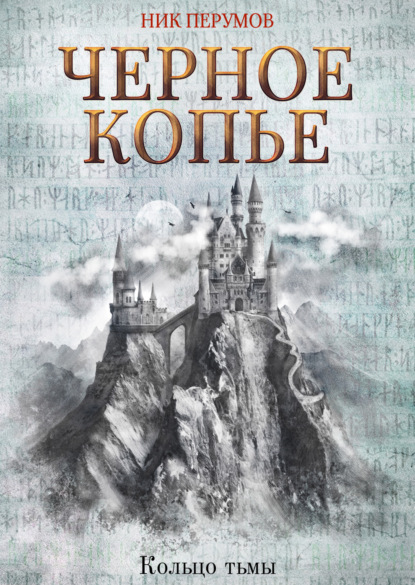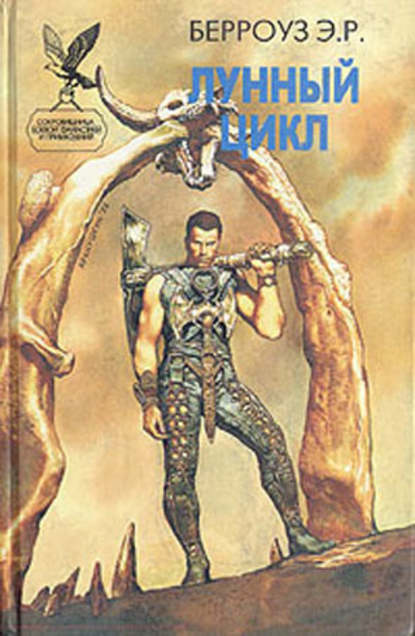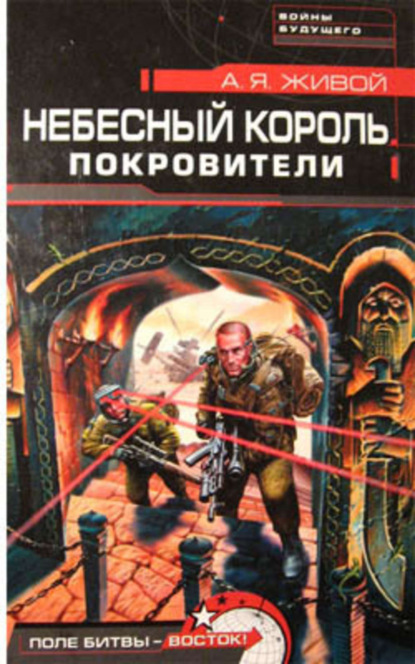- -
- 100%
- +
Wenn SchillerSchiller, Friedrich im 23. der Briefe Ueber die ästhetische Erziehung des Menschen als Ziel der ästhetischen Kultur eine Menschheitsstufe vorschwebt, auf der der Mensch gelernt hat, „edler [zu] begehren, damit er nicht nöthig habe, erhaben zu wollen“ (NA 20, 388), dann erscheint die erhabene Würde als ein nur vorläufig notwendiges Konzept, das irgendwann obsolet werden soll – nämlich dann, wenn der Mensch aus freien Stücken und ohne Willensanstrengung stets moralisch handelt. Diese Vorstellung nähert sich der „schönen Seele“ an, die Schiller in Ueber Anmuth und Würde als „das Siegel der vollendeten Menschheit“ bezeichnet, da in ihr „SinnlichkeitSinnlichkeit und VernunftVernunft, Pflicht und Neigung harmoniren“ (NA 20, 287–288).50 Diese „reifste Frucht [der] HumanitätHumanität“ kennzeichnet er jedoch ausdrücklich als „bloß eine Idee“, nach der der Mensch zwar „mit anhaltender Wachsamkeit streben“ soll, die er aber explizit „bey aller Anstrengung nie ganz erreichen kann“ (NA 20, 289).51 Im 24. Brief der Ästhetischen Erziehung variiert Schiller diesen Gedanken sowohl logisch als auch begrifflich, ohne jedoch das Verhältnis von erhabener und ästhetischer Würde grundlegend zu revidieren:
Es ist dem Menschen einmal eigen, das Höchste und das Niedrigste in seiner Natur zu vereinigen, und wenn seine Würde auf einer strengen Unterscheidung des einen von dem andern beruht, so beruht auf einer geschickten Aufhebung dieses Unterschieds seine Glückseligkeit. Die Kultur, welche seine Würde mit seiner Glückseligkeit in Uebereinstimmung bringen soll, wird also für die höchste Reinheit jener beyden Principien in ihrer innigsten Vermischung zu sorgen haben. (NA 20, 392)
SchillerSchiller, Friedrich umreißt noch einmal die zwei Optionen, mit denen er das Verhältnis der beiden Naturen des Menschen konzeptualisiert: Das, was Schiller hier „Würde“ nennt – und was in der vorangegangen Analyse als erhabene Würde bezeichnet wurde –, meint den absoluten Primat des „Höchste[n]“, der vernünftigenVernunft Natur. Die HarmonieHarmonie, der Ausgleich der Doppelnatur – die ästhetische Würde – figuriert hier (bezeichnenderweise in typisch aufklärerischer Terminologie) als „Glückseligkeit“. Das anvisierte Telos der Menschheitsgeschichte, das Schiller an dieser Stelle keineswegs als per se unerreichbares Ideal beschreibt, sondern indikativisch formuliert, ist hier aber nicht die Ablösung der erhabenen durch die ästhetische Würde, sondern deren Zusammenführung – auch wenn Schiller keine nähere Bestimmung dieser Zusammenführung liefert.52 Gleichwohl bleibt die Aussage des vierten Briefes, dass jeder Mensch „einen reinen idealischen“ – oder: einen würdigen – „Menschen in sich“ trage (NA 20, 316), gültig; Aufgabe der KunstKunst, Künstler ist es, diesen hervorzubringen.
Zusammengefasst und auf die Frage nach der Menschenwürde zugespitzt hieße das: Die ästhetische Würde bleibt tendenziell eine utopische Kategorie, die die eminente gesellschaftliche Stellung und politische Bedeutung der KunstKunst, Künstler und des Dichters53 legitimiert. In der literarischen Praxis bleibt jedoch die erhabene Würde die entscheidendere Kategorie, die mit einer klaren (dramen)poetischen Wirkabsicht verbunden ist.54
*
SchillersSchiller, Friedrich Betonung der ästhetischen Würde des Menschen sowie der erhabenen Würde und ihrer ästhetischen Implikationen birgt die Gefahr einer idealistischen Verkürzung des Menschenwürdebegriffs, die vom IndividuumIndividuum, seinem sozialen Kontext und seiner sozialen Bedingtheit zugunsten des normativen Ideals abstrahiert.55 Obwohl Schiller die Menschenwürde durchaus auch als inhärente Qualität denkt, besteht das Risiko, dass sie nur noch als Ideal, als menschliche Potentialität, als Auftrag erscheint, in demselben Maße, in dem KunstKunst, Künstler zu einer eskapistischen, elitären, auf jeden Anspruch auf realgesellschaftliche Relevanz verzichtenden Ersatzwelt zu werden droht.56 Genau diese Vorstellung – Würde als rein ästhetisches Ideal57 – und ihre bildungsbürgerliche Aneignung werden zur Angriffsfläche für radikal antiklassische literarische Gegenentwürfe, u.a. bei BüchnerBüchner, Georg, Kleist, den Naturalisten und Expressionisten.
II.7. Ausblick: Die Menschenwürde bei GoetheGoethe, Johann Wolfgang
Dem Lexem ‚(Menschen-)Würde‘ kommt bei GoetheGoethe, Johann Wolfgang nicht der zentrale gedanklich-programmatische Stellenwert zu, den es in SchillersSchiller, Friedrich Werk einnimmt.1 Dabei sind jene Fragen, die Schillers Auseinandersetzung mit der Würde fundieren, natürlich auch Goethes Themen: die persönliche AutonomieAutonomie des Menschen, Konflikte von RationalitätRationalität und Gefühl, von Sollen und Wollen, die Bedingungen der Möglichkeit freier Sittlichkeit, die Stellung des Subjekts und sein Verhältnis zur Natur usw. – nur fokussiert Goethe diese nicht wie Schiller auf den Begriff der Menschenwürde. Auch die Goethe-Philologie hat ihre Analysen meist auf andere Termini zugespitzt: HumanitätHumanität, Bildung, Geselligkeit, Entsagung.2 Besonders die Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten, teilweise parallel zu Schillers Briefen Über die ästhetische Erziehung des Menschen in den Horen publiziert, wurden als „Gegenentwurf“ gelesen,3 der statt geschichtsphilosophisch perspektivierter Erziehung durch die KunstKunst, Künstler das Ideal individueller Bildung, auch des Dichters, propagiert, gleichsam eine Pragmatisierung und Konkretisierung des Schillerschen Projekts, seiner Sicht auf Rolle und Einflussmöglichkeit des Künstlers – und nicht zuletzt seines Würdeideals. Goethes bereits 1783 in Das Göttliche formulierter Imperativ: „Edel sei der Mensch, / Hülfreich und gut!“ ist programmatisch. Die menschliche Fähigkeit zur MoralitätMoral, Moralität ist zwar auch an ein Ideal gebunden, doch weiß das Gedicht genau um den ‚Ort‘ des Menschen: „Nach ewigen, ehrnen, / Großen Gesetzen / Müssen wir alle / Unseres Daseins / Kreise vollenden“, der „unfühlend[en] / […] Natur“ und dem „Glück“ ausgeliefert. Nur in diesen engen, innerweltlichen ‚Grenzen‘ kann der Mensch versuchen, ein „Vorbild / Jener geahndeten Wesen“ zu sein.4 Wenn AdornoAdorno, Theodor W. an Goethes Humanitätsdrama Iphigenie auf Tauris mit Blick auf die Taurer bemängelt, dass „[d]ie Opfer des zivilisatorischen Prozesses, die, welche er herabdrückt und welche die Zeche der Zivilisation zu bezahlen haben, […] um deren Früchte geprellt worden [sind], gefangen im vorzivilisatorischen Zustand“, dann verweist er auf eine Diskrepanz zwischen dem Anspruch des Humanitätsideals und seiner Anwendbarkeit auf die soziohistorische Realität;5 wenn nun Goethe, wenn auch unter anderen Vorzeichen, gegenüber Schillers ästhetischem Erziehungsprojekt ähnliche Vorbehalte hat, dass nämlich Humanität und Menschenwürde als utopische Ideale, reine Abstraktionen oder gedankliche Konstruktionen nur schwer in die Realität zu transponieren sind, entbehrt dies nicht einer gewissen Ironie. Und doch ist diese Konstellation bezeichnend und in einem doppelten Sinne entscheidend für die Bewertung der Menschenwürde in der Zeit der Weimarer Klassik. Ist sie ein ästhetisches Problem in dem Sinne, dass sie durch die Kunst und die Literatur hervorzubringen oder zu fördern ist, stellt sich die Frage nach ihrer konkreten literarischen Inszenierung – etwa durch ‚lebensechte‘ Figuren, die eben nicht nur reine Ideenträger sind wie Iphigenie. Ist Menschenwürde insofern ein ästhetisches Problem, als sie überhaupt nur in der und durch die Kunst denkbar ist, etwa weil es dem Theoretiker (Schiller, MoritzMoritz, Karl Philipp) primär um die Kunst an sich, ihren Rang und ihre Apologie geht, dann rückt die Frage nach Praktikabilität und Relevanz der Menschenwürde in der ‚Wirklichkeit‘ in den Hintergrund. Diese Aporien des klassischen Humanitäts- und Menschenwürdediskurses gewinnen vor der Folie der noch zu untersuchenden Texte KotzebuesKotzebue, August von und v.a. BüchnersBüchner, Georg umso schärfere Gestalt.
*
Zwei Forschungsstimmen zielen pointiert auf den Begriff der Menschenwürde ab; sie nehmen die angedeuteten Aporien in den Blick und zeigen Ansätze ihrer Überwindung auf. Michael Hofmann beschreibt, wie GoetheGoethe, Johann Wolfgang und SchillerSchiller, Friedrich gegen Ende der Weimarer Klassik das „Humanitäts-HumanitätParadigma“ erneuern – indem sie den Menschenwürdebegriff ausweiten:
Ein wesentliches Problem des konventionellen Humanitäts-HumanitätDenkens erkennen SchillerSchiller, Friedrich und GoetheGoethe, Johann Wolfgang […] in der Unterordnung des Einzelnen unter Allgemeines, unter eine teleologisch verstandene Entwicklung der Menschheit oder unter ein objektivistisch verstandenes Ganzes der Natur. Die Würde des einzelnen Menschen wurde in der Aufklärung und in den Humanitäts-Entwürfen der frühen Weimarer Klassik als Teilhabe an dem Prozess der ‚Erziehung des Menschengeschlechts‘ oder in seiner Integration in ein sinnvoll geordnetes Naturganzes gesehen.6
In ihrem Spätwerk entwickelten die Weimarer Dioskuren dagegen einen integrativen Menschenwürdebegriff, der auf vier „Aporien der ‚HumanitätHumanität‘“ reagiere: die „Aporie eines ‚Despotismus der FreiheitFreiheit‘“, der den einzelnen Menschen einer übergeordneten Idee opfere; die „Aporie der ‚schönen Seele‘“, die die Frau gleichzeitig idealisiert und reduziert; die „Aporie des ausgeschlossenen Barbaren“; schließlich die „Aporie einer Ästhetik des ausgeschlossenen Verdrängten“.7 Korrigierende Tendenzen sieht Hofmann im Faust, in der Jungfrau von Orleans, im West-Östlichen Divan bzw. in der Nänie: „Was vom Humanitäts-Denken bleibt und was stärker gemacht wird als vorher, ist der Gedanke der Menschenwürde, der in einem neuen Sinne universalisiert wird, indem er auch gegenüber dem Fremden, Bedrohlichen geöffnet wird.“8 Freilich sollte man von einer Universalisierung in Ansätzen sprechen, die alles andere als radikal ist, zumindest aber ein Bewusstsein für die Inkommensurabilität von Würdeideal und politisch-sozialer Realität zeigt.
Thomas Weitin interpretiert GoethesGoethe, Johann Wolfgang Faust als Schlüsseldokument des Menschenwürdediskurses, als „Gründungstext[], der für die Selbstbehauptung der Menschenwürde am Beginn der normativen Moderne ausschlaggebend ist“.9 Fausts Ausspruch während des Osterspaziergangs: „Hier bin ich Mensch, hier darf ichʼs sein“ deutet Weitin als performativen Sprechakt, als „Selbstbeobachtung eines seiner Menschlichkeit gewahr werdenden Subjekts, das sich als solches erkennt, benennt und in der sprachlichen Bezugnahme auf sich augenblicklich aufersteht“ und somit „die Menschenwürde hervorbringt“.10 Für Weitins Lektüre sind die Begriffe „Selbstbehauptung“, „Selbstschöpfung“ und „Selbstgesetzgebung“ zentral; gleichwohl sieht er Faust mitnichten als Sympathie weckende „Ideal-Figur“.11 Ebenso wenig kann Menschenwürde in Weitins Argumentation dramatisiert, d.h. durch eine Figur verkörpert werden:
Die universelle Würde hat nichts Repräsentatives, keine ästhetische Anmut, sie tritt nicht auf und ‚ist‘ überhaupt nur für den, der sie, wie Faust im Osterspaziergang, beobachtet. Die Menschenwürde ist eine Konstruktion menschlicher Selbstbezüglichkeit, deren Universalität daher rührt, dass sie jedem auf die gleiche Weise möglich ist und möglich sein soll. Sie kommt ohne Unterschied jedem zu. […] Personale AutonomieAutonomie garantiert sie, weil ihrem Konzept nach im Hier und Jetzt jeder sagen kann: Ich bin ein Mensch. Und weil auch jeder so behandelt werden muss. Das gilt für alle – eben auch für den, der sich so würdelosWürdelosigkeit verhält wie Faust.12
Durch eine „Übertragungsleistung, die die wörtliche Würde, die auftreten muss, zur Metapher der Menschenwürde emanzipiert“, erhalte die Menschenwürde in GoethesGoethe, Johann Wolfgang epochalem Text ihre spezifisch neue Qualität;13 „im Zeichen der absoluten Metapher Menschenwürde“ muss am Ende sogar Faust, „der würdeloseste Mensch, […] dem nichts heilig ist und der seine grausamen Taten nicht einmal bereut, erlöst werden […], wenn die Würde des Menschen unantastbar sein soll“.14 Aus dieser Perspektive erhält der Menschenwürdebegriff im Faust tatsächlich eine signifikante Erweiterung: Nicht nur umfasst er das (moralisch wie ästhetisch) HässlicheHässliche, sondern er wird auf eine geradezu moderne Art und Weise universalisiert: Menschenwürde als das, „was noch das Menschsein des letzten Menschen ausmacht“.15 Radikalisiert und ästhetisch-literarisch innovativ gestaltet wird dieser Gedanke freilich erst bei BüchnerBüchner, Georg oder den Naturalisten.
III. „Sage mir Bruder, hältst du deine Sklaven für Menschen?“ – Die Menschenwürde in August von KotzebuesKotzebue, August von Die Negersklaven (1794)
In seiner „affirmativen Genealogie der MenschenrechteMenschenrechte“ beleuchtet Hans Joas, wie sich aus der Erfahrung von GewaltGewalt und MenschenwürdeverletzungenMenschenwürdeverletzung rechtliche Normen entwickeln. Die Antisklavereibewegung, stark religiös geprägt und im 18. Jahrhundert vor allem in Großbritannien virulent, beschreibt er dabei als „Modell einer moralischen Mobilisierung“. Als einen entscheidenden Faktor für den Erfolg der Bewegung nennt Joas „die Herstellung einer globalen Öffentlichkeit, die es möglich machte, Verstöße gegen die Menschenwürde zu skandalisieren“.1 Das Theater und der literarische Diskurs bilden eine Form der bürgerlichen Öffentlichkeit, die, folgt man Habermas, die Grundlage der politischen darstellt, dieser also gewissermaßen vorausgeht;2 zumindest aber eröffnen Literatur und Theater einen Raum, in dem moralische Probleme ohne juristische oder politische Festlegungen mit genuin künstlerischenKunst, Künstler Mitteln verhandelt werden.
Tatsächlich erschienen in den Jahren um 1800 auch mehrere deutschsprachige Dramen, die das Thema der Sklaverei aufgriffen.3 Dieses erlaubte den Dichtern, sowohl die in den Deklarationen der Französischen Revolution kulminierenden Freiheitsideale zu diskutieren als auch aktuelle gesellschaftspolitische Fragestellungen analogisch zu behandeln.4 Neben Karl Freyherr von Reitzenstein, Ernst Lorenz Michael Rathlef, Gustav Hagemann u.a. verfasste auch August von KotzebueKotzebue, August von mehrere Sklavenstücke.5
In seinem „historisch-dramatische[n] Gemaͤhlde“ Die Negersklaven (1794) gestaltet KotzebueKotzebue, August von die Menschenwürde als zentrales Thema.6 Anschaulich und publikumswirksam stellt der Dramatiker die Frage nach der Bedeutung und der Reichweite des Begriffs – auch jenseits des exotischen Themas.7 Im Gegensatz zum vermeintlich elitären und intellektuell fordernden Theater GoethesGoethe, Johann Wolfgang und SchillersSchiller, Friedrich weiß der „Volksdichter“ und „Theaterpraktiker“ genau,8 was dem gemeinen Zuschauer tatsächlich zuzumuten ist – sowohl auf der Ebene der Reflexion und der Interpretation als auch auf der Ebene der Darstellung.
Die Grundfrage des Stückes ist recht einfach: Sind Sklaven Menschen, die eine zu achtende Würde haben? Diese Position vertritt der aufgeklärte, in Europa geschulte William, der auf Jamaika mit den Gräueln der Sklaverei konfrontiert wird. Oder sind die „Negersklaven“, wie es sein Bruder, der grausame Plantagenbesitzer John, behauptet, eher TiereTier, Vertierlichung, Theriomorphisierung oder Waren, die weder Würde noch Rechte besitzen? Dieser dramatische Konflikt – hier prallen zwei Weltsichten und vor allem Menschenbilder aufeinander, die zumindest subjektiv gleichwertig erscheinen9 – ist der Ausgangspunkt für einen Plot, der zum einen konventionelle Erwartungen des Publikums erfüllt und handlungsreich, spannend, bunt, bisweilen schockierend, aber auch hochpathetisch und rührselig ist, zum anderen jedoch immer wieder die Aufmerksamkeit des Rezipienten auf den Begriff der Menschenwürde und seine anthropologischen, ethischen, theologischen und juristischen Implikationen lenkt. Der horazischen Maxime folgend versucht das Stück, das delectare und das prodesse massentauglich zu verbinden.
III.1. Bemerkungen zu Vorbericht und Quellen
Im Vorbericht stimmt KotzebueKotzebue, August von „Leser, Zuschauer und Recensenten“ auf das zu Erwartende ein. Sein Text sei „nicht blos“ ein „Schauspiel“, sondern „bestimmt, alle die fuͤrchterlichen Grausamkeiten, welche man sich gegen unsre schwarzen Bruͤder erlaubt, in einer einzigen Gruppe darzustellen“.1 Kotzebue verspricht mehr als bloße illusionistische Unterhaltung; er erhebt – wie bereits die Gattungsbezeichnung suggeriert – nicht nur Anspruch auf historische Genauigkeit, sondern auch auf außerliterarische Relevanz. Das programmatische Substantiv „Bruͤder“ nimmt die Aussage des Stückes vorweg: Die schwarzen Sklaven gehören, im Sinne der revolutionären Maxime der fraternité, gleichberechtigt zur Menschheitsfamilie. Versklavung und menschenunwürdige Behandlung sind somit verwerflich; sie werden zum ästhetischen Stimulans, zum Anlass der literarischen Produktion.
„[L]eider“ gebe es, so KotzebueKotzebue, August von, „keine einzige Thatsache in diesem Stuͤcke […], die nicht buchstaͤblich wahr waͤre“ (NS 4).2 Dieses Berufen auf ein striktes Wahrheitspostulat rechtfertigt implizit die dramatische Darstellung von vermeintlich Anstößigem, Unästhetischem oder Undarstellbarem, mithin von Vorgängen, die den aufklärerischen Regelpoetikern als mit der Würde des Menschen unvereinbare Grenzüberschreitungen oder Tabubrüche gegolten hätten. Auf der Bühne werden Menschen geschlagen und misshandelt, ein totes Kind wird gezeigt, Trauriges und Grausames mit großem Pathos beweint und beklagt, Emotionen werden ungeniert ausgedrückt.3 Zwischen Wirkintention und darstellungsästhetischen Überlegungen besteht jedoch ein direkter Zusammenhang; gerade eklatante VerletzungenMenschenwürdeverletzung der Menschenwürde setzt Kotzebue bewusst und mit wirkästhetischen Hintergedanken ein.
Am Ende der Vorrede macht KotzebueKotzebue, August von dann eine signifikante Einschränkung:
Da viele Zuͤge in diesem Schauspiele allzugraͤßlich sind, so ist bey der Auffuͤhrung manches weggelassen worden. Das mag fuͤr die Bühne gelten; im Druck aber sah sich der Verfasser genoͤthigt, alles Weggelassene wieder herzustellen, wenn seine Arbeit anders den Titel eines historischen Gemaͤhldes verdienen sollte. (NS 6–7; m. H.)
Die Bewertung von potentiell Tabuisiertem ist demnach vom literarischen Medium abhängig: Auf der Bühne, in der dramatischen Darstellung, ist weniger ‚erlaubt‘ als im Druck, der die Wirkung gewissermaßen abmildert. Hier gibt es – das verlangt das Postulat der historischen Wahrheit – keinen Grund mehr, aus Rücksicht auf das Publikum bestimmte Details oder Szenen wegzulassen oder zu verharmlosen.
Zudem nennt KotzebueKotzebue, August von die Quellen, die ihm „den Stoff geliefert“ haben (NS 3).4 Nicht als Quelle erwähnt, im Laufe des Stückes von Namensvetter William aber mehrmals als Gewährsmann und Hoffnungsträger genannt (NS 55 und 65) wird William WilberforceWilberforce, William, der sich u.a. im Mai 1789 im britischen House of Commons für die Abschaffung der Sklaverei aussprach; seine Rede muss Kotzebue gekannt haben.5 Die Figur William, gleichsam der HeldHeld des Dramas,6 dient als fiktionales Sprachrohr des historischen Wilberforce, den „sein edles Herz zum Redner der Menschheit aufforderte“ (NS 55) und „der euch [i.e. die Sklaven; MG] liebt; der Tag und Nacht auf eure Befreyung sinnt, und von der schoͤnen Glut der Menschenliebe erwaͤrmt, mit feuriger Beredsamkeit eure Rechte vertritt“ (NS 65). Am historischen Wilberforce lobt William zwei Eigenschaften: seine rhetorischen Fähigkeiten und seine humanitas, sein argumentatives und sein emotionales Engagement für die Sache der Sklaven. Ebendiese beiden Strategien verfolgt auch Kotzebues Drama.
III.2. Die diskursive Begründung der Menschenwürde in Dialogen der Figuren William und John
Nachdem in den ersten beiden Szenen des ersten Aktes ausschließlich Sklavenfiguren zu Wort kommen, die expositorisch von ihrem Leid und von dem sich anbahnenden Konflikt um Johns Liebe für die Sklavin Ada berichten, deren Herz jedoch dem in Afrika zurückgelassenen Gatten Zameo gehört, werden die ungleichen Brüder William und John eingeführt. In zwei Dialogen (in den Szenen I,3 und I,6) stehen sich die beiden in einem ‚ideologischen Duell‘ gegenüber. Diese Dialoge muten wie eine argumentative Exposition an, fügen sie der eigentlichen Handlung um die Sklaven doch einen interpretatorischen, theoretischen Rahmen hinzu: William und John entfalten zwei entgegengesetzte Ansichten über das Wesen und den Status der Sklaven und stecken somit den begrifflichen Rahmen ab, innerhalb dessen sich die Wahrnehmung und Bewertung der Sklaven durch die Rezipienten bewegen soll.
Vorbereitet wird die Schlüsselszene I,6 durch einen kurzen Wortwechsel in Szene I,3:
John. (im Gespraͤch begriffen) Nein Bruder, das verstehst du nicht. Ich habe den CiceroCicero, Marcus Tullius nie gelesen; aber wenn ich, statt Hunger und Peitsche, mir einen Redner halten wollte, der die Sklaven an ihre Pflichten erinnerte –
William. (zwischen den Zaͤhnen murmelnd) Haben Sklaven auch Pflichten?
John. Thut der englische Bauer recht, wenn er seinen Ochsen vor den Pflug spannt, und die Peitsche uͤber ihm schwingt?
William. Ein herrliches Gleichniß. (NS 17–18)
In den Augen des Plantagenbesitzers sind Sklaven TiereTier, Vertierlichung, Theriomorphisierung; Zweck ihres Daseins ist, für ihren Besitzer zu arbeiten. William weist sarkastisch auf den argumentativen Fehler seines Bruders hin: John spricht von den „Pflichten“ der Sklaven, dabei ist die Pflicht weniger eine ontische Kategorie als eine Zuschreibung, die auf bestimmten Voraussetzungen beruht. Ironischerweise bezieht sich John selbst in seiner Rede auf CiceroCicero, Marcus Tullius; dieser grenzt in seiner Schrift De officiis (dt. „Von den Pflichten“ oder freier „Vom rechten Handeln“), die gemeinhin als Beginn der Begriffsgeschichte der (Menschen-)Würde betrachtet wird,1 den Menschen gerade wegen seiner Fähigkeit, richtig und pflichtgemäß zu handeln, vom Tier ab.2 Wenn John also den Sklaven Pflichten, auch im Sinne moralischer Verpflichtungen, zuschreiben will, muss er ihren Status als Menschen, die Würde und Rechte besitzen, anerkennen – was er nicht tut, vergleicht er doch unmittelbar danach den Sklaven mit einem Ochsen. Die Regieanweisung („zwischen den Zaͤhnen murmelnd“) beschreibt nicht nur Williams eigene Gemütslage, sondern suggeriert dem Publikum, dass Johns Position und ihre Legitimation zumindest problematisch sind. Noch wird die Rechtfertigung der Sklaverei nicht direkt negiert; William belässt es bei einem sarkastischen Kommentar („Ein herrliches Gleichniß“).
In Szene I,6 verteidigt William explizit die Menschenwürde der Sklaven und prangert ihre menschenunwürdige Behandlung an. Der Dialog zwischen den Brüdern wird zum veritablen ‚Rededuell‘, das die jeweiligen Positionen profiliert. William entfaltet seine Auffassung von der Menschenwürde nicht monologartig, sondern greift mit verschiedenen Argumenten und Einwürfen seinen Gegenspieler John an. Die Figuren arbeiten einen Gedanken nach dem anderen, ein Argument nach dem anderen regelrecht ab. KotzebueKotzebue, August von wollte offenbar sicherstellen, dass die Rezipienten den Gedankengängen folgen können – nicht nur die Leser des gedruckten Textes, sondern auch die Zuschauer im Theater, die die kognitive Verarbeitung des Gehörten in kürzerer Zeit leisten müssen.
John plagt kein schlechtes Gewissen; an die Schreie der misshandelten Sklaven hat er sich längst gewöhnt. Schockiert ruft sein Bruder aus: „[K]ann nur der Mensch allein sich an Alles gewoͤhnen, und von Allem entwoͤhnen, sogar von der Menschheit!“ (NS 33). Im 18. und 19. Jahrhundert meint das Lexem „Menschheit“ das, was den Menschen als Menschen ausmacht.3 Bei KantKant, Immanuel besteht sogar ein direkter Zusammenhang zwischen „Menschheit“ und Würde: „Die Menschheit selbst ist eine Würde […]“.4 Wenn sich John in Williams Augen von der Menschheit entwöhnt hat, hat dies eine doppelte Bedeutung: John sieht in den Sklaven keine Menschen (mehr) – vermutlich hat er es nie getan. Vor allem aber äußert sich in seinem Umgang mit den Sklaven ein vollkommenes Fehlen von Menschlichkeit, von AchtungAchtung vor dem Gegenüber – denn diese setzen die Anerkennung des Anderen als Menschen voraus. Insofern er diese vermissen lässt, kompromittiert er seine eigene Menschenwürde.