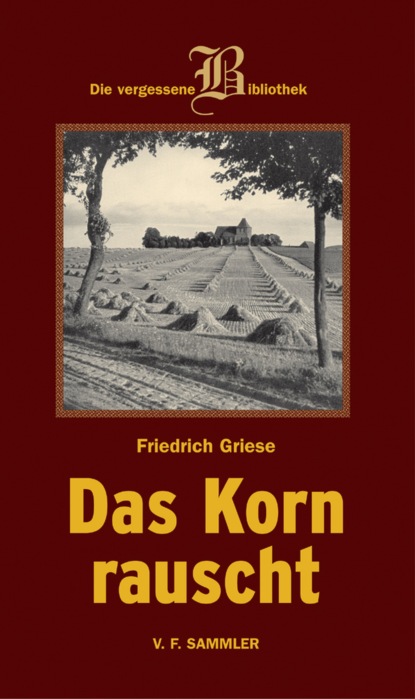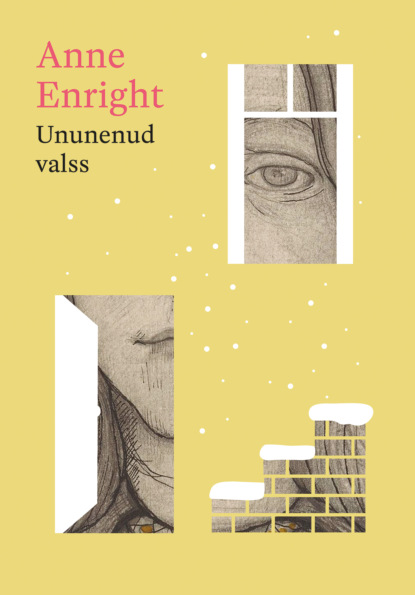- -
- 100%
- +
Und es kam die Stunde, die jeder erwartete. Aber sie kam anders, als alle gedacht hatten. Sie zeigte, daß das Gewissen Hans Schneiders rein und gut war. Und sie befreite ihn von dem sonderbaren Müssen.
Es war eine jener Stunden, in denen Gott über eines seiner Geschöpfe, die sich Menschen nennen, wieder einmal lächeln mußte.
Es stand ein Wetter über dem Hof; eins von jener Sorte, die wie eingeklemmt stehen und immer lauter heulen und immer schneller das Feuer vom Himmel werfen.
Marie Schneider las laut und langsam den „Gesang in besonderen Nöten“; den, der um Hilfe im Gewitter fleht, hatte sie schon zweimal und mit gefalteten Händen gelesen. Die Mädchen sahen mit angstvollen Gesichtern nach draußen, wo eben der Regen hernieder zu prasseln begann, und atmeten hörbarer; denn wenn der Regen kommt, ist das schlimmste Wetter vorüber. Der Bauer lag im Bett und rauchte kalt.
Da fuhr noch einmal ein Blitz herab. Er fuhr durch den Schornstein in den Kamin, von ihm in die Stube. Er schlug die Pfeife Hans Schneiders, die der schon an den Bettpfosten gestellt hatte, weil er aufstehen wollte, in Stücke. Und er fuhr darauf durch die Tür nach draußen.
War das nun etwas Großes?
Oder ging daraufhin etwas Gewaltiges vor sich?
Hatte Gott gesprochen, und wußten die Menschen nun, was er an Hans Schneider gestraft hatte?
Alles, außer der Pfeife Hans Schneiders, war, wie es vorher auch gewesen war. Marie Schneider und den Mädchen saß zwar das heiße Entsetzen in der Kehle. Der Bauer aber lag noch einen Atemzug oder zwei; dann stand er langsam aus dem Bett auf, suchte die zerscherbte Pfeife zusammen und ging damit nach draußen. Das war alles. Und es wurde nichts gesprochen.
Seit der Zeit ging Hans Schneider nicht wieder ins Bett, wenn am Tag ein Wetter da war. Und wenn in der Nacht eins aufkam, stand er auf, wie alle anderen auch. Er sah nach den Tieren im Stalle, koppelte die Pferde los, kettete die Kühe ab, sah nach Türen und Fenstern und hatte bei alledem eine leichte und heilsame Sorgenangst um seinen Hof. Aber er kannte nicht mehr das besondere Müssen, das ihn früher im Wetter ins Bett und dort die Pfeife kalt zwischen die Zähne zwang.
Allmählich sprach es sich im Dorfe herum.
Die Leute sahen sich an und fragten einander, wie die Leute fragten, die zur Zeit Zachariäs lebten und von dem Wunder hörten, das an ihm geschehen war: „Was dünket dich um Hans Schneider?“
Die Frage ging nicht lang herum, bis die Antwort kam. Und die lautete: „Hans Schneider hatte den Zwang.“
Gott aber lächelte.

Und wie war es mit Johann Reimer?
Oh, es gibt Geschichten von diesen Menschen, die von Gott mit einem solchen unfreien Inwendigen geschlagen waren, Geschichten, die heute selten noch der oder dieser kennt; und der sie kennt, müht sich, sie zu vergessen, weil sie seinen inwendigen Menschen als tagfremdes Gut belasten.
Johann Reimer gehörte zu den Stillen, denen eine Erkenntnis ewiger Dinge geworden ist und die unter dieser Erkenntnis wie unter einem schweren Joch schreiten, weil sie sie nicht weitergeben können. Denn wer von diesen Menschen sprach je von den Geheimnissen, die ihm gegeben wurden? Sie schwiegen, schwiegen bis in den Tod, ohne ein kleines Wort preisgegeben zu haben. Ihnen war gegeben zu wissen; aber ihnen war nicht gegeben, ihre Gotteswissenschaft den Menschen ausdeuten zu können.
Jede Johannisnacht trieb es Johann Reimer an den Kreuzweg, der mitten im Wald unter Haselgebüsch, Birken und hohen Fuhren stand. Um Dunkelwerden ging er aus dem Haus und ging seinen Weg still und unverdrossen. „Es ist wieder soweit“, mit diesen Worten ging er über die Schwelle. Er wäre lieber geblieben, aber er mußte gehen. Man fragte ihn nicht nach seinem Willen; er hatte seine Sendung. Was trieb ihn? Wer sandte ihn? Nun, Johann Reimer liegt schon lange auf dem kleinen Friedhof gleich linker Hand hinter der Pforte, er kann auch heute noch nicht davon sprechen. Vielleicht wird ein späteres Geschlecht alles von ihm erfahren.
Er saß unter dem Kreuzweg, bis die Mitternacht langsam von den hohen Wipfeln herabglitt. Dann war die Waldstille in einem Atemzug verwandelt. Die Luft war voll von Schreien, Fluchen, Weinen, Bitten, Singen, Lallen. Er sah nichts; aber er hörte den Zug eines Heeres, das vom Osten kam und gen Westen ging, das an ihm vorüberflog, lief, keuchte, trabte, schritt, schleifte, tanzte.
Bis dann in einem Atemzug wieder Stille ward. Dann mußte Johann Reimer seine Augen heben, und dann sah er auch. Dann ging an ihm vorüber, wer in diesem Jahr bis zur nächsten Johannisnacht sterben sollte. Es waren stets ein paar von denen, die in dieser Nacht in ihren Häusern zwischen dem Hohen Ende und dem Brink ruhig schliefen und nichts von dem Gang wußten, den sie an Johann Reimer vorüber tun mußten. Sie gingen, als ob sie vom Walde kämen und ins Dorf wollten, und grüßten ihn nicht.
So hatte er Jahr für Jahr am Kreuzweg gesessen und war auch von Jahr zu Jahr stiller geworden. Die Leute im Dorf wußten, was ihn stille machte, und sprachen so von ihm, wie sie auch von Hans Schneider sprachen.
Zuletzt kam aber auch für ihn die Stunde, die ihn löste. In der letzten Johannisnacht, in der es ihn an seinen alten Platz zwang, war es ihm plötzlich, als werde er auf beiden Augen blind. Er sah noch den alten Daniel Behm mit langsamem, leisem, erdentrücktem Schritt an sich vorübergleiten. Dem Pastor hat er es auf dem Totenbett gesagt – Mina Reimer hat es hinter der Tür gehört –, mit ganz klaren und gewissen Worten hat er es gesagt, daß er Daniel Behm plötzlich habe im Schreiten innehalten sehn, daß der sich zu ihm umgedreht und mit einer ganz hellen Stimme diese deutliche Rede zu ihm gesprochen habe: „Nun hast du genug gesehn, Johann Reimer, nun sollst du schauen.“ Und da ist ein plötzliches Dunkel und darauf eine lichte Helle geworden. Und dann hat Johann Reimer sich selber gesehen, wie er in seinem Gottestischrock, das Gesangbuch in der Hand, einen Blumenstrauß in der Linken, den Weg vom Wald ins Dorf gegangen ist. Da wußte er, daß er der letzte von denen sein würde, die in diesem Jahr sterben müßten. Und das war die schönste Stunde seines Lebens. Nun war er frei. Am Morgen erzählte man es sich im Dorf, daß Daniel Behm in der Johannisnacht gestorben sei.
Seine Tochter, Wilhelmine Laartz, geborene Behm, habe an seinem Bette gesessen. Wie die Uhr halb eins gewesen sei, habe er noch einmal die Augen geöffnet und einige Worte gesprochen. Seine Stimme sei ganz hell, aber doch so gewesen, daß sie die Worte nicht habe verstehen können.
In dieser Nacht aber ging Johann Reimer wie ein Freier. Ein altes, frohes und tapferes Kirchenlied singend, so schritt er vom Kreuzweg ins Dorf.
Und dies Jahr wurde das schönste seines Lebens. Die Leute wußten nicht warum.
Er aber wußte es.

Ihr Menschen unserer Tage, scheltet mir nicht die Alten. Sie erlebten das Wunder; denn sie glaubten daran. Wir aber – nun, es ist noch nicht erwiesen, woran wir glauben.
Wenn es am Abend oder in der Nacht an Doris Schröders Fenster: tock – tock! machte, dann wußte sie, daß Hanna Wienk es war, die plötzlich klopfte. Sie zog sich an, ging zu ihr, die im Armeleutekaten rechter Hand vom Teich wohnte, und blieb eine Stunde oder zwei bei ihr. Hanna Wienk saß dann am Tisch, einen Korb am Arm, das große, blaugewürfelte Tuch umgeschlagen wie eine, die eine Reise machen oder für immer fortgehen will. Sie hatte das auch gewollt. Sie war wirklich auf dem Wege gewesen. Und sie hatte dann doch wie stets den Weg an Doris Schröders Fenster vorüber genommen, hatte – obwohl ihr das innerlich widerstrebte – den Finger krumm gemacht und hatte damit an der kleinen, runden Scheibe: tock – tock! gemacht. Und darauf war es wie eine Erleuchtung über sie gekommen, sie hatte plötzlich gewußt, wer und wo sie sei und wohin sie in dieser Nachtstunde gehöre, und war wieder umgekehrt, saß nun und erwartete Doris Schröder.
Die aber stand vor ihr am Tisch und schalt und sagte ihr in lauter Sprüchen aus Hiob und Weisheit Salomonis, was über solche Torheit gesagt werden mußte. –
Hanna Wienk ging schon als junges Mädchen mit ganz tiefen Augen, in denen verhaltene Lichter brannten, unter den Menschen. Der, den man zwischen dem Hohen Ende und dem Brink nur mit einem guten und starken Spruch zusammen nennt, folgte ihr in allen ersten Vollmondnächten, wohin sie auch ging.
Als sie ihn das erste Mal sah, da saß er am Wasserloch hinter dem Brink. Er saß auf einem alten Weidenstubben; die Beine steckten in gelben Stulpenstiefeln; er rauchte auf einem Ende eines Hirschgehörns. Dürr und mit krummem Rücken, aber mit grinsendem Gesicht saß er da. Seinen Leib hatte er frech hingespreizt, so daß Hanna Wienk sich die Augen bedecken mußte; und er sagte zu ihr: „Schlage mich, ich schlage dich wieder.“
Und mit diesem Spruch verfolgte er sie dann ihr ganzes Leben lang. Denn sie blieb unbegeben, unverheiratet, und keiner weiß, wie es gekommen wäre, wenn sie einen Mann und vielleicht ein paar Kinder gehabt hätte. So aber mußte sie alles allein abmachen.
Oft, wenn Hanna Wienk gar nicht an ihn dachte, stand er plötzlich neben ihr: auf der Wiese beim Heuen, am Brink auf der Bleiche, in der Stube beim Stricken; ja, er stand wohl plötzlich im Garten, wenn sie Kartoffeln aufgrub, auf dem Bülten, auf der Kartoffelstaude, klatschte auf seinen Leib und sagte: „Schlage mich, ich schlage dich wieder.“ Durch diese ewige Plage bekam Hanna Wienk irre Augen und ein Gesicht, das zuweilen häßlich war. Wie hätte es auch anders sein können? Alle auf dem Dorfe wußten, woran sie litt, und verstanden sie.
Zuweilen meinte sie, ihr bliebe nur ein Sprung in ein tiefes Wasser, und danach müsse es gut sein. Sie band ihr Umschlagetuch um den Kopf und ging auf die Straße. Aber wenn sie dann an Doris Schröders Fenster vorbeiging, konnte sie doch nicht weiter. Das lag eigentlich nicht an Doris. Alle im Dorfe wußten es, und Mina Wreth erzählte es zuweilen – nur Doris selbst sprach nie darüber –, daß Hanna Wienk Heinrich Schröder sehr geliebt habe, als sie beide noch jung gewesen seien. Aber Hanna Wienk habe sich ihm verweigert, als er sie einmal an einem Abend nach einer Tanzmusik nehmen wollte. Und da sei er am selben Abend noch zu Doris Thieß gegangen, und bei der habe er es besser gehabt. Und nun sagte Mina Wreth es ziemlich laut, daß Hanna Wienk eigentlich nach ihm klopfe, wenn sie so sehr von dem andern – „Alle guten Geister loben Gott den Herrn!“ – geplagt würde.
Nun, Mina Wreth sagt manches. Heinrich Schröder hat damals jedenfalls Doris Thieß geheiratet. Und wenn seine Doris nun an solchen Abenden zu Hanna Wienk geht, dann tut sie es ganz gewiß deshalb, weil ihr Heinrich es gern sieht, wenn sie an der armen Hanna ein gutes Werk tut; aber er schläft, wenn sie geht, und er schläft ganz gewiß auch noch, wenn sie zurückkommt. Dafür nimmt Doris dann Hiob und den König Salomo mit; und das sind gute Nothelfer.
Die Leute im Dorf sagten: „Hanna Wienk hat den Zwang.“ Und sie begriffen nicht, warum sie den andern – „Alle guten Geister“ – nicht schlage, wenn er sie doch zum Schlagen auffordere.
Einmal aber muß die Stunde gekommen sein, in der Hanna Wienk es nicht mehr zu tragen vermochte. Es war ganz helle Mondnacht, in der das folgende geschah: Doris Schröder hörte unter ihrem Fenster einen lauten Schrei, noch einen; und sie sagte es später oft zu ihrem Mann, daß sie auch ganz deutlich von der Stimme wie im größten Jammer seinen Namen, den Namen: Heinrich! Heinrich!, gehört hätte. Heinrich Schröder aber hat zu dieser ihrer Rede nichts gesagt; und sie hat das auch für sich behalten, um Mina Wreth nicht noch mehr Anlaß zu ihren Reden zu geben. In jener Nacht ist sie jedenfalls schnell aufgestanden, hat sich das Nötigste umgeworfen und ist, während ihr Heinrich schlief, schnell nach draußen gegangen. Und da hat sie Hanna Wienk auf der Erde liegend vor ihrer Türe gefunden. Nur ein Hemd hat sie auf dem Leibe gehabt, aber sie ist doch heiß wie von Feuer gewesen. Sie hat sie aufgehoben und in ihre Kate getragen, und dabei hat sie von ihren Lippen ganz deutlich wieder: Heinrich! gehört. Im übrigen redete Hanna Wienk irre und lallte wie ein kleines und hilfloses Kind.
Im Dorf hat man es sich später so erklärt: Hanna Wienk ist in dieser Nacht wieder in einer großen Plage gewesen. Sie hat es nicht aushalten können und ist, so wie sie aus dem Bett aufgesprungen ist, auf die Straße gelaufen. Aber der Verfolger ist bei ihr geblieben; und da hat sie in größter Not wohl einen Stein, einen Stock genommen und hat – „schlage mich, ich schlage dich wieder“ – zugeschlagen. Und daraufhin ist sie niedergefallen.
Hanna Wienk ist nicht wieder gesund geworden. Man fand am nächsten Tage an ihrer linken Schläfe ein kleines Mal wie von einem Fingertupf. Das war das Zeichen. Sie ist einige Monate später an Gesichtskrebs gestorben.
„Sie hat den Zwang“, sagten die Leute und erzählten sich ihre Geschichte so, wie es hier getreu nacherzählt ist. –
Ihr Menschen von heute, ob wir die Geschichte einer Menschenschwester, die unter uns lebt und die leidet, wie Hanna Wienk litt, auch so tief, so richtig und so zart erzählen können, wie die Alten die Geschichte der Hanna Wienk erzählten?

Ihr dürft nicht denken, daß, wenn die Alten erzählten, das ein regelloses, plätscherndes Geplauder gewesen wäre. Die Rede eines Winterabends am grünen Ofen im Zuhause zwischen dem Hohen Ende und dem Brink war voll Kunst und Weisheit aufgebaut. Sie war wie eine Wanderung auf einen Berg. Schwer geht es hinauf; aber wenn man auf dem Gipfel steht, dann sieht man die liebliche Ebene. Ernst war das Gespräch im Anfang, handelte von Krankheiten des Leibes und bitteren Nöten der Seele; aber danach kam Fröhlichkeit auf, kam mit dem breiten Lachen des Genießers oder dem listigen, augenzwinkernden Lächeln des Spötters. Wie arm sind wir doch, daß wir Bücher und Bücher lesen müssen, und werden nicht klug und dürfen nicht einmal, nicht einen Winterabend lang, zuhören einem der alten Erzählermeister.
Denke einmal, du wärest wieder jung, lägst im Schragen neben dem grünen Ofen und hörtest etwa Johann Peters, dem großen Johann Jürn vom Hohen Ende, zu. Der Abend ist dahin. Ernst ist die Rede gewesen, Hanna Wienk hat man ins Grab gelegt: „Es hat dem allmächtigen Gott gefallen, unsere Schwester zu sich zu nehmen von dieser Zeitlichkeit in die Ewigkeit.“
„Ja, so hat der Pastor gesprochen, an diesem Grab wie an jedem. Aber das Wort ‚gefallen‘ bringt mich auf etwas, davon muß an diesem Abend noch berichtet werden. Das gibt einen guten Traum für die Nacht“ – so spricht Johann Jürn. Und seine Rede geht nun von Hans Rohwedder.
Auch Hans Rohwedder hat zu denen gehört, die unter dem Zwang stehen. Aber bei ihm ist es sonderbar gewesen, ein Wort, um das hat er nicht hinweg können. Das Wort hat geheißen: der Fall.
Ob das nun an den vier Buchstaben des Wortes allein gelegen hat? Das wäre schon möglich. Denn dieses Wort ist ein heimtückisches, hinterlistiges, unheilvolles Wort. Der erste Buchstabe ist wie einer, der mit leisem, gutem Wort zuredet und den Menschen an das a wie an ein offenes Wasser zieht; er gibt nach, er steigt hinein, aber plötzlich stecken seine Füße im Morast und Schlamm und Sumpfgrund der beiden ll.
Bei Hans Rohwedder hat sich dieses Wort aber nun noch mit den Weiberleuten verbunden. Und das hat gewiß seinen Grund darin gehabt, daß er von der Schule oder von der Kirche her die Geschichte vom Sündenfall gewußt hat. Und so hat es sich bei Hans Rohwedder festgesetzt, daß es ein Mädchen, ein blondes, rotbackiges Mädchen mit vielen Haaren auf dem Kopfe sein würde, das ihn eines Tages zu Fall brächte.
Also hat Hans Rohwedder sich gehütet.
Also ist er ein Einbäumiger, ein Junggeselle geblieben. Und also kann man sich die Wirtschaft vorstellen, die auf seinem Hofe geherrscht hat.
Weiberwirtschaft allein ist schlimm, aber Männerwirtschaft allein ist gewiß noch viel schlimmer.
Das hat Hans Rohwedder gemerkt, das hat er erfahren, aber das hat ihn nur noch verstockter gemacht. Er hat manchen guten Freund gehabt, der ihm geraten hat: „Hans, wenn du keine Frau willst – Gott mag wissen, warum nicht –, dann nimm dir wenigstens eine Wirtschafterin.“
Aber Hans Rodwedder weiß, warum er keine nimmt. Eine Wirtschafterin, so denkt er, die will bald geheiratet sein. Und dann ist der Fall da. Hüte dich vor dem Fall, Hans.
Und so ist er denn allmählich schon ein bißchen grau, ein bißchen sauertöpfisch und ein bißchen vertrocknet geworden. Aber die Mädchenwirtschaft ist schlimmer als je gewesen. Hans Rohwedder hat seine Stube selbst besorgt. Aber die ist nicht sauber, das Essen nicht gar, der Hof unordentlich gewesen.
Und eines Tages ist wieder ein Freund bei ihm und gibt ihm abermals den Rat: „Hans, ändere deine Wirtschaft.“
Und Hans Rohwedder antwortet ganz verständig: „Ja, es muß anders werden, Klaus.“
„Zum Heiraten ist es wohl zu spät, Hans?“
„Ja, Klaus, zum Heiraten ist es zu spät.“
„Eine Wirtschafterin, Hans? Eine tüchtige?“
„Ja, eine Wirtschafterin, Klaus, eine, die schon in guten Jahren und nicht mehr so springig ist.“
Und so werden Hans und Klaus sich beide einig: Hans will eine Wirtschafterin nehmen. Aber sie muß schon in gesetztem Alter und von verständigem Sinn sein. Blond darf sie nicht sein. Und zuviel Haar soll sie auch nicht auf dem Kopf haben. Denn Hans hat genug Mädchen in seinem Haus gehabt, die sehr viel Krauses auf dem Kopf und viel mehr Krauses darin hatten. Und darunter ist manche gewesen, die Hans Rohwedder heftige Anfechtungen gebracht hat. Aber sie haben es nie gemerkt, und Hans hat es nicht sagen können. Und als er doch einmal in einer Sommernacht vor der Kammertür gestanden und hineingewollt hat, da ist sein Knecht schon darin gewesen.
Das also und jegliche Anfechtung soll vermieden werden. Und weil Hans sich nicht getraut, die Rechte finden zu können, soll Klaus sich auf die Suche begeben; denn Klaus, das weiß Hans, Klaus – nun, Hans lächelt ein kleines und saures Lächeln dazu, Klaus, das ist der Mann zu einem solchen Geschäft.
Nach acht Tagen ist Klaus wieder da. Er hat eine gefunden. Am vierundzwanzigsten Oktober, dem Ziehtag für die Dienstboten, kann sie geholt werden. Er beschreibt sie. Er redet Hans die letzte Angst aus dem Herzen hinaus. Hans wird sie als seine Wirtschafterin annehmen. Hans wird endlich seine Ruhe haben. Und Hans wird sie selber holen.
Am Ziehtag macht Hans Rohwedder den Wagen fertig. Er sieht selber nach allem. Er legt den beiden Braunen das beste Geschirr auf. Er fährt ab.
Nebel liegt auf allen Feldern. Zuweilen kriecht eine ganz erbärmliche und elende Angst zu ihm auf den Wagen.
Drei Stunden muß er fahren. Da ist er in dem Dorf. Klaus hat ihm den Hof genau beschrieben, er findet ihn.
Draußen am Hoftor hält er an, steigt ab, strängt die Pferde los und geht durch die Einfahrt auf den Hof. Als er um die Ecke biegt, steht sie vor ihm. Und Hans fährt zusammen, daß seine Knie einknicken, und er muß denken: Der Fall!
Wahrhaftig: Das ist der Fall!
So steht sie vor ihm: mittelgroß, in den Hüften breit, an den Füßen neue lederne Pantoffeln, eine blaugewürfelte Schürze über blauem Rock. Aus kurzen Ärmeln sehen dicke, kräftige Arme hervor. Die Backen hängen, das Kinn ist dick und kurz, die Wangen zeigen ein braunes Rot. Und die Haare? Nun, sie sind schwarz, sie sind glatt an den Kopf gelegt, und sie sind hinten in einem kleinen und spitzen Knoten zusammengefaßt. So steht sie vor ihm, und so kommt sie auf ihn zu: langsam, sicher, zielstrebig. Und sie sagt: „ Du kommst spät, Hans; ich hab’ schon warten müssen.“
Ja, so ist sie. Sie nennt ihn Du und Hans, und sie sagt, daß er sie hat warten lassen.
Hans Rohwedder, der in seinem Alter allmählich nicht mehr an den Fall hat glauben mögen, sieht, daß er hier vor ihm steht. Er antwortet nichts, dreht um und geht langsam zu seinem Wagen zurück. Er strängt die Pferde wieder an; aber als er von rechts auf den Wagen steigt, setzt sie auf der linken Seite den Fuß ins Rad und sitzt schon, als Hans sich auf dem Strohsitz zurechtrückt.

Weite Landschaft

Mußte es nicht so kommen? Wenn er auch vom Wagen springen und feldein laufen wird, sie wird ruhig weiterfahren und wird ihm dabei nachrufen: „Ich fahr’ schon voraus, Hans.“
Nach drei Stunden, während deren keiner ein Wort gesagt hat, fragt sie ihn und deutet dabei nach vorn: „Ist das unser Hof?“
Und er sagt: „Ja, das ist unser Hof.“
Da nimmt sie ihm die Leine ab, damit er die Hände frei hat: „Nun zeig‘ mir mal ordentlich, was alles unser Acker ist.“
Und er zeigt ihr alles und vergißt sogar den Rabenschlag, das Steinfeld am Waldrande, dabei nicht.
„Du bist vorhin schnell wieder umgekehrt, Hans“, sagt sie nun.
Er nickt; und das soll heißen: ja, das bin ich zwar; aber es hatte keinen Zweck mehr. Du bist der Fall. Es war Vorbestimmung. Ich hab’s gewußt. Und nun, da ich es halb nicht mehr glaubte und wußte, nun kamst du. Und so mußtest du aussehen, so mußtest du sein; es ging gar nicht anders. Wenn ich an die blonden Krausköpfe dachte, war ich auf falscher Fährte.
„Meine Kommode ist dageblieben. Wir müssen sie holen. Wir fahren in ein paar Wochen beide. Wir fahren dann gleich beim Pastor vor und bestellen das Aufgebot.“
Und Hans nickt.
So fahren sie auf den Hof.
BESUCH AM ABEND
Nah über ihnen schweben die Schatten, und niedrig hangen die Früchte nieder.
(Spruch aus dem Koran)
„Hans, sett den Kasten trecht, Jörn kümmt all üm de Eck“, sagte die alte Ursch Harder zu ihrem Manne, der am Ofen saß und rauchte.
Dort, wo der Fahrweg auf Niemanns Hof geht, stehen Heinrich Topp und Wilhelm Lorenz. Sie sehen Jürgen Helwig mit langen, steifen Schritten um die Ecke biegen auf Hans Harders Hofstelle zu und lachen.
„Paß auf, nu kommt der dritte von den Adebars auch gleich“, sagt Wilhelm Lorenz. Und sie haben recht. Denn als eben Jörn Helwig in der Tür verschwunden ist, kommt Johann Peters und geht auch auf Hans Harders Hof.
„Nu sind sie alle drei zusammen, die Adebars, nu kann das Klappern losgehn“, lacht Wilhelm Lorenz wieder.
Es muß gesagt werden, daß nicht nur Heinrich Topp und Wilhelm Lorenz über die drei Adebars, wie man sie im Dorf nennt, lachen, sondern daß alle von den Höfen, Bauern und Knechte und vor allem die Weiberleute, ein lustiges Gesicht machen, wenn sie Hans Harder, Jörn Helwig und Johann Peters beieinander sehen. Denn es geht von den Dreien die Sage, daß sie an den Abenden, an denen sie zusammenkommen, auf einem Bein stehen wie die Störche und daß sie alle halbe Stunde den Mund auftun und ja oder nein sagen. Darum nennt man sie die Adebars, so heißen bei uns da oben die Störche. – Heute lebt keiner mehr von ihnen. Wer sie kannte, mag einen Augenblick an sie denken.

„Hans, nu müßt upstahn, Jörn kümmt all aewer den Hof“, sagt Ursch Harder zu ihrem Hans.
Jeden Abend, an dem ihn seine Freunde besuchen, muß die alte Ursch ihren Hans zweimal nötigen, den Tabakskasten zurechtzustellen. Und an jedem Abend muß sie es zuletzt doch selber tun.
Ursch ist kurz und dick und watschelt mit unförmig breiten Hüften wie eine fett genudelte Gans. Und das wird immer schlimmer, je älter sie wird. Sie fließt auseinander wie dünn geratener Brotteig. Und man muß sich wundern, daß die Schürzenbänder nicht reißen. Aber das ist in ihrer Familie von Mutterseite her erblich, und Ursch hat sich nur in den ersten Jahren Sorge darüber gemacht. Jetzt trägt sie ihre Leibesfülle schon lange Jahre, wenn auch mit Beschwerde, so doch ruhig und ergeben. Zuweilen, wenn Hans Harder sich der Zeit erinnert, als er noch zu losen Streichen aufgelegt war, piekst er sie mit spitzem Zeigefinger und lächelt mit trockensaurem Gesicht einen Mundvoll dazu. Aber die alte Ursch haut ihm dann scharf eins auf die knochendürre Hand und sagt – nein, was sie sagt, kann aus verschiedenen Gründen nicht wiederholt werden.