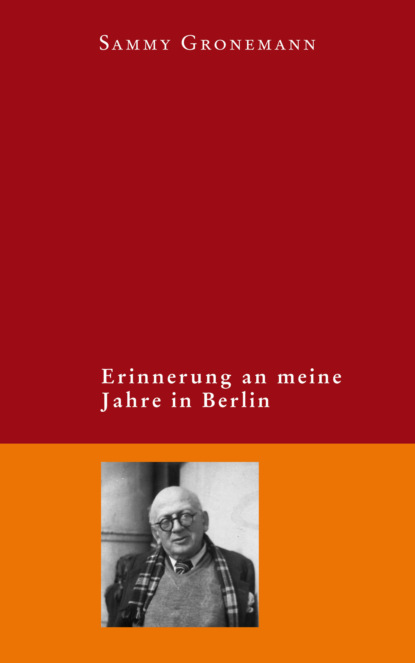- -
- 100%
- +

Sammy Gronemann
Erinnerungen an meine Jahre in Berlin
SAMMY GRONEMANN
ERINNERUNGEN AN MEINE JAHRE
IN BERLIN
Aus dem Nachlaß herausgegeben
von Joachim Schlör
© e-book Ausgabe CEP Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 2014
eISBN 978-3-86393-521-4
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Übersetzung, Vervielfältigung (auch fotomechanisch), der elektronischen Speicherung auf einem Datenträger oder in einer Datenbank, der körperlichen und unkörperlichen Wiedergabe (auch am Bildschirm, auch auf dem Weg der Datenübertragung) vorbehalten.
Informationen zu unserem Verlagsprogramm finden Sie im Internet unter www.europaeische-verlagsanstalt.de
Vorwort
Erinnerungen an meine Jahre in Berlin
Anhang
Nachwort
Abbildungen
Glossar
VORWORT
„Zu den Bekanntschaften, die ich in jener Zeit gemacht habe, kann ich in gewissem Umfange auch die nähere Bekanntschaft mit mir selbst rechnen, soweit man sich überhaupt selbst kennen lernen kann, will man nicht dazu kommen, jede Beziehung mit sich selbst abzubrechen.“
Sammy Gronemann
„Verzeihen Sie, wenn Ihr Buch weit wertvoller ist, als Sie es haben möchten.“
Otto Abeles
Israel Shilony, geboren in Berlin, hat in den siebziger Jahren eine Versammlung im Van-Leer-Institut von Jerusalem besucht und seinen Eindruck so beschrieben: „Ich konnte mich überallhin umschauen und die Gesichter beobachten. Fast alle waren sehr alte Herrschaften (und erst daraus wurde mir klar, daß ich selber so alt bin...), da saßen sie mit ihren schönen, alten, lebenserfahrenen, kultivierten Gesichtern, es war einfach ein aufregender Anblick! Und dann wurde mir bewußt, daß dies das letzte Mal ist, dieses Gesamtbild wunderbarer Köpfe des deutschen Judentums.“ In diesem Augenblick, so Shilony, wurde ihm klar, „daß ein Museum entstehen muß, um das deutsche Judentum im Bild für das Auge festzuhalten“. Weil Nahariya die einzige Stadt der Welt ist, die von deutschen Juden gegründet wurde, sollte das Museum hier seinen Platz finden, inzwischen ist es nach Tefen in den galiläischen Bergen umgezogen.
Januar 2003. Der Vortragssaal im Goethe-Institut von Tel-Aviv ist gut gefüllt. Im Publikum sitzen Menschen, wie sie von Shilony beschrieben wurden: lebenserfahren, gütig, neugierig. Ich stelle den ersten Band von Sammy Gronemanns Erinnerungen (Berlin 2002) vor, eine Mitarbeiterin des Goethe-Instituts liest einige Stücke aus seinem Buch Schalet. Beiträge zur Philosophie des wenn-schon (1927, Neuauflage Leipzig 1998). Zum Abschluß werden von einem Kassettenrecorder drei Lieder aus dem Musical Shlomo ha-melech we Shalmai hasandlar abgespielt, der Text, von Nathan Alterman ins Hebräische übertragen, beruht auf dem Stück Der Weise und der Narr von Sammy Gronemann. Und auf einmal singen und swingen die Zuschauer im Saal mit. Irgend etwas ist es mit diesem Namen, mit der Erinnerung an diesen Mann – wenn man von ihm spricht, geht ein Lächeln über die Gesichter.
Den „Scholem Aleichem der Jeckes“ hat ihn Schalom Ben-Chorin genannt, und seine Witwe, Avital Ben-Chorin, erinnerte sich bei den Veranstaltungen an die Zeit, als sie mit 16, 17 Jahren als Hausmädchen bei Sammy Gronemann und seiner Schwester Elfriede Bergel-Gronemann in Tel-Aviv arbeitete. In solchen Fragmenten tragen wir die Erinnerungen an den Autor, Anwalt und zionistischen Politiker zusammen. Wir brauchen nicht nur Museen, wir wollen wenigstens die Texte der vertriebenen Autoren wieder lesen können. In einem Seminar an der Universität Potsdam haben Studierende des interdisziplinären Studiengangs Jüdische Studien die Erinnerungen gelesen und sich daran gemacht, Quellen zusammenzutragen, die von den Stationen dieses Lebens berichten, damit diese erste deutsche Ausgabe der Erinnerungen auch verstanden werden kann. Die Ergebnisse sind im Nachwort festgehalten. Ich bedanke mich bei allen, die sich an diesem kleinen Ausbruch aus dem universitären Alltag beteiligt haben. Möge es nützen.
Joachim Schlör
ERINNERUNGEN AN MEINE JAHRE
IN BERLIN
I.
Mich zog’s von Abdera nach Athen. Nicht länger wollte ich in Hannover „an der Leine“ angebunden sein. Mich lockte Berlin: „Spree-Athen.“ Ich fürchtete, unter den Philistern entweder einen Windmühlenkampf zu führen oder, was noch schlimmer gewesen wäre, selbst im Sumpfe des Philistertums zu versinken. Hatte ich mich doch nicht völlig dem ständigen „Frosch-Mäuse-Krieg“ entziehen können, der fortwährend innerhalb der Synagogen-Gemeinde geführt wurde. – Ich war ganz gegen meinen Willen in diese Streitigkeiten verwickelt, und wohl oder übel mußte ich mich dem gesellschaftlichen Rhythmus dort anpassen. „Gott soll schützen vor der Provinz“, sagt der alte Jacobi bei Georg Hermann. Das schlimmste aber ist die große Provinzstadt, die sich wer weiß wie großstädtisch vorkommt. Als ob schnurgerade Straßen und höchst korrekt und symmetrisch angelegte Schmuckplätze es ausmachten. Über die Architektur dieses Hannover ließe sich vieles sagen, – aber dazu ist hier nicht die Gelegenheit. Da hatte der Geheimrat Professor Haase von der Technischen Hochschule, der als eine Art Felix Dahnsche Wotangestalt durch die Straßen der Haupt- und Residenzstadt wandelte, einen neuen Stil erfunden, eine Art neuer gotischer Backsteinarchitektur, deren groteske Abscheulichkeit bei jedem Fremden baß Verwunderung erregte und die er mit dem an sich nicht unschönen niedersächsischen Stil zu verschmelzen suchte. Die Hannoveraner freilich waren auf diesen ihren Stil höchst stolz. – Hübsch war der Stadtwald, die Eilenriede, die freilich mehr Parkcharakter hatte und in der die Stadtverwaltung Orgien der Bevormundung und Ordnung feierte. Alle Bänke hatten Inschriften wie „Für Erwachsene“, „Nur für Kinder“, „Nicht für Kindermädchen“. – Doch gab es dort eine Reihe netter Gartenwirtschaften, zu denen man im Sommer schon in aller Frühe hinausfuhr. In meiner Junggesellenzeit radelte ich täglich mit meiner Schwester schon um halb sieben dorthin, um nur nicht jenen – vorsorglich kalendarisch nicht festgelegten – Tag zu versäumen, an dem den Stammgästen gratis Erdbeeren mit Schlagsahne verabfolgt wurden. Dieser Stadtwald lag im Osten der Stadt, anschließend an das vornehme Wohnviertel. Beiläufig bemerkt, ist es wohl die einzige Stadt, in der das Villenviertel im Osten liegt, – sonst gilt ja immer der Westen als vornehm, – warum, ist mir nie aufgegangen. (Vielleicht deshalb, weil man im Westen länger schlafen kann?) – Am andern Ende der Stadt, im Westen, führte die 2 km lange Herrenhäuser-Allee vorbei an dem alten Welfenschloss, umgebaut zur Technischen Hochschule, zum Herrenhäuser Park, dessen langweilige Taxushecken-Anlagen, nach Versailler Muster angelegt, an vergangene Herrscherpracht erinnerten. Gegenüber dem Welfenschloss aber, an der anderen Seite der Allee, lag der Georgen-Garten, eine schöne englische Parkanlage, und dort in der Kaffeewirtschaft trafen sich nachmittags, besonders am Sabbat-Nachmittag, eine Anzahl jüdischer Honorationen. Es war, man denke, eine Wirtschaft mit biblischer Bedienung. Dort servierten freilich nur eisgraue alte Damen den Kaffee. Erfreulicherweise gab es aber in der Stadt auch anders geartete Lokalitäten mit weiblicher Bedienung, in denen eben jene Stützen der Gemeinde zwar gern verkehrten, aber nach Möglichkeit vermieden, sich zu begrüßen oder zu erkennen. Ich freilich machte mir immer ein besonderes Vergnügen daraus, wenn ich etwa im „Bienenkorb“ solche Würdenträger fand, sie mit besonderer Herzlichkeit laut zu begrüßen, was nicht immer mit gleicher Herzlichkeit erwidert wurde.
Sabbat war der Synagogenbesuch unerlässlich, und nachher, zwischen zwölf und eins, setzte die große Besuchsparade ein. Mit langem Gehrock und unvermeidlichem Zylinderhut auf dem Kopf, am Arm die festtäglich gekleidete Frau, wandelte man die Straßen entlang, um die pflichtschuldigen Besuche zu absolvieren. Und es wurde da genau Rechnung geführt. Auch ich und meine Frau konnten uns diesem Brauche nicht entziehen, so stumpfsinnig diese Besuchstouren auch waren. Bis ich dann endlich auf eine erlösende Idee kam: Wir zogen, vorschriftsmäßig adjustiert, los, aber versteckten uns bald in irgendeinem Hauseingang und beobachteten die vorüberziehenden Paare. Wie wir nun ein solches Paar entdeckten, dem wir solchen Besuch „schuldig“ waren, suchten wir schleunigst die betreffende Wohnung auf, um mit dem Ausdruck unseres lebhaften Bedauerns, die Herrschaften nicht getroffen zu haben, unsere Karten abzugeben. So konnten wir uns dann oft an einem Vormittag einer großen Schuldenlast entledigen.
Mir drohten noch andere Gefahren. Ich konnte mich in Hannover nicht den ehrenvollen Anforderungen entziehen, zu allen möglichen Gelegenheiten Carmina oder Festspiele zu machen oder gar den üblichen „Damentoast“ zu halten. Beiläufig will ich einer jetzt wohl entschwundenen Sitte gedenken: Es war zu jener Zeit bei jedem Diner üblich, daß, wenn der Hauptgang, die traditionelle Pute oder Gans, serviert wurde, der bedienende Geist, dem Wink der Hausfrau folgend, den Braten vor den als Opfer ausersehenen Gast hinstellte, und voll schreckhafter Erwartung folgten alle Herren dem Gang des dienstbaren Geistes, bis dann das unglückliche Opfer sich sofort erheben und nun den Übergang von der Gans zum Damentoast finden mußte, wobei es oft schwer war, alle leichten Assoziationen auszuschalten. Und zu solchem Opfer wurde ich immer wieder ausersehen: ich war in Gefahr, so etwas wie ein „Bratenbarde“ zu werden und in unserem Kreise in den Ruf zu kommen wie seinerzeit der demokratische Reichstagsabgeordnete Albert Traeger, mit dem mich übrigens noch eine andere Schicksalsgemeinschaft verband. Er hatte so wie ich eine furchtbare Handschrift, und so kam es, daß einmal das Amtsgericht ihn ersuchte, doch in seiner Unterschrift den Buchstaben „g“ deutlicher zu machen. Darauf sandte er dem Gericht einen großen Bogen voll säuberlich geschriebener „g“s ein mit der Bitte, sich gegebenenfalls zu bedienen. – Etwas Ähnliches war mir einmal geschehen, als das Amtsgericht Niendorf mir wegen unleserlicher Unterschrift einen Antrag zurücksandte. Ich legte dagegen Beschwerde ein und bat gleichzeitig, mir den Namen des unterschreibenden Richters mitzuteilen, den ich nicht entziffern konnte. Meine Beschwerde hatte übrigens Erfolg, und auf drei Folioseiten hat das übergeordnete Landgericht auseinandergesetzt, daß anhand des beigedruckten Stempels es nicht schwierig gewesen wäre, meinen Namen zu entziffern, wobei mit preußischer Gründlichkeit jedem einzelnen Strich meiner kalligraphischen Handschrift nachgegangen wurde.
Besonders viel herangezogen wurde ich zu Vereinsfestlichkeiten. Da gab es einen von meiner Mutter ins Leben gerufenen „Verein ehemaliger Religionsschülerinnen“ (das männliche Pendant wurde allgemein „Verein ehemaliger Tefillinleger“ genannt), einen jüdischen Kegelklub und jenen von mir schon erwähnten von Mendel Zuckermann geleiteten „Verein zur Förderung jüdischen Wissens“, – und so gern ich mich auf dem Pegasus tummelte, machte mir diese equestrisch poetische Übung wenig Spaß. Etwas ganz anderes war es, wenn ich in Berlin für die Zionistische Vereinigung oder den Turnverein Bar-Kochba später heitere Stücke schreiben konnte.
Also: Ich beschloss, Hannover den Rücken zu kehren und nach Berlin zu übersiedeln, zumal Alfred Klee, der vor dem Staatsexamen stand, drängte, mich mit ihm zu assoziieren. Übrigens gravitierte schon damals meine Praxis immer mehr nach Berlin, und nicht selten hatte ich vor einem dortigen Gericht zu tun. So geschah es einmal, als ich in einer an sich unbedeutenden Sache eine Verteidigung wegen Verletzung des Briefgeheimnisses führte, als ich eine bezeichnende Episode erlebte: Gerade damals war der imposante neue Justizpalast in Moabit eröffnet, und als ich den blitzblau, „in Neuheit funkelnden Verhandlungssaal“ betrat, steuerte ein sehr liebenswürdiger junger Kollege auf mich zu, um mir mitzuteilen, die Anordnung der Sitze für die Verteidiger, nämlich Klappsitze angeschlossen an die Anklagebank, hielten die Berliner Kollegen für standesunwürdig, und als Zeichen des Protestes setzten sie sich auf herbeigeschaffte Stühle. Er bat mich, mich dieser Demonstration anzuschließen. Dieser mein freundlicher Mentor war niemand anders als Karl Liebknecht, und es ist für mich eine amüsante Erinnerung, daß ich ihn, mit dem ich später öfter zu tun bekam, bei solcher Gelegenheit kennen lernte, bei dem noch harmlosen Kampf gegen die Mächtigen der Erde.
Bevor ich aber nun meinen Beschluss ausführte, konnte ich meine Hannoverschen Juden noch sehr damit ärgern, daß ein zionistischer Delegiertentag dort arrangiert wurde. Die Tagung war an sich nicht bedeutungsvoll, aber immerhin reichte die Tatsache, daß dort das nationale jüdische Banner erhoben wurde, aus, um die hannoverschen Juden gehörig zu ärgern. Und es erschienen dann in hannoverschen Zeitungen, besonders im „Hannoverschen Kurier“, erboste Zuschriften, worin versichert wurde, daß der Zionismus in Hannover nie Wurzel schlagen würde. Hierbei will ich etwas nachholen: Bei allen Kongressen, die ich besuchte, hatte ich für hannoversche Zeitungen die Berichterstattung übernommen, und meine Berichte gelangten auch im wesentlichen unverstümmelt zum Abdruck. Nachträglich kam dann immer eine nichts weniger als wohlwollende Kritik der Kongresse. Auf jenem hannoverschen Delegiertentag von 1906 hatte Dr. Hans Mühsam einen damals recht radikal anmutenden Antrag gestellt dahingehend etwa, daß die deutschen Juden als „Nationale Minorität“ organisiert werden sollten. Der Antrag wurde damals einstimmig abgelehnt. Das hinderte aber Herrn Rabbiner Dr. Heinemann Vogelstein nicht, eine überaus scharfe polemische Schrift gegen den Zionismus erscheinen zu lassen, die im wesentlichen auf dem Mühsamschen Antrag beruhte. Er ging in dieser Schrift so weit, zum Boykott gegen die Zionisten, insbesondere gegen alle dem Zionismus freundlich gesinnten Rabbiner, seine Kollegen aufzufordern. Ich antwortete darauf mit dem schon erwähnten Artikel in der „Welt“ – „Sturmgeselle Vogelstein“. Der Zufall fügte es, daß ich kurz nach Erscheinen jener Broschüre in Berlin in einem Hotel mit Vogelstein zusammentraf. Er stutzte erst, war am Anfang etwas grimmig, aber dann plauderten wir ganz freundlich miteinander. Er gehörte zu jenen Männern, die sachliche Differenzen nicht ins persönliche Verhältnis übertragen.
Meinen bewährten Bürovorsteher August Quante nahm ich mit nach Berlin. Er hat sich dort glänzend eingelebt, wenn ihm auch der Unterschied zwischen der wirklichen und der fiktiven Großtadt erst allmählich aufging. Ich erinnere mich, daß, als er zum ersten Mal das große Warenhaus von Wertheim besichtigte, er mir anerkennend berichtete: „Das ist wirklich ein hübscher Laden.“ – Ich habe übrigens, wie ich bei der Gelegenheit bemerken will, immer die Ansicht vertreten, daß nichts so charakteristisch für Berlin war wie die großen Warenhäuser, ganz abgesehen davon, daß der große Bau des Wertheim-Palastes am Potsdamer Platz, erbaut von dem jüdischen Architekten Messel, wohl das schönste Erzeugnis moderner Architektonik in der Reichshauptstadt war. Ich erinnere mich noch der bescheidenen Anfänge von Wertheim in der Rosenthaler Straße, und wie zu Beginn man sich genierte, dort einzukaufen, so daß das Warenhaus Tüten ohne Aufdruck der Firma benutzte, um die Käufer nicht zu kompromittieren. Und als Tietz begann, übertrug sich diese Abneigung gegen Warenhäuser auf diese Firma in noch größerem Maße. Als Tietz in der Leipziger Straße seinen Palast erbaute und über dem Portal vier imposante Frauengestalten schwebten, nannte der Berliner Volkswitz diese „die fünf Sinne – denn der Geschmack fehlt.“ – Dabei eine nette Episode: Einer russischen Dame, die bei uns zu besucht war, schilderte ich die Größe von Tietz, indem ich den alten Witz erzählte: Tietz hat eine zoologische Abteilung. Da ist kürzlich ein Tiger ausgebrochen und hat 14 Tage Verkäuferinnen gefressen, ohne daß man den Abgang merkte. – Das hörte unsere Köchin, ein altes Faktotum des Hauses, setzte ihr Tablett auf den Tisch und sagte: „Das glaube ich nicht.“ – Auf meine Frage, warum nicht, sagte sie: „Ein Tiger frißt doch nur Gras.“
Naturgemäß hatten wir noch eine Reihe Abschiedsbankette mitzumachen, aber schließlich war es doch soweit, und zu Anfang Dezember 1906 fuhr ich nach Berlin, um meine Niederlassung dort zum 1. Januar vorzubereiten.
II.
Ich hatte jetzt die beste Gelegenheit, einem Lieblingssport von mir zu frönen, nämlich dem Wohnungssuchen, da ich mich sowohl um Wohnung wie um Büro umsehen mußte. Schon wenn ich als Student eine „Bude“ suchte, machte mir das inniges Vergnügen, denn die kurzen Besuche bei den verschiedenen Wirtinnen verschafften einen Einblick in mitunter recht sonderbare Milieus und Charaktere. – Ungefähr das gleiche Vergnügen empfinde ich etwa, wenn ich im D-Zug den Korridor entlangwandele und sich nun bei jedem Schritt, von Abteil zu Abteil, neue Genrebilder auftun. – Ich beschloss, den Monat, den ich in Berlin der „Suchaktion“ widmen wollte, nicht in meinem gewöhnlichen Absteigequartier, im „Hotel de Russie“ zu verbringen, sondern ich nahm mir ein möbliertes Zimmer in der Karlstraße. Da erlebte ich gleich in der ersten Nacht ein drolliges, echt berlinisches Abenteuer: Mein Bett stand vor einer Flügeltür. Sehr früh am Morgen wurde ich durch Stimmen geweckt. Ich glaubte erst schlaftrunken, man rede in meinem Zimmer, aber dann merkte ich, daß das Geräusch durch die Tür aus dem Nebenzimmer drang, in dem offenbar auch das Bett gegen die Flügeltür gestellt war. Ich vernahm den überraschenden Satz: „Machen Sie sofort, daß Sie aus meinem Bett kommen!“ – in höchster Wut von einer weiblichen Stimme ausgestoßen. – Das scheint mir allerdings die höchste Zeit, dachte ich und lauschte erstaunt, was folgen würde. Ein heftiger Wortwechsel zwischen einer weiblichen und einer männlichen Stimme, dann ein wildes Getrampel die Tür des Nebenzimmers zum Korridor flog auf, laufende Schritte draußen, dann wurde die Tür zu meinem Zimmer aufgerissen, und eine junge Dame im Nachtgewand mit fliegenden Haaren stürzte in mein Zimmer, klammerte sich an mich und bat in russisch-jüdischem Akzent um meinen Schutz. In der Tür erschien, ebenfalls in sehr intimer Toilette, ein junger Mann, der höchst verstört Aufklärung zu geben versuchte, – aber sie hörte nicht auf ihn. Alle Nachbarn stürzten alarmiert aus ihren Betten und Zimmern, die Wirtin kam, und es erschien auch ein Polizist. Mit Mühe gelang es, die Situation zu klären. Die junge Dame war gestern erst eingezogen, sie hatte in der nahegelegenen Klinik in der Ziegelstraße ihre Tante untergebracht: Der junge Mann aber, eben von einer Reise zurückgekehrt, wusste davon nichts, daß die frühere Bewohnerin des Zimmers, seine Freundin, ausgezogen war. Inhaber des Schlüssels der Wohnung, schlich er sich morgens herein, um ihr eine freudige Überraschung zu bereiten. – Die Überraschung gelang auch völlig, wenn sie auch nicht eben freudig war. Nur ganz allmählich beruhigten sich die Gemüter, aber die junge Dame, allzu überwältigt von der ersten Nacht in Berlin, packte sofort ihre Sachen und zog aus.
Mit Alfred Klee wanderte ich bei der Bürosuche lange umher, bis wir endlich in der Königstraße, gegenüber dem Rathaus, ein uns zusagendes Büro fanden. Wir hatten die Aussicht auf den Altstädter Markt, die Stelle, an der vor einigen hundert Jahren die letzte Judenverbrennung stattgefunden hatte und an der jetzt das Lutherdenkmal stand. In diesem Büro blieben wir einige Jahre. Alfred Klee nach Absolvierung des Staatsexamens trat erst zum 1. April in die Praxis, während ich schon zum 1. Januar diese aufnahm.
Das Leben des Barreau in Berlin unterschied sich wesentlich von dem in Hannover. Das Landgericht I in Berlin in der Grunerstraße ähnelte architektonisch mehr einem Kunstgewerbemuseum, war aber nicht unzweckmäßig gebaut. Erstaunlich war für mich nur der Einfall des Architekten, über dem Portal ein Modell des Gebäudes aufzubauen, und ich konnte nie ermitteln, ob nun wieder neben dem Portal dieses Modells ein kleineres Modell angebracht sei und so bis in die Ewigkeit fort. – Wer über die gewundenen Gänge und die verschnörkelten Treppen wandelte, war erstaunt, wenn in einem bestimmten Teil des Geländes die feierliche Stille, die dort im allgemeinen herrschte, durch ein brausendes Geräusch unterbrochen wurde. Wenn er ihm nachging, stand er dann plötzlich vor dem Eingang des Anwaltszimmers oder vielmehr des geräumigen Saales, in dem die Anwälte residierten. Dort herrschte ein unbeschreiblicher Lärm, hauptsächlich verursachten den Männer in flatternden Roben mit großen Aktenbündeln unter dem Arm, die unaufhörlich Namen, meist jüdischen Anklangs riefen, – die nämlich ihre Prozessgegner suchten. In Hannover war das anders gewesen. Dort hatte sich der eigentümliche Brauch herausgebildet, daß jeder Anwalt sich auf das Gericht von seinem jüngsten Schreiberlehrling begleiten ließ, der die Akten trug und dessen Aufgabe es war, den gegnerischen Anwalt zu suchen. Diese Jungens saßen nun, mindesten hundert an der Zahl, auf den Treppen herum und harrten des Winkes ihres Chefs, wen sie aufzusuchen hätten. Dann setzten sie sich mit dem entsprechenden Schreiberlehrling in Verbindung, der ja nun wusste, wo sein Herr und Gebieter steckte. Das war natürlich in einem Betriebe wie in Berlin nicht möglich, und so hatte man folgendes System ausgeklügelt: Jeder Anwalt hatte ein kleines Schild an der Wand des Anwaltszimmers und schrieb darauf, in welches Zimmer er sich begeben wollte. Wenn ihn aber dann ein Kollege dort aufgesucht und zu einem anderen Terminzimmer abgeholt hatte, war natürlich jene erste Notiz irreführend, und es setzte jene Schreierei ein. Auf hohem Podium aber thronte der Chef der Anwaltsboten, Herr Werner mit seinen Gehilfen und suchte, das Chaos mit mächtiger Stimme, unterstützt von echt berlinischem Witz, zu dirigieren. – „Herr Gronemann“, rief er mir einmal zu, „draußen wartet ein Klient auf Sie!“ (Draußen stauten sich immer Mengen von ihren Anwalt suchenden Klienten.) „Wie sieht er denn aus?“, fragte ich. – „Na“, sagte er, „gemäßigter Galizianer.“ Er hatte für viele der Kollegen nicht immer schmeichelhafte Spitznamen. Ein Kollege, der dafür berüchtigt war, daß er auf dem Korridor ratlos umherirrende Leute ansprach und sich so Klienten zu schaffen suchte, hieß der „Flurschütz“, und wenn man nach seinem Aufenthaltsort fragte, pflegte Werner etwa zu antworten „In Jagen (Jagdrevier) vierzehn.“ – Der Anwaltssaal hatte eine große Anzahl von Nebenräumen, insbesondere ein Schachzimmer, in dem ständig vier oder fünf Partien im Gange waren und in dem zahllose Kibitze dem Spiel folgten. Es war sehr schwer, jemanden, der in sein Spiel vertieft war, loszueisen und ins Terminzimmer zu bringen. – Bemerkenswert waren auch die Schreiberjungen, die mit Akten in die einzelnen Terminzimmer eintraten, um dort einen gutwilligen Anwalt zu finden, der für ihren verhinderten Chef schnell das Auftreten übernehmen wollte: denn trotzdem man es sich angewöhnt hatte, an jedem Tage telephonisch sich miteinander über die Zeit, in der man sich treffen wollte, zu verständigen (bei mir war eine Dame nachmittags nur damit beschäftigt, solche telephonischen Verabredungen zu treffen) war es nicht immer möglich, die Verabredung pünktlich einzuhalten, zumal außer den drei Landgerichten an den verschiedenen Enden der Stadt es noch vielleicht 20 in der ganzen Stadt verstreute Amtsgerichte gab, in denen Termine wahrgenommen werden mußten. Da kam es vor, daß man plötzlich Akten in die Hand gedrückt bekam und dann in der Eile nicht einmal merkte, ob man eigentlich als Kläger oder Beklagter auftrat, was besonders dann geschehen konnte, wenn auf der andern Seite auch eine solche Improvisation stattfand. Es machte übrigens wenig aus, da meistenteils doch nicht wirklich mündlich verhandelt wurde. Die Vorschrift der Zivilprozessordnung lautete zwar auf mündliche Behandlung, aber das war gar nicht durchführbar, und alle Sachen wurden schriftlich ausführlich vorbereitet. Dann hieß es einfach: Wir bitten, den Inhalt der Akten als vorgetragen anzusehen. – Natürlich gab es bei ernsthaften Prozessen, dann schließlich doch eine gründliche Verhandlung, aber bei 40 – 50 Sachen, die jeden Tag innerhalb von drei Stunden erledigt werden mußten, waren das eben nur Ausnahmefälle.