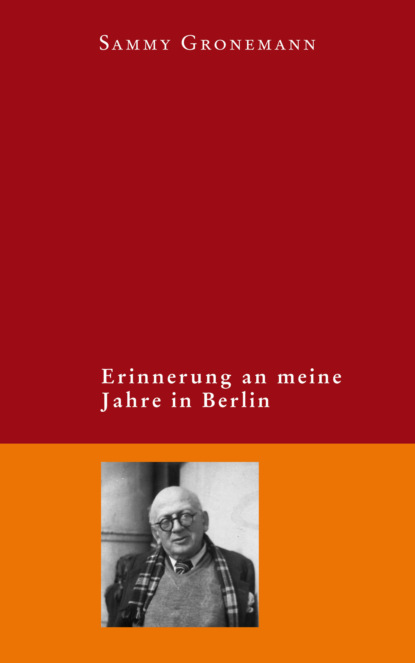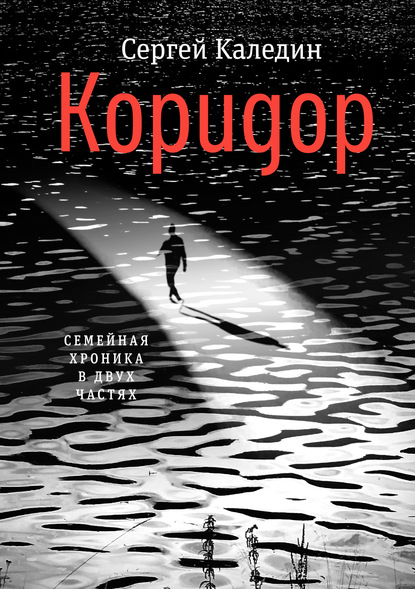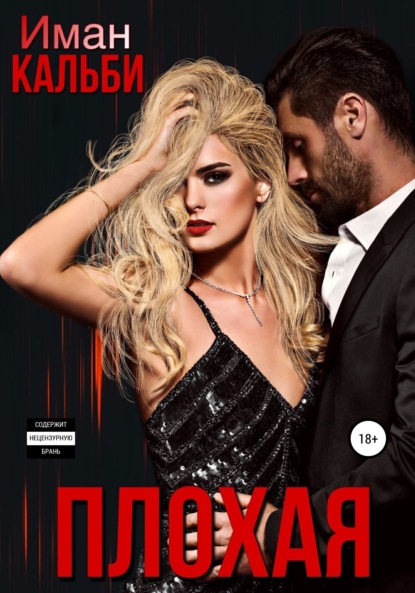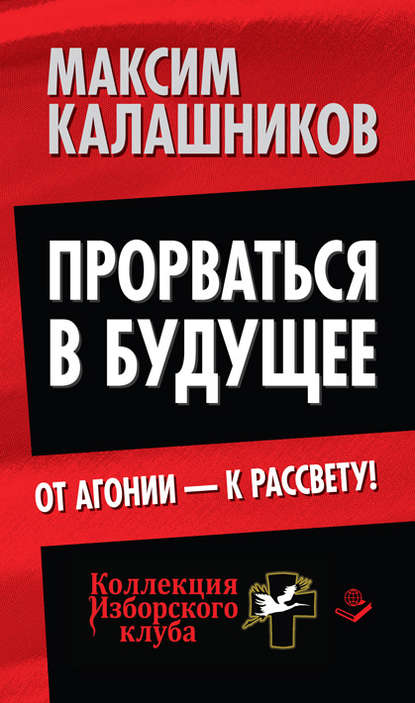- -
- 100%
- +
Meine Reise ging zunächst über Kiew nach Odessa. Stundenlang fährt man da durch die Steppe, ohne ein Haus, oft auch nur einen Baum zu sehen, und gerade diese Eintönigkeit bietet wieder ein besonderes Interesse.
Odessa war für mich recht interessant. Die große steinerne Treppe, die in dem Film „Potemkin“ eine solche Rolle spielt, daß Treiben auf der prachtvollen Strandpromenade, dem Nikolai-Boulevard und Alexanderpark waren anziehend genug. Mit Erstaunen bemerkte ich im jüdischen Restaurant, daß die Jugend dort im allgemeinen weder Hebräisch noch Jiddisch verstand, sondern ganz russifiziert war. Es ist ein eigenartiges Gefühl, im Gewühl herumzuspazieren, wenn man kein Wort der Landessprache versteht, und es war für mich ein interessanter Sport, mit Hilfe meiner Sprachführer, und noch mehr durch Pantomime, mich mit allerhand Leuten zu unterhalten. In dem sehr eleganten Hotel, in dem ich abgestiegen war, sprach man freilich deutsch, französisch, englisch und jiddisch. Ich stand morgens vor dem Hotel und sah mir das Treiben an, als der Geschäftsführer dienstbeflissen an mich herantrat, ob er mir bei Einkäufen behilflich sein könne, ob er mir einen Wagen besorgen solle oder vielleicht Theaterbillets, ob ich weibliche Gesellschaft auf’s Zimmer wünsche (unter „Commodité“ auf Rechnung zu setzen). Er war recht enttäuscht, als ich auf keinen dieser verlockenden Vorschläge einging, und grübelte angestrengt, was er mir noch offerieren könne. Endlich kam ihm eine Erleuchtung: „Haben Sie schon Schekel gezahlt?“ – Der Mann hatte eben alles auf Lager. – Nachdem ich von Odessa genug hatte, fuhr ich nach Rumänien über die Grenzstation Ungheni, vorbei an Kischineff, das traurige Erinnerungen an den Progrom von 1903 erweckte. Unterwegs machte ich die Bekanntschaft eines ungarischen höheren Eisenbahnbeamten, eines alten Junggesellen, der sich als Lebemann aufspielte und mir allerhand seltsame galante Erlebnisse, die er in Berlin gehabt haben wollte, erzählte. Ich habe ihm wie noch zu berichten ist, später auch ein erstaunliches, kleines Abenteuer verschafft. – In Russisch Ungheni im Wartesaal geschah es, als ich zur Verständigung mit dem Kellner in einem Polyglott Kunze blätterte, daß der Kellner hinter das Büffet sprang und nun auch mit dem gleichen Sprachführer – bloß russisch-deutsch statt deutsch-russisch – erschien, wonach dann die Verständigung leicht vor sich ging. – Nun fuhren wir mit der kleinen Vicinalbahn zu dem eine Stunde entfernten rumänischen Ungheni. Kurz vor der Station hielt auf offener Strecke der Zug, und über das Feld kamen mehrere in Zivil gekleidete Herren, gefolgt von einigen Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett. Die Herren gingen den Zug entlang, ließen sich die Pässe zeigen, auf die sie irgendeinen Stempel drückten und zurückgaben. So geschah es auch im letzten Abteil mit meinem Reisegefährten. Meinen Paß aber sah sich der Beamte mißtrauisch an und fragte mich, woher ich käme. Ich sagte: „Von Iskorost.“ – „Wo liegt das?“, fragte er. (Die Unterhaltung wurde französisch geführt). Ich sagte: „Bei Korostyn.“ Auch dieser Ort war ihm erstaunlicherweise unbekannt. „Und wo liegt das?“ – Ich sagte: „Bei Uschomir.“ – Er blieb eine Weile nachdenklich und stellte dann die erstaunliche Frage: „Haben Sie schmutzige Wäsche?“ Ich antwortete ahnungslos: „Ja, natürlich.“ – „Gut“, sagte er, und statt mir meinen Paß zurückzugeben, gab er ihn einem Soldaten und erklärte mir: „Auf der Station werden Sie ihre Anweisungen für die Quarantäne erhalten.“ Ich bekam keinen kleinen Schreck, – meine Verulkung hatte schlechte Wirkungen hervorgerufen – aber schon hatte er sich umgedreht, gab auf rumänisch dem Soldaten Anweisungen, und einer der Krieger stellte sich auf das Trittbrett vor meinem Fenster, während der Herr sich, höflich den Strohhut lüftend, entfernte. Wenige Minuten darauf standen wir in der Station, und mein militärischer Begleiter lieferte mich im Stationsbüro ab. Dort saß ein korrekter Herr, der mich den Koffer öffnen ließ, ihn durchsah und dann erklärte: „Sie werden unter Eskorte nach Bukarest kommen in das Spital, und nach drei Tagen, wenn sich nichts Verdächtiges zeigt, werden Sie entlassen.“ – Ich versuchte, ihm das auszureden, aber er erklärte: „Mein Herr, meine Vorschriften sind streng. Ich kann davon nicht absehen.“ Ich sah, daß ich es anders versuchen mußte. Den Weg der Korruption zu beschreiten, traute ich mich damals nicht, – ich sagte: „Also gut, dann ist nichts zu machen, wenn Ihre Instruktionen so formell sind. Aber sagen Sie mir bitte, was haben Sie dort für einen Kachelofen?“ Er war nun seinerseits recht erstaunt und fragte mich, wieso mich das interessiere. Ich erklärte ihm, ich wäre Korrespondent großer Berliner Zeitungen und sammle folkloristisches Material. Ich würde natürlich auch über die Ergebnisse hier interessante Berichte schreiben. Er stutzte etwas. Offenbar war es ihm nicht ganz recht, wenn ich von Grenzschikanen berichten würde. Aber ich ließ ihm gar keine Zeit, sondern verwickelte ihn in ein allgemeines Gespräch. Nach einigen Minuten saßen wir am Tisch, und ich erzählte unaufhörlich allerhand Anekdoten. Er hatte sich wohl an diesem Posten lange nicht so gut unterhalten, und wir waren bald gute Freunde. Als dann der Zug nach Bukarest einlief und meine Wache mich in Empfang nehmen wollte, sagte ich, ihm nun auf die Schulter klopfend: „Nun, jetzt sind wir doch gute Freunde. Können Sie wirklich nichts für mich tun?“, worauf er lachte, dem Soldaten den Paß abnahm und mir gute Reise wünschte. Ich sah wieder einmal, daß man mit Humor und guten Witzen oft die schwierigste Situation überstehen kann. Mein Reisegefährte, der ungarische Beamte, war sehr glücklich, mich wieder zu sehen. Wir machten Station in Jassy. Wir kamen dort 2 Uhr mittags an, und unser Zug ging erst abends um 6 Uhr weiter. In einem Caféhaus erfrischten wir uns, – es war ein glühendheißer Tag. Ich fragte den bedienenden Kellner, wie es Dr. Lippe gehe (dem Alterspräsidenten des I. Kongresses) und erhielt befriedigende Auskunft. Mein Reisegefährte, Herr Komarow, war erstaunt, daß ich auch in Jassy Bekannte hatte. Aber er sollte noch mehr erstaunen. Ich trennte mich von ihm, da ich das Judenviertel besichtigen wollte, und wir verabredeten ein Treffen am Bahnhof kurz vor sechs. Ich wanderte nun durch das Judenviertel, Straßen auf Straßen voll Trödlerläden. Ich hatte den Eindruck, daß die Juden von Jassy davon leben, daß sie sich gegenseitig alte Hosen verkaufen. Dann bestieg ich die Straßenbahn, um auch andere Teile der Stadt zu besichtigen. Neben mir saß eine höchst anziehende junge Dame. Ich hielt meinen Reiseführer aufgeschlagen in der Hand und fragte naiv, als wir an einer schmutzigen, zerfallenen Kaserne vorbeikamen, ob das die Kathedrale sei. Sie war ziemlich verblüfft und versuchte, mich aufzuklären. Als ich dann aber, als wir an einer stattlichen Kirche vorbeikamen, auf meinen Plan deutend frug, ob das die Kaserne sei, gingen ihr die Augen auf, und sie fragte mich, ob ich sie verulken wolle. Ich sagte entrüstet: „Ich kann mir nicht denken, daß Sie das jetzt erst merken.“ Sie meinte: „Wenn Sie die Stadt sehen wollen, müssen Sie sich einen Wagen nehmen und sich führen lassen.“ – „Also führen Sie?“, sagte ich. Sie lachte, – und bald saßen wir in einem Wagen und begannen eine Rundfahrt, bei der sie mir die nicht allzu zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Stadt zeigte. Diese Wagenfahrt war in jeder Beziehung ein Genuß. So herrliche Pferde wie hier und in Bukarest habe ich kaum je gesehen, und die Kutscher, feist und glattrasiert, – durchweg Eunuchen – in den samtenen langen Kitteln mit den seidigen Schärpen bilden eine Sehenswürdigkeit für sich. Sie bilden eine besondere Sekte unter dem Namen „Lipovaren.“ Auf dieser Fahrt kamen wir gleich zu Anfang an einem Gartenlokal vorbei, und dort saß eine große Gesellschaft von jungen Leuten und Damen an langen Tischen. Als sie des Wagens und meiner Begleiterin ansichtig wurden, entstand ein großes Hallo, der Wagen wurde angehalten, man umringte uns, und erst allmählich entnahm ich dem Gesprächswirrwarr, daß es eine Gesellschaft von Studenten der Universität und daß meine Begleiterin eine Assistenzärztin eines dortigen Professors war. Sie erzählte ihrer Gesellschaft, wie sie an mich geraten war, und die jungen Leute beschlossen, alle mir die Eskorte zu geben. Sie bestiegen die wartenden Wagen, und so kam es, daß ich vor sechs an der Spitze einer großen Wagenprozession vor dem Bahnhof landete, wo mich Herr Komarow erwartete. Er war ziemlich erstaunt, daß ich so schnell Bekanntschaft in Jassy gefunden hatte. Ich stellte den alten Herren als meinen Onkel vor und erklärte ihm, daß die Damen der Gesellschaft alles meine Cousinen, also auch seine Verwandten seien, und er war ganz erstarrt, als die jungen Damen ihn umringten und abküßten. – Daß meine Depression sich inzwischen einigermaßen gegeben hatte, geht aus dieser Erzählung vielleicht zur Genüge hervor.
Ich kam also dann nach Bukarest. Die Stadt bot damals nicht entfernt das glänzende Bild, das sich mir Jahrzehnte später präsentierte, und trotz des interessanten halborientalischen Lebens, des glanzvollen Korsos auf der „Chaussee“, des Betriebes in der „Flora“, mißfiel sie mir eigentlich eher. Sie hatte zwar einige reizende Partien, aber im ganzen wimmelte die Stadt von architektonischen Scheußlichkeiten und geschmacklosen Denkmälern. Reizvoll war das Getriebe der Zigeuner. Wenn man einem von den schmutzpatinierten Buben etwas schenkte, konnte man Straßen lang die bettelnde Schar der Jungen nicht loswerden. Ich machte mich bald davon und blieb zwei Tage in dem reizend gelegenen Herkulesbad. Vergeblich forschte ich dort in den zahlreichen jüdischen Läden, wo es ein rituelles Restaurant gäbe. Die Inhaber starrten mich unglaublich und fast mißtrauisch an; sie konnten sich scheinbar gar nicht vorstellen, daß ein westeuropäischer Tourist ein derartiges Verlangen hatte. Zu meiner freudigen Überraschung stellte ich dann aber fest, daß in dem recht eleganten Kurhaushotel, in dem ich abgestiegen war, unter der Aufsicht des Rabbiners von Orsowa eine koschere Fischküche eingerichtet war, und so konnte ich bei den Klängen eines guten Zigeunerorchesters neben einer recht soigniert aussehenden Gesellschaft von Kurgästen dinieren. Merkwürdig war folgendes: Ich hatte, wie es allgemein üblich ist, meine Brieftasche und meine Barschaft im Hotelbüro zur Aufbewahrung deponiert. Aber als ich abends dem Tanze im Kursaal zusah, suchte mich der Wirt auf und bat mich, meine Sachen doch lieber an mich zu nehmen, da sie bei mir sicherer wären als in seinem Büro. Am zweiten Abend schon in der Dämmerung fuhr ich in einem Wagen nach Orsowa, um dort den Donaudampfer, der mich stromaufwärts bringen sollte, zu besteigen. Da erlebte ich ein reizendes Intermezzo: Als der Wagen um die Ecke des Hotelparks bog, erscholl ein „Stop“, und aus dem Gebüsch sprang ein Stubenmädchen, das ich bis dahin kaum zu Gesicht bekommen hatte, auf das Trittbrett, steckte mir eine Rose ins Knopfloch, gab mir einen Kuß und verschwand, ehe ich mich von meiner Überraschung erholen konnte. Nach angenehmer Fahrt kam ich nach Orsowa, wo der Dampfer lag, der am andern Morgen fortgehen sollte. Ich richtete mich in meiner Kabine ein und spazierte dann noch sehr lang auf dem Deck in Gesellschaft eines älteren jüdischen Arztes, dem offenbar das, was ich ihm über die jüdisch-nationale Idee und den Zionismus erzählte, vollkommen neu war. – Früh am andern Morgen beobachtete ich, wie die Schiffsgäste an Bord kamen. Dabei fiel mein Blick auf die schöne Rose des Stubenmädchens, und, da die Blume schon den Kopf sinken ließ, warf ich sie achtlos auf die Laufplanke. Da geschah etwas Unerwartetes: Nach einiger Zeit kam eine wunderschöne, höchst elegante Frau, umgeben von einem ganzen Stab ebenso eleganter Herren, und als sie über die Planke ging, stutzte sie, bückte sich und nahm die Rose, reinigte sie und steckte sie sich ins Haar, und den ganzen Tag sah ich ebenso bewundernd wie beschämt diese Dame auf dem Deck sitzen, wie sie mit ihrer Begleitung plauderte, und immer leuchtete die Rose aus ihrem Haar. Unsereins wirft achtlos etwas weg, und eine schöne Frau weiß, ihm neues Leben und Glanz zu verleihen.
Die phantastisch schöne und romantische Fahrt von Orsowa über Vieczerowa durch das „Eiserne Tor“ und den Engpaß von Kasan, bei der man in den Felsen noch die Spuren des Durchzugs der römischen Legion unter Trajan sieht, will ich nicht beschreiben. Sie ist ungeheuer lebendig in den ersten Kapiteln des „Goldmensch“ des leider und zu Unrecht in Vergessenheit geratenen großen Romanciers Moritz Jockey geschildert. Wir genossen den Anblick, behaglich auf dem Verdeck sitzend, neben mir jener alte Arzt, ein ungarischer Offizier, und eine ungarische jüdische Dame. Im Gespräch ergab es sich, daß der Offizier sehr wohl Verständnis für die jüdischen Aspirationen hatte, während ich in der jungen Dame eine Vertreterin jenes jüdisch-ungarischen Chauvinismus kennenlernte, wie ich ihm später noch sehr häufig begegnet bin. Und so kam es, daß bald die Dame mit dem Offizier in einen lebhaften Disput geriet, in dem der Ungar die jüdische, sie aber die ungarisch-nationale Idee vertrat. Bei Bazias enden die Ausläufer des Gebirges, dort verbreitert sich der Strom, und die Gegend wird eben. Gerade, als wir an Bazias vorbeikamen, hielt die Dame eine lange Suada voll von bekannten Banalitäten der assimilatorischen Mentalität. Ich hatte mich lange ruhig verhalten und sagte nur lässig, auf die Landschaft weisend: „Schade, es wird immer flacher.“ Die recht gescheite junge Dame biß sich auf die Lippen, brach ihre Rede ab, und wir wandten uns harmlosen Themen zu. Abends langten wir in Belgrad an, ich verabschiedete mich von der an sich sehr sympathischen Reisegesellschaft, warf noch einen wehmütigen Blick auf jene Rose im Haar der schönen fremden Frau und betrat serbischen Boden. Zu meinem höchsten Erstaunen fand ich ein besonders elegantes Hotel in der sonst wenig einladenden Stadt und konnte mir diese Eleganz nicht recht erklären, bis ich hörte, daß dort die ungarischen Offiziere aus dem gegenüberliegenden Semlin zu verkehren pflegten, und sich dort ein Spielklub aufgetan hatte. Als ich am andern Tag die Stadt besichtigte, feierte wieder mein Polyglott Kunze, diesmal der serbisch-deutsche, Triumphe. Ich fand darin unter der Rubrik „Gespräch auf der Straße“ folgende hübsche Anweisung: „Mein Fräulein, darf ich Sie begleiten?“ – „Mein Fräulein, Sie sind ein Engel!“, und darauf folgte ziemlich logisch die Vokabel „der Kuß“. Die Dame aber hatte seltsamer Weise keine andere Antwort als: „Sie sprechen aber ein ausgezeichnetes Serbisch“, worauf dann die schlagfertige Antwort erfolgte: „Ich habe auch einen ausgezeichneten Sprachführer Polyglott Kunze, in allen besseren Buchhandlungen zu haben.“
Ich fuhr dann mit der Bahn durch die Puszta nach Budapest und über Wien nach Berlin. Meine Eindrücke von diesen beiden Städten, die ich nachher noch oft besuchte, behalte ich späterer Gelegenheit vor.
VII.
Dem Herannahen des IX. Kongresses sahen die Freunde von Wolffsohn wieder recht kleinlaut entgegen. Seine Gegner hatten nach der Niederlage auf dem VIII. Kongreß eine heftige Agitation gegen ihn entfaltet, und in weiten Kreisen glaubte man, in ihm eine Art von Schattenkönig zu sehen, der eine Puppe in den Händen irgendwelcher Drahtzieher wäre. Nebenher argumentierte man mit einem anderen Argument: Selbst wenn Wolffsohn die genialste Führerpersönlichkeit wäre, wäre es doch undenkbar, daß der Sitz der Organisation in einer Provinzstadt wie Köln läge. Aus politischen Gründen und aus Gründen des Prestiges müßte die Zentrale nach einer europäischen Hauptstadt verlegt werden, etwa nach Berlin, dem Wohnsitz von Warburg, und Wolffsohn weigere sich konstant, zu übersiedeln. – Wir gingen nach Hamburg, wohin der Kongreß für Dezember 1909 einberufen war, eigentlich in der Überzeugung, daß Wolffsohns Schicksal besiegelt sei, und wir in Warburg den künftigen Präsidenten zu sehen hätten.
Der Kongreß begann an einem Sonntag, und die Vorkonferenzen, die größtenteils in dem Hause der Bnei Brith-Loge stattfanden, begannen eine Woche früher. Ein ärgerlicher Gedanke war es, daß der Tag vor der Kongreßeröffnung ein Sabbat war, und daß bestimmt bei den Versammlungen im Logenhaus an diesem Tage von vielen Teilnehmern geraucht werden würde; das hätte nun aber in den Kreisen der konservativ eingestellten Juden Hamburgs unliebsames Aufsehen erregt. Es war klar, daß durch einen Appell an den Takt nichts erreicht werden würde. Viele der Radikalen hätten es als einen Verrat an ihrer Weltanschauung betrachtet, mit Rücksicht auf den Sabbat ihre Zigaretten nicht anzustecken. Da war es Wolffsohn, der einen originellen Ausweg fand: als die Teilnehmer der Vorkonferenzen am ersten Sitzungstag, also am Sonntag das Haus betraten, fanden sie dort überall Plakate, in denen mitgeteilt wurde, daß in diesem Hause das Rauchen polizeilich verboten sei. Polizeivorschriften sind ja nun nicht so leicht zu umgehen wie die Vorschriften vom Sinai, und so kam es, daß man sich die ganze Woche in diesem Hause des Tabaksgenusses enthalten mußte. Um so erstaunter war man, als dann am Sabbatausgang, dem Abend vor Kongreßeröffnung, die Plakate verschwunden waren.
Am Sonntag früh, kurz vor der für die Eröffnung festgesetzten Stunde, entstand ganz unerwartet eine neue und ernsthafte Schwierigkeit: Schon hatte das Aktionskomitee sich in einem Nebenraum versammelt, um, wie üblich, geschlossen die Tribüne zu betreten, als Boris Goldberg erschien und verstört mitteilte, daß Max Nordau sich entschieden geweigert hätte, das Präsidium des Kongresses zu übernehmen. Das war ein Schlag für uns alle. Keiner von uns war auf den Gedanken gekommen, daß etwas Derartiges eintreten könne, und wir starrten ziemlich ratlos einander an. Da erschien Nordau selbst und setzte in seiner gewohnten klaren und logischen Art seine Gründe auseinander. In der Tat waren sie derart einleuchtend, daß sie seine entschiedene Weigerung durchaus rechtfertigten, – es gab eigentlich gegen seine Argumentation keine Einwände. Es trat eine betretene Pause ein. Auf einmal erhob sich Wolffsohn, trat vor Nordau hin und sagte: „Dr. Nordau, noch bin ich Präsident der Organisation. Erkennen Sie meine Autorität an?“ – Nordau nickte stumm. „Dann befehle ich Ihnen hiermit“, erklärte Wolffsohn mit starker Stimme, „das Präsidium anzunehmen.“ – Es war eine merkwürdige Szene. Allen stockte der Atem. Nordau sprach kein Wort, sondern beugte sich langsam tief bis zur Erde – nie wieder habe ich eine solche Verbeugung gesehen – richtete sich auf und, ohne ein Wort zu sagen, ging er in den Saal voran und übernahm das Präsidium. Man muß sich, um diese Szene in ihrer ganzen Bedeutung zu verstehen, vergegenwärtigen, wie Wolffsohn Nordau verehrte und sich vor seiner Geistesgröße beugte, und welche Überwindung es Nordau gekostet haben muß, seine Überzeugung in diesem Fall zu opfern und so uns allen ein Beispiel der Disziplin zu geben.
Der Permanenzausschuß, welcher alle Wahlen vorzubereiten hatte, stand diesmal vor besonders schweren Aufgaben. Der Präsident dieses Ausschusses war Chaim Weizmann. Zu seinem Stellvertreter wurde ich gewählt. Wir saßen am zweiten Kongreßtage, am Montag, in einer erregten Debatte, als Wolffsohn erschien und verlangte, daß wir sofort die Verhandlung abbrechen und in das Plenum kommen sollten, um seine Replique auf die gegen ihn gerichteten Angriffe zu hören. Und nun entrollte sich vor uns eine der eindruckvollsten Szenen, die ich auf einem Kongresse erlebt habe. Die Gegner Wolffsohns hatten ihn in der Generaldebatte durchaus nicht geschont. Alle die Gegnerschaft, Verbitterung und Enttäuschung, die sich angesammelt hatten, kamen rückhaltlos zum Ausdruck. Vor allem war es Posmanik, der auf ihn loshackte. Es schien, daß Wolffsohn vollkommen darniederlag, und daß ihm eigentlich nichts übrigblieb, als stumm zu resignieren. Als er seine Rede begann, sah es eine Zeitlang so aus, als ob man ihn überhaupt nicht anhören wolle. Erst allmählich wurde es ruhiger und ruhiger, und in staunendem Schweigen hörte man schließlich atemlos dem Redner zu, der sich wirklich in dieser Rede zu einer auch von seinen Freunden nie geahnten Höhe aufschwang. Neben mir auf der Treppe zur Tribüne stand Dr. Osias Thon aus Krakau, immer bloß flüsternd: „Welch ein kluger Jid!“ Es war ein ungeheuerer rhetorischer Erfolg, vollkommen überraschend für Freund und Feind. Als Wolffsohn geendet hatte, erhob sich der ganze Kongreß und stimmte die „Hatikvah“ an. Wolffsohn wurde genötigt, noch ein paar Dankworte hinzuzufügen (im Kongreßstenogramm fehlend). Alles umringte den Redner, um ihn zu beglückwünschen. Nordau schüttelte ihm die Hand und sagte: „Die Bestie ist gebändigt. Der Kongreß hat einen Mann gespürt.“
David Frischmann hat im „Heint“ in besonders reizvoller Weise jene Szene geschildert und mit beißender Ironie die Niederlage jener Männer beschrieben, die Wolffsohn nun als ein Nichts dargestellt hatte, und die jetzt den ungeheuren Erfolg seiner Persönlichkeit erleben mußten. – Ich muß hier noch eine kleine Episode erzählen, die so überaus charakteristisch für Wolffsohn ist: In diesem Momente, den man als einen Höhepunkt seines Lebens bezeichnen kann, als ihn alles umringte und ihm zujubelte, und man annehmen mußte, daß er von seinem Erfolge berauscht sei, packte er mich plötzlich am Arm: „Gronemann, wo ist Alfred Klee? Ich muß sofort Alfred Klee sehen.“ Ich machte mich sehr erstaunt auf die Suche und trieb wirklich Klee auf, der nun seinerseits höchst gespannt war, was ihm Wolffsohn in diesem Momente so dringendes zu sagen habe. Er drängte sich an meiner Seite durch die Gratulanten hindurch, und zu meiner Verblüffung war es nur folgendes, was Wolffsohn sagte: „Alfred, als ich eben noch ein paar Worte hinzufügen mußte, fiel mir im Augenblick nichts anderes ein als ein Zitat aus einer Rede, die Du einmal in Berlin gehalten hast. Vergib mir, daß ich Deinen Namen nicht genannt habe!“
Erst ganz allmählich legten sich die Wogen der Begeisterung, und nun waren es die Gegner Wolffsohns, die recht kleinlaut geworden waren. Da geschah ein neuer Zwischenfall ganz anderer Art: Es war der erste Kongreß, der auf deutschem Boden stattfand, und, allgemeiner Übung folgend, hatte das Kongreßpräsidium kurz vor der Eröffnung ein Huldigungstelegramm an den deutschen Kaiser geschickt. Nun lief ein liebenswürdiges Antworttelegramm ein, und das setzte das Präsidium in nicht geringe Verlegenheit. Waren doch auf dem Kongreß sehr viele Linksradikale vertreten, und es war vorauszusehen, daß bei Verlesung des kaiserlichen Telegramms peinliche Zwischenfälle entstehen würden, peinlich für den Kongreß und vielleicht verhängnisvoll für die Demonstranten. Andererseits konnte man doch unmöglich von der Verlesung des Telegramms absehen. Wieder fand Wolffsohn einen Ausweg: Er ließ die Nachricht verbreiten, daß um die und die Stunde Franz Oppenheimer den sozialistischen Delegierten und Gästen einige vertrauliche Mitteilungen von Bedeutung zu machen hätte. Der Name von Franz Oppenheimer besaß große Anziehungskraft, und zu gegebener Zeit sammelten sich ausnahmslos alle Linken in dem betreffenden Zimmer, das von dem Plenarsaal räumlich weit entfernt war. Wolffsohn hatte Oppenheimer gesagt, er habe dort eine Rede zu halten und dürfe nicht aufhören, bevor er ihm ein Zeichen gäbe. Oppenheimer fragte sehr verwundert, was in aller Welt er denn reden solle. Wolffsohn sagte: „Das ist Ihre Sache. Sie haben nur zu reden und die Leute dort festzuhalten, solange ich es für nötig finde.“ – Oppenheimer blickte Wolffsohn an, merkte, daß irgend etwas dahintersteckte und sagte schmunzelnd: „Wolffsohn, das ist irgendein Schwindel. Ich weiß nicht welcher, aber ich mache mit“ und begab sich in das Zimmer. Jetzt nun, während alle „gefährlichen“ Elemente aus dem Saal entfernt waren, wurde von Nordau das Telegramm vorgelesen, das Auditorium klatschte, und nun erlöste Wolffsohn Oppenheimer. Die Hörer kehrten ziemlich erstaunt in den Kongreßsaal zurück und fragten sich: „Was hat Oppenheimer eigentlich gesagt?“ Als sie aber dann hörten, was vorgegangen war, begriffen sie freilich Wolffsohns Taktik, die meisten nahmen die Sache mit Humor, – aber leider nicht alle.
Am Nachmittag gelangte plötzlich in den Kongreß das alarmierende Gerücht, daß auf Max Nordau ein Attentat geschehen sei. Man habe ihn wörtlich und körperlich insultiert. Podlischewski und ich wurden vom Präsidium beauftragt, den Tatbestand festzustellen, und wir eruierten folgenden: Nordau hatte mit einigen Freunden im Kongreßrestaurant gesessen, als S. ein radikaler Linker, auf ihn zutrat und ihn wegen jenes Zwischenfalls mit dem Kaiser-Telegramm, für daß er ihn verantwortlich machte, zur Rede stellte. S., ein sehr prachtvoller aber überaus temperamentvoller Mann, den ich persönlich recht gern hatte, ließ sich hinreißen, gegen Nordau Ausdrücke wie „unverschämt“ und „gemein“ zu gebrauchen, worauf Nordau sich vom Stuhl erhob und ihm eine Ohrfeige gab. S. wollte wiederschlagen, aber man fiel ihm in den Arm. – Das war alles, – aber genug, um die größte Erregung bei Delegierten und Gästen hervorzurufen. Die Empörung richtete sich hauptsächlich gegen S., denn ein Angriff auf Nordau erschien allen eine Art Majestätsverbrechen. Wolffsohn aber war besonders erbittert gegen Nordau, der ja zuerst zum Holz-Komment übergegangen war, und er gab die dann auch allseitig befolgte Parole aus, beim nächsten Auftreten Nordau mit eisigem Schweigen zu empfangen, während dieser doch sonst immer mit Beifallssturm begrüßt wurde, wenn er sich auf der Tribüne zeigte.