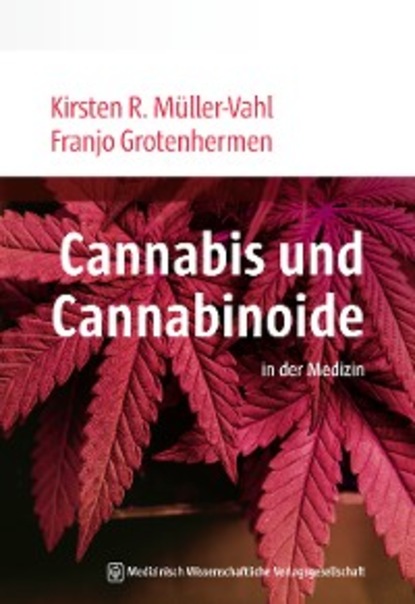- -
- 100%
- +
Homerus (1938) Odysee. Verdeutscht von T. von Scheffer, neu gestaltete Ausgabe, Dietrich, Leipzig.
Leonhardt RW (1970) Haschisch-Report, Dokumente und Fakten zur Beurteilung eines sogenannten Rauschgiftes, Piper-Verlag, München.
Manniche L (1989) An ancient Egyptian Herbal, Texas Press London.
Mechoulam R (1993) Early medical use of cannabis. Nature 363, 215.
Moller KO (1951) Rauschgifte und Genussmittel, B. Schwabe Verlag Basel.
Nees v. Esenbeck TFL, Ebermaier CH (1830) Handbuch der medicinisch-pharmaceutischen Botanik, Erster Theil, Arnz und Comp, Düsseldorf.
O'Shaugnessy WB (1838–40) On the preparations of the Indian hemp, or Gunjah, Transactions of the Medical and Physical Society of Bengal (1838–40), 421–461. Reprint in: Mikuriya T.H (1973) ed. Marijuana: Medical papers 1838–1972, Medi-Comp Press Oakland.
Reier H (1982) Die altdeutschen Heilpflanzen, ihre Namen und Anwendungen in den literarischen Überlieferungen des 8.-14. Jahrhunderts. 1. Band A-H, Selbstverlag Kiel.
Reiniger W (1941) Zur Geschichte des Haschischgenusses, Ciba-Ztschr 7, 2766–2772.
Stefanis C, Ballas C, Madianou D (1975) Sociocultural and epidemiological aspects of hashish us in Greece. In: Rubin V (Ed.), Cannabis and culture, Mouton Publishers The Hague/Paris.
Tschirch A (1909–1925) Handbuch der Pharmakognosie, 3 Bände, Tauchnitz Verlag Leipzig.
3 Die Geschichte eines Gesetzes: Von der Ausnahme zur regulären Verschreibung von Cannabis
Franjo Grotenhermen
Die juristische Auseinandersetzung, die schließlich zur Durchsetzung von Ausnahmeerlaubnissen für die Verwendung von Cannabisblüten ab dem Jahr 2007 und zu einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts für den Eigenanbau von Cannabis durch Patienten im Jahr 2016 führte, begann mit einer Verfassungsbeschwerde durch acht Patienten am 14. Dezember 1999. Bereits im Jahr 1995 gelangte ein durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums erstelltes Gutachten zu dem Schluss, dass die medizinische Verwendung von Cannabis bzw. Tetrahydrocannabinol (THC) nicht mit dem Argument zurückgewiesen werden könne, es gäbe „auf jedem Gebiet bessere therapeutische Alternativen“ (Goedecke u. Karkos 1996).
3.1 Die Folgen eines Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts
Im Dezember 1999 hatten acht Patienten mit verschiedenen Erkrankungen eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht gegen das Verbot der medizinischen Verwendung von Cannabis eingereicht. Ihre behandelnden Ärzte hatten ihnen bescheinigt, dass sie von Cannabisprodukten profitieren (Grotenhermen 2018). Das Bundesverfassungsgericht öffnete mit seinem Beschluss die Tür für dynamische juristische und politische Auseinandersetzungen, die schließlich am 19. Januar 2017 zur einstimmigen Verabschiedung eines Gesetzes führten, durch die Cannabisblüten in Deutschland verschreibungsfähig wurden.
3.1.1 2000: Beschluss des Bundesverfassungsgerichts
Das Bundesverfassungsgericht entschied am 20. Januar 2000, dass Patienten bei der Bundesopiumstelle des BfArM eine Ausnahmeerlaubnis zur Verwendung von Cannabis beantragen können (2 BvR 2382–2389/99). Das Bundesverfassungsgericht wies darauf hin, dass sich Patienten auf den § 3 Abs. 2 Betäubungsmittelgesetz (BtMG) beziehen können, in dem es heißt:
„(2) Eine Erlaubnis für die in Anlage I bezeichneten Betäubungsmittel kann das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte nur ausnahmsweise zu wissenschaftlichen oder anderen im öffentlichen Interesse liegenden Zwecken erteilen.“
In ihrem Urteil schrieben die Richter, dass auch die medizinische Versorgung der Bevölkerung ein öffentlicher Zweck sei, der im Einzelfall die Erteilung einer Erlaubnis rechtfertigen kann.
„Die medizinische Versorgung der Bevölkerung ist danach auch ein öffentlicher Zweck, der im Einzel fall die Erteilung einer Erlaubnis gemäß §3 Abs. 2 BtMG rechtfertigen kann (…).“

„Zwar steht die Erteilung einer Erlaubnis zum Verkehr mit Betäubungsmitteln im Ermessen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte; jedoch haben Antragsteller einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung.“ (Bundesverfassungsgericht 2000)
3.1.2 2005: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
Von der Möglichkeit eines Antrags an die Bundesopiumstelle gemäß des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts haben mehr als 100 Patienten Gebrauch gemacht. Darunter war auch ein Rechtsanwalt, der an multipler Sklerose (MS) mit schweren Symptomen litt, die sein Leben massiv beeinträchtigten. Alle Anträge wurden durch die Bundesopiumstelle mit dem Verweis auf die Möglichkeit der Verwendung von Dronabinol abgelehnt. Mehrere Patienten klagten gegen diese Ablehnungen vor den Verwaltungsgerichten. Am 19. Mai 2005 verpflichtete das Bundesverwaltungsgericht das BfArM den Antrag des MS-Patienten erneut zu prüfen (Bundesverwaltungsgericht 2005).
„Die medizinische Versorgung der Bevölkerung ist kein globaler Akt, der sich auf eine Masse nicht unterscheidbarer Personen bezieht. Sie realisiert sich vielmehr stets durch die Versorgung einzelner Individuen, die ihrer bedürfen.“
Das Bundesverwaltungsgericht betont in seinem Urteil den hohen Wert des im Grundgesetz verankerten Rechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit.
„In das Recht auf körperliche Unversehrtheit kann nicht nur dadurch eingegriffen werden, dass staatliche Organe selbst eine Körperverletzung vornehmen oder durch ihr Handeln Schmerzen zufügen. Der Schutzbereich des Grundrechts ist vielmehr auch berührt, wenn der Staat Maßnahmen ergreift, die verhindern, dass eine Krankheit geheilt oder wenigstens gemildert werden kann und wenn dadurch körperliche Leiden ohne Not fortgesetzt und aufrechterhalten werden.“
Bundesverwaltungsgericht 2005
Die Entscheidung, einem Patienten den Erwerb oder, was insbesondere bei Cannabis in Betracht kommt, etwa den Anbau zu gestatten, bleibt stets eine Einzelfallentscheidung. Sie muss die konkreten Gefahren des Betäubungsmitteleinsatzes, aber auch dessen möglichen Nutzen in Rechnung stellen. Dieser kann gerade bei schweren Erkrankungen, wie sie hier in Rede stehen, auch in einer Verbesserung des subjektiven Befindens liegen. Dabei ist sich der Betroffene bewusst, dass es keinerlei Gewähr für die therapeutische Wirksamkeit des eingesetzten Betäubungsmittels gibt.
3.1.3 2007: erste Ausnahmeerlaubnisse durch die Bundesopiumstelle
Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts führte ab 2007 schließlich zur Etablierung eines Verfahrens, bei dem Patienten einen Antrag auf eine Ausnahmeerlaubnis nach § 3 Abs. 2 BtMG bei der Bundesopiumstelle stellen konnten, mit dem Ziel einer sogenannten ärztlich begleiteten Selbsttherapie mit Cannabisblüten oder einem Cannabisextrakt. Dabei musste der behandelnde Arzt darlegen, dass Standardtherapien nicht ausreichend wirksam waren oder ausgeprägte Nebenwirkungen verursachten, sodass ein Therapieversuch mit Cannabisprodukten indiziert war. Häufig hatten die Antragsteller bereits festgestellt, dass eine Therapie mit Cannabis ihre Leiden linderte. Zwischen 2007 und 2016 nahm die Zahl der jährlichen Antragstellungen und Ausnahmeerlaubnisse stetig zu. Nach Angaben der Bundesopiumstelle besaßen im Januar 2017 insgesamt 1.040 Personen eine solche Erlaubnis (Grotenhermen 2018).
3.1.4 2016: das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
Da sich viele Erlaubnisinhaber die Cannabisblüten aus der Apotheke, die pro Gramm 12–25 EUR kosteten, nicht oder nicht in dem medizinisch erforderlichen Umfang leisten konnten, beantragten einige den für sie finanzierbaren Eigenanbau von Cannabispflanzen für die eigene medizinische Versorgung. Diese Anträge wurden von der Bundesopiumstelle sämtlich abgelehnt. Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 6. April 2016 sorgte dafür, dass einem MS-Patienten, der seit Jahren gerichtlich für eine Erlaubnis zum Eigenanbau stritt, am 28. September 2016 als erstem Patienten in Deutschland überhaupt eine Genehmigung zum Anbau von Cannabis für die eigene medizinische Behandlung erteilt wurde (Bundesverwaltungsgericht 2016). Das Gericht stellte fest, dass der Eigenanbau von Cannabis erlaubt werden muss, da der Erwerb von Medizinalcannabisblüten aus der Apotheke aus Kostengründen ausschied.
„Nach § 3 Abs. 2 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) kann das BfArM eine Erlaubnis zum Anbau von Cannabis nur ausnahmsweise zu wissenschaftlichen oder anderen im öffentlichen Interesse liegenden Zwecken erteilen. Die Behandlung des schwer kranken Klägers mit selbst angebautem Cannabis liegt hier ausnahmsweise im öffentlichen Interesse, weil nach den bindenden Feststellungen des Berufungsgerichts die Einnahme von Cannabis zu einer erheblichen Linderung seiner Beschwerden führt und ihm gegenwärtig kein gleich wirksames und für ihn erschwingliches Medikament zur Verfügung steht. Der (ebenfalls erlaubnispflichtige) Erwerb von sogenanntem Medizinalhanf aus der Apotheke scheidet aus Kostengründen als Therapiealternative aus. Seine Krankenkasse hat eine Kostenübernahme wiederholt abgelehnt.“
3.1.5 2016–2017: vom Gesetzentwurf zum Gesetz
Parallel mit dieser juristischen Entwicklung gab es in den vergangenen Jahren eine zunehmende Offenheit aller im Bundestag vertretenen Parteien hinsichtlich der Notwendigkeit, Patienten einen Zugang zu einer Therapie mit Cannabisprodukten unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten zu eröffnen. Als Alternative zum Eigenanbau entwickelte die Bundesregierung einen Gesetzentwurf, der vorsah, dass die gesetzlichen Krankenkassen verpflichtet werden, unter bestimmten Voraussetzungen eine Behandlung mit Cannabisprodukten zu finanzieren. Dieser Gesetzentwurf wurde von der Bundesregierung am 28. Juni 2016 in den Bundestag eingebracht (Deutscher Bundestag 2016) und dort am 7. Juli in erster und am 19. Januar 2017 in 2. Lesung beraten (Deutscher Bundestag vom 18. und 19. Januar 2017). Das Gesetz wurde am 19. Januar 2017 im Bundestag einstimmig verabschiedet (Deutscher Bundestag 2017) (Zusammenfassung s. Tab. 1).
Tab. 1 Einige Meilensteine auf dem Weg zur medizinischen Cannabisverwendung in Deutschland (Grotenhermen 2018)
1998 Änderung der Einstufung von Dronabinol – (-)-trans-Delta-9-Tetrahydrocannabinol – von der Anlage II in die Anlage III des Betäubungsmittelgesetzes 2000 Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, nach dem Patienten einen Antrag auf eine Ausnahmeerlaubnis zur Verwendung von Cannabisblüten beim BfArM stellen können 2000–2005 Ablehnungen aller Anträge von Patienten auf eine solche Ausnahmeerlaubnis 2005 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, nach dem das BfArM diese Anträge nicht pauschal ablehnen darf 2007 erste Ausnahmeerlaubnis durch die Bundesopiumstelle beim BfArM, zunächst für einen Cannabisextrakt, später überwiegend für Cannabisblüten 20011 arzneimittelrechtliche Zulassung von Sativex® für die Behandlung der therapieresistenten mittelschweren bis schweren Spastik bei Erwachsenen mit multipler Sklerose 2016 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, nach dem einem Patienten eine Ausnahmeerlaubnis für den Eigenanbau von Cannabisblüten erteilt werden muss Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Veränderung betäubungsmittelrechtlicher Bestimmungen zu Cannabis und cannabisbasierten Medikamenten 2017 einstimmige Verabschiedung des Gesetzes am 19. Januar im Deutschen Bundestag und Inkrafttreten des Gesetzes am 10. März 20173.1.6 2016: erste Kritik am Gesetz in der Anhörung im Gesundheitsausschuss
Am 21. September 2016 fand im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags eine öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 28. Juni 2016 statt. Dabei wurde unter anderem bemängelt, dass die Krankenkassen eine Therapie mit Cannabis genehmigen müssen. Der Gesetzentwurf sah vor, dass schwer kranke Patienten künftig auf Kosten der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) mit Cannabisarzneimitteln und Rezepturen versorgt werden können.
Sowohl die Bundesärztekammer (BÄK) und die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) als auch andere Sachverständige wiesen den Genehmigungsvorbehalt durch die Krankenkassen als nicht sachgerecht zurück. So sollte nach dem Gesetzentwurf die medizinische Verwendung von Cannabis von den Krankenkassen nur erstattet werden, wenn eine „allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Leistung im Einzelfall nicht zur Verfügung“ steht.
Die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin e.V. (ACM) bemerkte zum Gesetzentwurf in ihrer Stellungnahme:
1. Obergrenzen für Ärztinnen und Ärzten bei der Verschreibung von Medikamenten bzw. drohende Regressforderungen wegen Budgetüberschreitung sollten nicht zu vermeidbaren Versorgungslücken bei der Verschreibung von cannabisbasierten Medikamenten führen. Daher ist es erforderlich, dass die Verschreibung von cannabisbasierten Medikamenten wie eine Praxisbesonderheit behandelt wird. Sonst droht das Gesetz ein Gesetz für Privatpatienten zu werden, von dem gesetzlich versicherte Bundesbürger nicht in dem erforderlichen Umfang profitieren können.
2. (…) Ebenso wie für andere Therapieverfahren sollte auch für eine Behandlung mit Cannabis und Cannabinoiden gelten, dass eine einmal als wirksam und verträglich festgestellte Therapie beibehalten werden kann.
3. (…) Die Risiko-Nutzen-Bewertung einer Behandlung muss grundsätzlich immer auch mögliche Langzeitschäden im Blick haben – dieses ethische Prinzip sollte auch im Falle einer Entscheidung für oder gegen eine Therapie mit cannabisbasierten Medikamenten Anwendung finden und im Hinblick auf eine Kostenerstattung durch die Krankenkassen berücksichtigt werden.
„Aus Sicht der Patienten und der Ärzteschaft muss es darauf ankommen, dass die Entscheidung, ob ein Patient mit cannabisbasierten Medikamenten behandelt wird, eine Entscheidung von Arzt und Patient ist. Ansonsten bleibt es bei einer Zweiklassenmedizin, mit größeren Optionen für vermögende Patienten.“ (ACM 2016)
3.2 Hintergründe und Meilensteine der rechtlichen und politischen Entwicklungen zwischen 1995 und 2018
3.2.1 1995: Gutachten des BfArM vom November
Ein Gutachten des BfArM vom 2. November 1995 auf Anforderung der Bundesregierung, ist die Grundlage für die Beantwortung einer kleinen Anfrage der PDS, Vorläuferin der im Jahr 2005 gegründeten Partei Die Linke, im Deutschen Bundestag (Deutscher Bundestag 1995).
„So entbehrt sowohl eine unkritische Euphorie hinsichtlich der therapeutischen Möglichkeiten von Cannabis bzw. THC der Grundlage wie andererseits eine auf entgegengesetzten Positionen resultierende generelle Ablehnung mit der Behauptung, es gebe „auf jedem Gebiet bessere therapeutische Alternativen.“ (Goedecke u. Karkos 1996)
3.2.2 1997: erste Fachtagung „Cannabis und Cannabinoide als Medizin“
Am 12. April 1997 wurde die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin e.V. in Köln gegründet. Am 22. November 1997 führte sie die erste Fachtagung im deutschen Sprachraum zum Thema „Cannabis und Cannabinoide als Medizin“ durch.
In einem Grußwort von Dr. Ingo Flenker, Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe und Vorsitzender des Ausschusses Sucht und Drogen der Bundesärztekammer, zur Tagung hieß es:
„Der erwiesenermaßen nützliche medizinisch-therapeutische Einsatz von Cannabis muss legal möglich werden, damit die derzeitige Kriminalisierung von Ärzten und Patienten endlich aufhört.“ (Flenker 1997)
3.2.3 1998: Verschreibungsfähigkeit von Dronabinol/THC
Der Sachverständigenausschuss für Betäubungsmittel empfahl auf seiner Sitzung am 29. Januar 1996 der Bundesregierung eine Umstufung von Dronabinol/THC in die Anlage 3 BtMG. Am 1. Februar 1998 wurde der Cannabiswirkstoff Dronabinol in Deutschland von der Anlage 2 in die Anlage 3 des Betäubungsmittelgesetzes umgestuft, sodass dieses Cannabinoid von da an verschreibungsfähig wurde. Da eine Behandlung mit Dronabinol von den Krankenkassen nicht erstattet wurde, hatten nur wenige Patienten Zugang zu einer solchen Therapie. Zunächst musste Dronabinol in Kapselform (Marinol®) aus den USA aufwendig importiert werden. Später produzierten zunächst die Firma THC Pharm und schließlich die Bionorica AG Dronabinol zur Abgabe als Rezepturarzneimittel in Apotheken. Im August 2014 kaufte die Bionorica AG das Unternehmen THC Pharm (THC Pharm). Im Mai 2019 kaufte schließlich der kanadische Hersteller Canopy Growth Corporation für 225,9 Millionen Euro das Cannabisgeschäft des Phytopharmaherstellers Bionorica.
3.2.4 1998: Frankfurter Resolution
Bei der Tagung „Medical Marijuana“ in Frankfurt vom 2. bis 4. Dezember 1998 haben die AIDS-Hilfen und die Hessische Gesellschaft für Demokratie und Ökologie die Frankfurter Resolution zur medizinischen Verwendung von Marihuana vorgestellt.
Die Resolution besagt:
„In der Erkenntnis, daß zur Heilung Kranker und zur Minderung ihres Leids alle menschenwürdigen medizinischen Möglichkeiten auszuschöpfen sind, fordern wir den Bundestag auf:
1. Die medizinische Nutzung von Marihuana zu erlauben,
2. zu therapeutischen Zwecken auch die rauchbare Anwendung natürlichen Marihuanas zu gestatten,
3. die medizinische Verwendung von Marihuana begleitend wissenschaftlich zu erforschen und diese Forschung zu fördern.“ (ACM-Mitteilungen 2017)
3.2.5 1999: Verfassungsbeschwerde
Am 14. Dezember 1999 haben acht Mandanten von Lorenz Böllinger, Professor an der Juristischen Fakultät der Universität Bremen, und Robert Wenzel, Assistent von Prof. Böllinger, mit Unterstützung der ACM e.V. vor dem Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde gegen das Verbot der medizinischen Verwendung von Cannabis eingelegt. Die Mandanten litten an verschiedenen Erkrankungen (Multiple Sklerose, HIV-Infektion, Hepatitis C, Migräne, Tourette-Syndrom, Epilepsie). Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Januar 2000 kommentierte Lorenz Böllinger wie folgt:
„Die Entscheidung zeigt trotz der Nichtannahme, dass das BVerfG die Option einer medizinischen Behandlung mit Cannabis ernst nimmt und bemüht ist, dafür einen gangbaren Weg aufzuzeigen. Sie bindet Verwaltung und Gerichte für zukünftige Verfahren. Patienten können nunmehr über ihre Behandler entsprechende Anträge beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte stellen, welches die Maßgaben des BVerfG berücksichtigen muss. Gegebenenfalls muss eine ablehnende Entscheidung dann vor den Verwaltungsgerichten angefochten werden. Im äußersten Falle bleibt eine erneute Verfassungsbeschwerde.“ (ACM-Mitteilungen 2017)
3.2.6 2000: Unterstützung durch den Petitionsausschuss des Bundestages
Am 28. Juni 2000 befürwortete der Petitionsausschuss des Bundestages eine Petition der Selbsthilfegruppe Cannabis als Medizin in Berlin und der ACM e.V. für die Möglichkeit einer medizinischen Verwendung natürlicher Cannabisprodukte und einzelner Cannabinoide. Am 6. Juli 2000 folgte der Deutsche Bundestag der Empfehlung des Petitionsausschusses und überwies die Petition „zur Berücksichtigung“ an die Bundesregierung. Mit den Stimmen der Ausschussmitglieder von PDS, Bündnis 90/Die Grünen und SPD, gegen die Stimmen der CDU/CSU und bei Enthaltung der FDP hatte der Petitionsausschuss sich für die Petition ausgesprochen, weil das vorgebrachte Anliegen begründet sei. Der Ausschuss kam zu dem Ergebnis, dass Cannabis vielen Erkrankten hilft, „ihre Erkrankungen zu heilen bzw. zu lindern und ihr Leben wieder lebenswert zu gestalten“.
Die Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Gesundheit, Christa Nickels (Bündnis 90/Die Grünen), hat im Namen der Bundesregierung am 28. September 2000 dem Petitionsausschuss auf die Petition geantwortet. In ihrem Schreiben hieß es:
„Aus der Sicht des Bundesministeriums für Gesundheit wird der Einsatz von Arzneimitteln auf der Basis von Cannabis befürwortet. Ordnungsgemäß ist dies nur möglich, wenn dabei die arzneimittelrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden.
„Zusammenfassen kann festgestellt werden, dass bereits jetzt Arzneimittel mit den Cannabiswirkstoffen Dronabinol und Nabilon auf ärztliche Verschreibung zur Verfügung gestellt werden können. Die Bereitstellung von Arzneimitteln mit standardisiertem Cannabisextrakt wird vorbereitet. Somit besteht für die arzneiliche Anwendung von ungeprüften Cannabisprodukten auf der Grundlage von § 3 Abs. 2 BtMG kein Bedarf mehr, auch wenn es im Einzelfall nachvollziehbar ist, dass schwerkranke Patienten diesen Wunsch äußern. Es ist jedenfalls nicht gewünscht, dass diese Menschen strafrechtlich verfolgt werden.“ (ACM-Mitteilungen 2017)
3.2.7 1999–2002: THC Pharm und Bionorica stellen Dronabinol zur Abgabe durch Apotheken her
Die Bock-Apotheke in Frankfurt am Main bot seit Januar 1999 Dronabinol/THC für etwa ein Viertel des Preises an, der in deutschen Apotheken für das US-amerikanische Dronabinol-Präparat Marinol® gezahlt werden musste. Dronabinol wurde in der Apotheke in Zusammenarbeit mit der Firma THC Pharm hergestellt und konnte so als apothekenübliche Rezeptur abgegeben werden. Im Juli 2000 hat das Unternehmen die Erlaubnis erhalten, andere Apotheken in Deutschland mit Dronabinol zu beliefern. Zunächst betrug der Preis 1.200 DM pro 1.000 mg. THC wurde zunächst halbsynthetisch durch Isomerisierung aus Cannabidiol (CBD), das aus Faserhanf extrahiert wurde, gewonnen.
Die Cannabinoidsparte der Bionorica AG (Neumarkt) beliefert seit 2002 ebenfalls Apotheken mit Dronabinol, die daraus nach entsprechenden Rezepturvorschriften des deutschen Apothekerverbandes Medikamente (Kapseln, Tropflösungen) herstellen können. Die Konkurrenz führte zu Preissenkungen für Dronabinol. Diese Sparte gehört heute zum internationalen Unternehmen Canopy Growth.
3.2.8 2001: Vorschlag der ACM zur Straffreiheit von Cannabispatienten
Die Vorstandsvorsitzenden der ACM e.V. und der International Association for Cannabinoid Medicines (IACM) haben am 24 Juni 2001 alle Bundestagsabgeordneten angeschrieben und gebeten, sich für einen neuen Paragrafen im Betäubungsmittelgesetz, einen § 31b, einzusetzen, der es Richtern und Staatsanwälten ermöglichen würde, bei medizinischer Verwendung sonst illegaler Cannabisprodukte in Analogie zum § 31a BtMG unter bestimmten Bedingungen von der Strafverfolgung abzusehen, da auch bei der medizinischen Verwendung von Cannabis von einer geringen Schuld, wenn überhaupt, ausgegangen werden kann und zudem kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht.