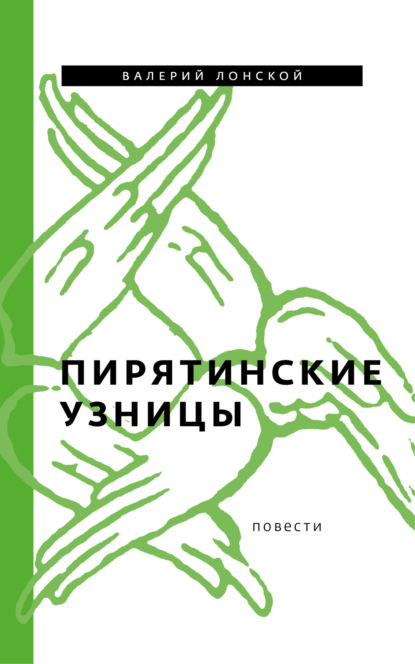- -
- 100%
- +
„Mir wird übel bei dem Gestank“, entgegnete er knapp und ehrlich.
„Weed riecht wohl besser oder was?“, keifte sie ihn an. Kritik hatte sie noch nie gut vertragen. Die Tatsache, dass sie müder war, als sie aussah, trug nicht unbedingt zur Besserung bei. Ebenso wenig wie der Fakt, dass David ohnehin bereits ziemlich angefressen von der ganzen Situation war und die Keiferei seiner Mutter genauso wenig vertrug, wie sie seine Kritik.
„Du hängst dich echt ewig daran auf, oder? Als hättest du es früher nie auch nur ausprobiert. Ach ja, und zu deiner Information. Nein, tut es nicht“, erwiderte er und rollte mit den Augen.
„Selbstverständlich habe ich es ausprobiert und gemerkt, dass es nichts Gutes mit sich bringt“, erklärte sie ihm mit ruhiger Stimme. Dass sie dennoch aufgebracht war, konnte sie jedoch nicht verstecken.
„Aber deine Zigaretten sind besser oder was?“, stichelte er zurück. Genervt stieß sie den Qualm ihrer Kippe aus.
„Im Gegensatz dazu sind sie erstens legal, und zweitens lassen sie dich keine rosaroten Elefanten sehen, die dir nach den ersten paar Malen auf deiner Schädeldecke anfangen, herumzutanzen“, antwortete sie ihm nun in einem nicht mehr ganz so ruhigen Ton.
„Wirklich gesünder oder weniger schädlich sind sie trotzdem nicht. Auch nicht für andere, die den ekelhaften Rauch einatmen müssen.“ Damit war die Diskussion beendet, und keiner von beiden sprach mehr über das Thema. Kurze Zeit später drückte sie angegiftet ihre, nur zur Hälfte aufgerauchte, Zigarette im Aschenbecher des Autos aus. Während der gesamten Hinfahrt über verkniff sie es sich, eine weitere anzustecken und somit die Diskussion von neuem aufzurollen. Lange würde es ja nicht mehr dauern, dann konnte sie so oft und so viel quarzen, wie sie wollte, ohne sich weitere Kommentare oder sonstige Belehrungen gefallen lassen zu müssen.
„Was wirst du in den Wochen, die ich weg bin machen?“, fragte David und schloss sein Fenster wieder.
„Nun ja. Ich werde arbeiten müssen.“
„Das meine ich nicht.“
Faye überlegte einen Augenblick, ehe sie ihm antwortete.
„Ich möchte einiges im Haus verändern“, sagte sie vorsichtig.
„Okay, und was möchtest du verändern?“, fragte David überrascht.
„Bobbys altes Zimmer. Es ist jetzt schon drei Jahre her, dass er nicht mehr bei uns ist. Langsam, denke ich, ist es an der Zeit, damit abzuschließen.“
Ich hab mein Zimmer aufgeräumt, damit Mommy nicht wieder so schimpft. Gefällt es dir, David?
Da war er wieder. Sein Alptraum, der ihm nicht aus dem Kopf gehen wollte. Wie eine lästige Fliege surrte er durch seinen Kopf, ohne Aussicht darauf, je wieder von dort zu verschwinden.
„Was genau schwebt dir vor?“, fragte er neugierig.
„Ich dachte, ich könnte seine Sachen einem Waisenhaus spenden und es neu einrichten. Als Gästezimmer, verstehst du?“, sagte sie, unsicher darüber, wie ihr Sohn diese Idee aufnehmen würde. Für einen kurzen Moment hatte sie vergessen, dass das ohnehin keine Rolle spielen würde.
„Ja, ich verstehe. Mir gefällt es.“
Mehr zufällig als gewollt trafen sich ihre Blicke kurzzeitig, und sie lächelten einander an. Einen Moment lang war die Welt ein Stück weit in Ordnung.
„Das freut mich. Wir könnten es vielleicht neu tapezieren und anstreichen. Was hältst du davon?“, schlug sie vor.
„Finde ich gut“, versicherte David ihr mit einem Anflug von Vorfreude auf die Zeit nach der Sommerschule. Vielleicht würde doch noch alles gut werden, dachte er sich zufrieden. Doch anders als David freute sich Faye nicht über ihre Pläne. Im Gegenteil. Innerlich hasste sie sich dafür und verteufelte ihr vorschnelles Mundwerk. Sie konnte es sich nicht erlauben, auf den letzten Metern einzuknicken und sich für das zu schämen, was sie tat. Aber schließlich musste sie irgendwie den Schein auf Veränderung und Besserung wahren. Etwas anderes blieb ihr nicht übrig. Sie hatte es begonnen und würde es nun auch zum Ende bringen. In etwa anderthalb Stunden wäre es vorbei. Dann wäre ihr Sohn David nicht länger ihr Problem. Er würde für niemanden mehr ein Problem darstellen können, wenn er erst einmal dort angekommen war. Schnell verwarf sie ihren Gedanken wieder und fokussierte sich wieder auf die Straße.
„Tu mir den Gefallen und kümmere dich um Zoe, falls sie von zuhause weg muss, weil ihr Vater wieder anfängt, das Haus auseinanderzunehmen“, bat er sie mit aufrichtiger Sorge.
„Wenn ich nicht da bin, hat sie niemanden, der sich ernsthaft um sie kümmert.“
Faye nickte ein paar Mal.
„Mach dir keine Sorgen, ich werde ihr garantiert nicht die Tür vor der Nase zuknallen, wenn sie verzweifelt ist und Hilfe braucht“, versicherte sie ihm. Hundertprozentig sicher war er sich nicht, ob es auch wirklich so kommen würde oder ob sie ihr tatsächlich ihre Hilfe anbieten würde. Doch für den Moment blieb ihm nichts anderes übrig, al ihr zu glauben. Während er sich kurz, aber ehrlich, bedankte, schenkte er sich den letzten Rest Kaffee aus der Kanne ein. In einem Zug trank er die Kappe aus, in der sich nicht mehr als ein Bodensatz befand und schraubte sie wieder auf die Thermoskanne. Ein Tropfen kalter Kaffee lief aus dem Deckel über das silberne Edelstahlgehäuse und landete auf Davids Zeigefinger. Gelassen wischte er ihn an seiner hellgrauen kurzen Sporthose ab und legte die Kanne in das Fach an seiner Tür.
„Wie lange sind wir noch unterwegs?“
„Etwa eine Stunde, wenn wir Glück und keinen Stau mehr haben.“
Er warf einen prüfenden Blick auf seine Armbanduhr. Es war eine schwarze Uhr mit ebenfalls schwarzem Lederarmband und Ziffernblatt. Das Einzige, was nicht schwarz war, war der rote Sekundenzeiger, welcher bereits etwas zitterte. Auf dem Ziffernblatt waren, anstelle der normalen, arabischen Zahlen, alte römische Zahlen zu sehen. Die Uhr war ein Geburtstagsgeschenk seiner ehemaligen Freundin, die sie ihm als hochwertig und teuer angepriesen hatte. Kurz nach ihrer Trennung erfuhr er jedoch von Trae, der auch sie mit dem nötigen Stoff versorgt hatte, dass die Uhr einfach aus einem Ramschladen um die Ecke stammte, und dort grade einmal die stolze Summe von fünf Dollar wert war. Doch es kümmerte ihn kein Stück weit. Selbst, wenn sie die Uhr aus einem Müllcontainer gefischt und lediglich etwas gesäubert hätte, würde er sie tragen, schließlich gefiel sie ihm ja. Geld war für ihn nie ein wichtiger Faktor, wenn es um Geschenke oder andere Gegenstände ging. Ob etwas viel oder wenig kostete war irrelevant für seine Sicht darauf, ob es ihm gefiel oder nicht.
Die Zeiger zeigten elf Uhr achtundvierzig an. Mittlerweile waren sie seit bereits etwa zwei Stunden unterwegs.
„Wieso diese Schule, Mom? Ich hätte doch auch auf eine Modernere in der Nähe gehen können. Die Colleges in Sacramento bieten doch auch Kurse über die Sommerferien an. Die Saint Mary bietet eine gute Sommerakademie an, meinte Trae. Er musste selber schon einmal dorthin“, berichtete er ihr.
„Das mag sein, aber die Lauriea Summer School ist nun mal etwas Besonderes. Dadurch, dass alle Schüler die Zeit über dort wohnen werden, habt ihr auch mehr Freizeit als auf einer normalen Sommerschule. Außerdem war es die Einzige, die deine Anmeldung noch so kurzfristig entgegengenommen hat und so freundlich war, dich trotz des späten Zeitpunktes noch anzunehmen“, erklärte sie ihm, ohne die wirklichen Beweggründe für ausgerechnet diese Wahl zu erläutern. Aber er akzeptierte ihre Antwort kommentarlos. Sein angeschwollenes Auge pochte sanft im Takt seines Pulses. Noch konnte er nicht ahnen, was die Wände der Gebäude inmitten des Waldes für ihn und alle anderen nichtsahnenden Jugendlichen bereithielten.
3
Gegen zehn Minuten vor eins, fast exakt eine Stunde später, rollte der schwarze Chevrolet Orlando mit gedrosseltem Tempo in die letzte Straße des Dorfes namens Reggieland, das sich etwa eine halbe Stunde nördlich von Weed befand. Die Häuser, an denen sie vorbeifuhren, unterschieden sich kaum voneinander. Trüb und grau standen sie säuberlich, in gegenüberliegenden Reihen, parallel zueinander. Man konnte meinen, man befände sich in einem der ersten Farbfilme, in denen selbst die grellsten Farben nicht mehr als ein Farbstich zu sein schienen. Die Bewohner hingegen waren alles andere als grau und trüb. Viele Familien saßen auf den Terrassen beisammen und frühstückten gemeinsam. Kinder tollten durch die Gärten, jagten ihren Bällen nach oder malten Bilder mit Kreide auf die Pflastersteine ihrer Auffahrt. Es war eben genau so, wie man sich nun mal ein Dorf an einem idyllischen und warmen Sonntag zu Beginn der Sommerferien vorstellen würde. Das Auto, in welchem sich Faye und David befanden, kam vor einem Schild am Ende der Straße zum Stehen. Ein weites goldenes Rapsfeld erstreckte sich vor ihnen, als wäre es aus einem Bilderbuch entsprungen. Das Schild zu ihrer Rechten war weiß angestrichen worden. Die herunterlaufenden Farbtropfen waren getrocknet und erhoben sich von dem Holz wie die Akne auf dem Gesicht eines Teenagers.
„Lauriea Summer School“, stand darauf in schwarzen Buchstaben geschrieben. Jedoch war von einer Schule, geschweige denn von irgendeinem Gebäude, welches kein normales Wohnhaus war, weit und breit nichts zu sehen. Hinter dem Schild befand sich ein steiniger und erdiger Weg, welcher gradewegs in den Wald führte, der etwa zweihundert Meter entfernt vom freudigen Dorfleben begann.
„Da wären wir“, verkündete Faye und begutachtete zuerst das Schild und dann den Wald.
„Bist du dir sicher?“, fragte David ungläubig und musterte die Umgebung. Alles in dem Dorf wirkte so natürlich und verständlich, dass es ihm fast wie eine Lüge vorkam, die ihnen vorgespielt wurde.
„Natürlich. Dort steht es doch. Lauriea Summer School.“
„Und wo ist sie dann bitte?“
„Ah, sieh mal da ist jemand“, bemerkte seine Mutter den Mann, der aus dem Wald herauskam und ihnen zuwinkte. Nun sah auch David ihn. Wie auf Wolken spazierte der junge Mann den Weg zu ihrem Auto entlang. Das laute Geräusch der zufallenden Autotüren verzerrte die Idylle und Ruhe des Dorfes für einen Augenblick. Die Familie, die scheinbar das letzte Haus am Straßenende bewohnte, blickte empört von ihrem reich gedeckten Tisch auf. Pancakes mit Sirup und Früchten stapelten sich über gebratenen Speck, frisch gekochten Eiern, altem Cheddar und diversen anderen Köstlichkeiten, deren Geruch David in die Nase stieg.
Mittlerweile hatte der Mann die Hälfte der Strecke zurückgelegt und war nun durchaus besser zu erkennen. Trotz der Hitze hatte er die untersten zwei Knöpfe seines rosa Polohemdes zugeknöpft und trug eine lange, verblichene Jeanshose. Seine braunen Haare waren zu einem klassischen Undercut frisiert worden und passten wie die Faust aufs Auge zu seinem ebenfalls braunen Vollbart. An seinem rechten Arm trug er, zusätzlich zu einer dunklen Uhr, mehrere schwarze Leder- und Stoffarmbänder. David öffnete den Kofferraum des Autos und holte seinen Koffer und seinen Rucksack daraus hervor. Mit einem lauten Knall schloss er ihn, was einen weiteren bösen Blick der Familie hinter ihm zur Folge hatte.
„Hallo. Ich bin Mr. Brenner, ich bin von der Schule“, stellte der Mann sich aus knapp zehn Meter Entfernung vor und deutete auf das weiße Schild.
„Ich bin Ms. Williams“, entgegnete Faye freundlich und reichte ihm die Hand.
„Ist mir eine Freude“, schmeichelte er und schenkte ihr ein warmes Lächeln, das sie erwiderte.
„Du bist vermutlich David, nicht wahr?“, fragte er und reichte auch ihm die Hand.
„Ja, Sir“, antwortete er höflich und schüttelte seine Hand. Sein Händedruck war fest und hinterließ weiße Flecken auf Davids Hand.
„Haben Sie eine gute Fahrt gehabt? Ich hoffe, die Wegbeschreibung war nicht allzu katastrophal. Es verfahren sich leider andauernd Eltern auf dem Weg hierher.“
„Tatsächlich?“, fragte Davids Mutter überrascht.
„Oh ja, leider schon. Meist haben wir fünf bis zehn Schüler weniger, als uns eigentlich angekündigt wurden, weil viele einfach nicht herfinden“, erklärte Mr. Brenner.
„Nun, also an Ihrer Wegbeschreibung liegt es jedenfalls nicht, wenn Sie mich fragen“, versicherte Faye ihm mit einem zuckersüßen Lächeln auf den Lippen. David drehte sich der Magen um. Er kannte ihr Lächeln genau und wusste, dass sie es meistens nur dann aufsetzte, wenn sie etwas haben wollte. Und in diesem Fall schien es der attraktive Mr. Brenner zu sein, den sie wollte.
„Verzeihung, Mr. Brenner?“, unterbrach der offensichtliche Familienvater des Hauses hinter ihnen die fröhliche Stimmung.
„Ja, Mr. Clarke?“, entgegnete er dem leicht korpulenten Mann, der ein beige, blau gestreiftes Leinenstrukturhemd trug.
„Ich möchte Sie freundlichst daran erinnern, dass es hier auch Bürger gibt, die ihren wohlverdienten Sonntag mit einer gewissen Ruhe verbringen möchten“, legte ihm Mr. Clarke nahe.
„Aber natürlich, ich bitte um Verzeihung. Ich versichere Ihnen, dass ich mich gleich wieder auf den Weg machen werde“, entschuldigte sich Mr. Brenner aufrichtig.
„Tun Sie das. Und Sie, gnädige Frau, bitte ich auch darum, sich möglichst leise zu entfernen“, wandte er sich nun Ms. Williams zu. Genervt rollte sie mit den Augen und stöhnte leise auf. Innerlich dankte David dem schlecht gelaunten Mann, der sich grade ein gewaltiges Stück des Cheddars abschnitt und genüsslich verspeiste, dass er den Verführungsversuch seiner Mutter unterbrochen hatte.
„Bis dann, mein Großer.“
Sie nahm ihn herzlich in den Arm und drückte ihn fest an sich. Er erwiderte ihre Umarmung und drückte sie ebenfalls fest.
„Pass auf dich auf.“
„Werde ich Mom, keine Sorge“, versprach er ihr.
„Ich ruf dich an, in Ordnung?“
Faye nickte in seine Schulter hinein.
„Ich hab dich lieb.“
Zum ersten Mal seit Jahren hatte er ihr das wieder sagen können, ohne dass es sich wie eine Lüge anfühlte.
„Ich dich auch“, erwiderte sie und drückte ihn noch einmal an sich, bevor sie ihn losließ.
„Bis dann, Mom.“
„Machs gut“, verabschiedete sie sich und drehte sich zu ihrem Auto um. Ihr Blick blieb an Mr. Clarke hängen.
„Haben Sie ein Problem?“, fragte er angesäuert.
„Wenn ich mir Sie so ansehe, Mister, merke ich eigentlich eher, dass ich ziemlich wenig Probleme habe, und es Menschen gibt, die es viel schlimmer haben“, entgegnete sie schlagfertig.
„Ein schönes Leben Ihnen noch, Mr. Clarke. So kurz es bei Ihren vermutlich längst verfetteten Organen auch sein wird.“
Empört stand er auf und blähte wutentbrannt seine Wangen auf, um etwas Schlagkräftiges zu erwidern. Doch ehe ihm ein passender Konterspruch eingefallen war, saß Faye schon in ihrem Chevrolet und startete den Motor. Sein Gesicht färbte sich vor Scham und Zorn gleichermaßen rot und stellte einen idealen Kontrast zu seinen grauen Koteletten dar, die ihm bis auf Höhe seiner Unterlippe reichten. David konnte sich das Grinsen nicht verkneifen, als Mr. Clarke sich auch, nachdem seine Mutter bereits weggefahren war, nicht setzen wollte. Beleidigt stand er an dem überfüllten Tisch auf seiner Terrasse und blickte ihr nach, als ob er immer noch etwas erwidern könnte und es jeden Moment aus ihm herausplatzen würde.
„Das findest du lustig, nicht wahr, du Bengel?“, meckerte er David an.
„Wenn ich ehrlich bin, schon“, gab er offen zu und musste noch stärker grinsen.
„Na warte, du Rotzlöffel!“
Er riss die Serviette aus dem Ausschnitt seines Hemdes und warf sie zornig auf seinen Teller. Doch bevor er den Tisch überhaupt wirklich verlassen konnte, ging Mr. Brenner dazwischen.
„Beruhigen Sie sich, Mr. Clarke. Sie wissen doch, wie das mit den Kindern ist. Sie denken nicht nach und sind nicht wirklich schlau, deswegen kommen sie ja zu uns. Ein gestandener Mann, wie Sie, steht da doch drüber, oder nicht?“ Einen kurzen Moment überlegte er, dann schien er sich wieder zu beruhigen.
„Sie haben natürlich Recht. Ich lasse mich nicht auf das Niveau dieser ungebildeten Proleten und Nichtskönner herab.“
Sein Gesicht nahm wieder eine normale gesunde Farbe an.
„Das weiß ich doch. Guten Tag, Mr. Clarke“, verabschiedete sich Mr. Brenner und hob seinen Arm. Der nun wieder beruhigte Mr. Clarke tat es ihm gleich und wünschte ihm ebenfalls einen guten Tag, bevor er sich wieder zu seiner Frau und seinen beiden Kindern an den Tisch setzte. Keiner von ihnen hatte während der Auseinandersetzung etwas gesagt oder versucht Partei für ihn zu ergreifen. Umso erfreuter waren sie, als David gemeinsam mit Mr. Brenner in Richtung des Waldes ging, und sie in Ruhe ohne weiteren Zwischenfall ihr Frühstück beenden konnten.
4
„Meinten Sie das eben Ernst?“, fragte David leicht angesäuert, „Was Sie Mr. Clarke gesagt haben?“
Mr. Brenner trat einen Stein beiseite. Staub wirbelte um seine Schuhe. Man sah dem Weg an, dass es seit Tagen nicht geregnet hatte. Risse zeichneten sich auf dem sandfarbenen ausgetrockneten Boden ab.
„Dass Kinder wie du nicht sonderlich intelligent sind und nicht nachdenken?“
„Ja, so ungefähr war Ihre Wortwahl.“
„Ach, weißt du, David“, begann er und blieb vor ihm an der Waldgrenze stehen.
„Mit Mr. Clarke ist es wie mit jedem anderen Mann, der sich in seinem Stolz verletzt sieht. Sag ihnen wie toll sie sind und wie dumm man selber ist, und alles ist wieder in Ordnung“, erklärte er ihm. David kam neben ihm zum Stehen. Es musste ein lachhafter Anblick sein, wie er dort, mit Rollkoffer und Rucksack, vor dem Wald stand. Mit Sicherheit würde es ein perfektes Foto für die Kategorie: „Finde den Fehler“ in einem Rätselheft abgeben. Jedoch war nicht bloß sein Outfit, an einem Ort wie diesem, fehl am Platz. Er selbst gehörte ebenfalls nicht dorthin.
„Das war also reine Beschwichtigung? Sie halten mich nicht für zurückgeblieben oder chronisch dumm?“
„Es ist wie mit einem Baby, David. Wenn sie anfangen zu plärren, gibst du ihnen die Flasche und sie sind wieder ruhig. Leute wie Mr. Clarke, Rechtsanwälte, Professoren, Wissenschaftler, Ärzte. Sie alle sind auf einer höheren Bildungsstufe als wir beide und wollen auch so behandelt werden. Schließlich sind wir ja die Dummen, die sich immer wieder an sie wenden, wenn wir etwas nicht wissen und uns helfen lassen müssen. Dass sie sich ebenfalls an Elektriker, Tischler und Bauarbeiter wenden, weil sie etwas nicht können, ist ihnen wiederum egal. Schließlich sind sie ja trotzdem die Dummen, die keine Akademiker mit hohen Abschlüssen und vortrefflicher Bildung sind. Verehrung und überschwängliches Lob sind ihre Flasche. Verstehst du, was ich meine?“
„Natürlich verstehe ich.“
Mr. Brenner setzte ein bescheidenes Lächeln auf.
„Dummheit ist nicht wenig wissen, auch nicht wenig wissen wollen, Dummheit ist, glauben genug zu wissen.“
„Und wer Konfuzius zitiert, ist noch lange nicht weise“, sagte David schmunzelnd.
„Da hast du wohl Recht“, stimmte Mr. Brenner ihm lachend zu.
„Entschuldigen Sie, dass ich frage, Sir. Aber ich habe die Schule nirgendwo gesehen.“
„Nun ja, das liegt daran, dass sie im Wald liegt und von den hohen Bäumen versteckt wird“, erklärte er und zeigte in den Wald hinein.
Die Schule war im Wald, und ein Mann ging neben dir her.
David erstarrte. Die Erinnerung traf ihn, wie der breit gestreute Schuss einer Schrotflinte. Der Kaffee, den er während der Fahrt getrunken hatte, schien sich seinen Weg nach draußen bahnen zu wollen und stieg ihm den Hals hoch.
„Ist alles in Ordnung?“, fragte Mr. Brenner verunsichert und sah ihn besorgt an. David griff an den rechten Flaschenhalter seines Rucksacks und holte eine Flasche stilles Wasser daraus hervor. Schnell öffnete er sie und nahm einen kleinen vorsichtigen Schluck daraus. Sein Magen entkrampfte sich ein wenig und nahm den bereits hochgestiegenen Kaffee widerwillig zurück.
„Ja, alles in Ordnung“, sagte er und versuchte sich nichts anmerken zu lassen, was ihm jedoch bei seiner bleichen Gesichtsfarbe nicht sonderlich gut gelang.
„Bist du sicher?“, fragte Mr. Brenner ein weiteres Mal. David nahm einen zweiten Schluck aus seiner Flasche und nickte bejahend.
„Wenn du meinst. Dann nehme ich aber deinen Koffer. Nicht, dass du mir gleich zusammenklappst.“
Er streckte die Hand aus, um Davids Koffer entgegenzunehmen. Ohne zu zögern, drückte er ihm den Griff des Trolleys in die Hand. Er atmete tief durch und wischte sich mit der Hand die Schweißperlen von der Stirn.
„Keine Sorge“, beruhigte Brenner David, „Im Wald scheint dir die Sonne nicht so stark auf den Kopf. Dort gibt es genügend Schatten.“
„Mr. Brenner?“
„Ja, David?“
„Aus welchem Grund hat man die Schule im Wald gebaut?“, fragte er. Wie angewurzelt verharrte er auf der Stelle und machte keine Anstalten, einen Fuß vor den anderen zu setzen.
„Die Frage ist verständlich. Komm mit. Wir sollten uns auf den Weg machen, bevor wir weichgekocht sind. Wir haben genügend Zeit, währenddessen alle deine Fragen zu klären.“
Er lächelte David ein weiteres Mal an und machte einige Schritte nach vorne.
„Ach ja. Eine Sache ist da noch. Die erste und wichtigste Regel, die du dir merken musst. Gehe niemals ohne jemanden in den Wald, der sich nicht darin auskennt“, mahnte er ihn.
Mit diesen Worten überschritt Mr. Brenner die Waldgrenze und wurde von den Schatten der riesigen Bäume um ihn herum verschluckt.
5
Nachdem er den ersten Schock halbwegs verdaut hatte, folgte er Mr. Brenner hinein in den dunklen, aber durchaus naturschönen, Wald. Mammutbäume, die gut achtzig Meter gen Himmel ragten, nahmen dem Waldboden einen großen Teil des Sonnenlichtes und hielten es in ihren Blättern fest.
Ein Ast knackte unter Davids Füßen. Brenner steuerte auf eine kleine Steigung zu, die sich einige Meter hinter dem Waldübergang befand.
„Pass auf. Der Boden ist sehr trocken und auch staubig. Man kann leicht wegrutschen und sich einen spitzen Ast in die Hand rammen, wenn man sich versucht abzufangen“, warnte er David.
„Ist das denn schon mal passiert?“, fragte David neugierig.
„Öfter, als du wahrscheinlich denkst.“
„Wie oft? Fünf Mal?“, riet er.
„Weit daneben.“
„Zehn?“
„Ab 23 hab ich aufgehört zu zählen. Wie viele genau es schon geschafft haben, weiß ich nicht“, erzählte er und begann die Steigung hinaufzugehen.
„23 von wie vielen?“, fragte David überrascht.
„Wie bitte?“
David hatte die Steigung nun auch erreicht.
„Wie viele Schüler haben Sie schon hier langgebracht?“
„Das wäre doch schon eine schöne Rechenaufgabe zum Einstieg oder?“, fragte Mr. Brenner amüsiert.
„Wie viele Schüler hat Mr. Brenner in seinen zehn Jahren als Lehrer schon durch den Wald geführt, wenn jedes Jahr 50 Schüler an die Sommerschule kommen?“
„Sie haben schon 500 Jugendliche in die Schule gebracht?“, fragte David erstaunt.
„Mehr oder weniger. Wie gesagt, das sind grobe Schätzungen. Viele der Kinder, die angemeldet werden, erscheinen oftmals nicht“, entgegnete er und blieb in einer Rechtskurve stehen, um auf David zu warten. Obwohl er weniger Gepäck zu tragen hatte, war er deutlich langsamer unterwegs als der gut 20 Jahre ältere Brenner, der den Anstieg mit fast verspielter Leichtigkeit genommen hatte.
„Warum nicht?“
Mittlerweile hatte er seinen Lehrer – jedenfalls für die nächsten Wochen – erreicht.
„Das hat verschiedene Gründe. Die Einen finden den Weg nicht her, die Anderen kommen einfach nicht, weil sie es sich anders überlegt haben. Nichts sonderlich Spektakuläres oder Außergewöhnliches.“
Mr. Brenner sah in den Wald hinein. Von ihrer Position aus konnte David sehen, dass der Wald rechts von ihm stark abflachte und beinahe in ein seichtes Tal hinüberging.
„Ich denke, es ist am sinnvollsten, wenn ich dir den Grund für die Lage der Schule hier erzähle.“
„Wie Sie wollen, Sir.“
„Dann setz dich. Wir müssen ohnehin gleich noch lange genug laufen“, sagte Brenner und deutete auf einen kleinen Vorsprung, der sich direkt vor ihnen befand. David setzte sich an die Kante und ließ seine Füße frei in der Luft baumeln. Gemächlich stellte Mr. Brenner den blauen Koffer ab und setzte sich neben David an den Rand des Vorsprungs.