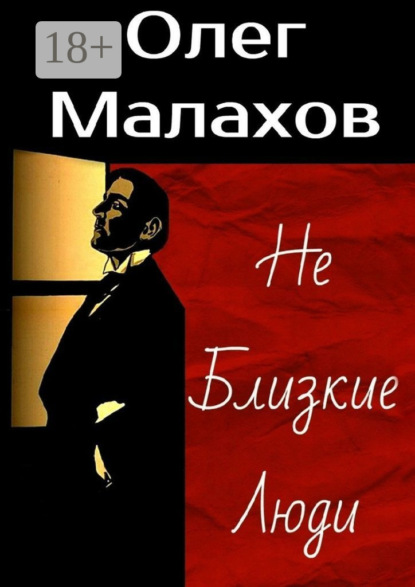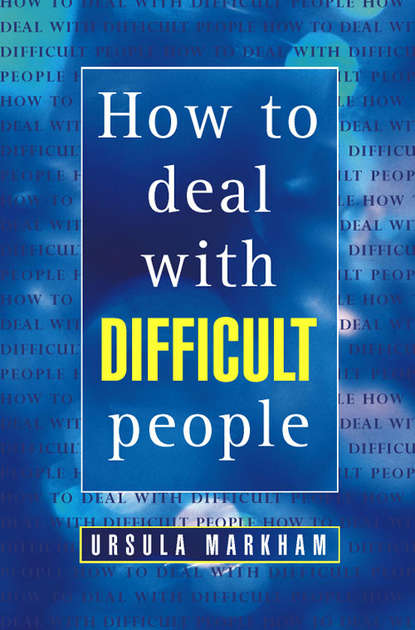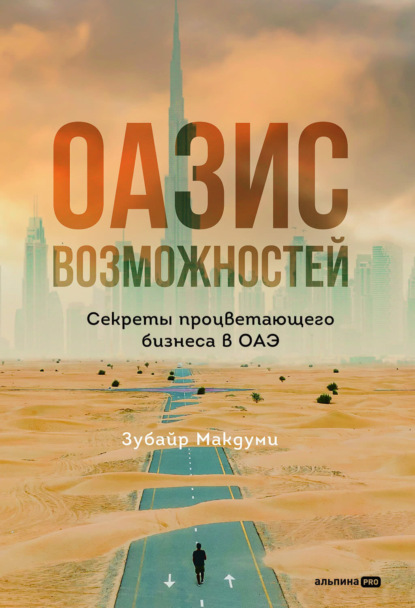Verfassungs- und Verwaltungsrecht für die Soziale Arbeit
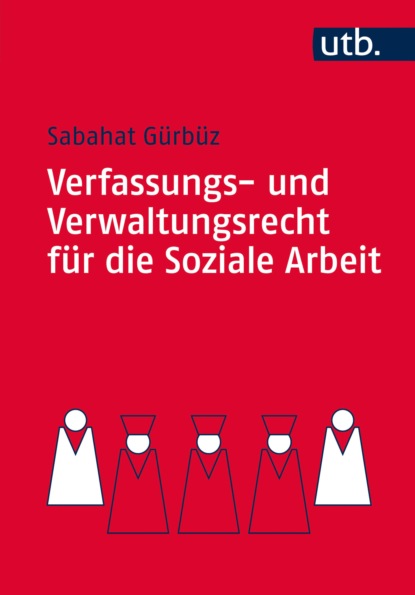
- -
- 100%
- +
Selbstverwaltung der Aufgaben
Bei der Selbstverwaltungsaufgabe nimmt die Kommune eine eigene Aufgabe wahr, bei der sie selbst entscheidet, ob, wann und wie sie sie erfüllt. Es handelt sich dann um eine freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (z. B. Errichtung von Schwimmbädern, Museen, Wirtschafts- und Wohnungsbauförderung). Ist die Gemeinde zur Erfüllung kraft Gesetzes verpflichtet (ob) und kann sie daher nur über das Wann und Wie entscheiden, spricht man von einer pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe (z. B. Katastrophenschutz, Errichtung von Kindergärten).
übernommene Aufgaben
Ob eine Auftragsangelegenheit oder eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung vorliegt, richtet sich nach der Organisationsstruktur der Aufgabenzuordnung in dem jeweiligen Bundesland. In einigen Bundesländern sind diese Aufgaben nach dem Landesrecht dem Staat zugeordnet, der sich zu ihrer Erfüllung lediglich der Kommune bedient. Man spricht von einer Auftragsangelegenheit (Kommune im Auftrag des Staates). In anderen Bundesländern ist die Aufgabe nach dem Landesrecht der Kommune als eigene zugewiesen. Sie heißt dann Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Erfüllung einer eigenen Aufgabe der Kommune). Die Kommunen unterliegen jeweils den Weisungen (wann und wie) des Staates (z. B. Flüchtlingsgesetz).
2.1.4 Verhältnis Bund/Länder
Bundesrepublik
Die Selbstverwaltung der Kommunen ist Ergebnis und konsequente Umsetzung der von der Verfassung vorgegebenen Struktur des Staates. Deutschland ist eine Bundesrepublik (Badura 2015; Wabnitz 2014), d. h., der Bund darf nur staatliche Befugnisse übernehmen, Aufgaben erfüllen oder Gesetze erlassen, wenn dies das Grundgesetz ausdrücklich zulässt (Badura 2015). Ansonsten liegt die Zuständigkeit bei den Ländern und deren Kommunen.
2.2 Demokratie (Art. 20 Abs. 1 und 2, 28 GG)
Das Demokratieprinzip (Katz 2010) ist als tragende Säule des gesellschaftlichen Zusammenlebens im Grundgesetz selbst definiert (siehe zum Begriff auch Schmidt, 2015a; Wabnitz 2014):

Art. 20 Abs. 2 GG
„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.“
Volk und Staatsgewalt
Das Volk ist der Träger der Staatsgewalt. Es übt die Staatsgewalt mittels von ihm gewählter Repräsentanten aus (Bethge/von Coelln 2011; Badura 2015). Dabei gilt das Mehrheitsprinzip.
Alles staatliche Handeln muss durch das Volk legitimiert sein, insbesondere muss es sich auf Gesetze zurückführen lassen. Ein wesentliches Mitwirkungsrecht ist daher die regelmäßige Wahl der Gesetzgebungsorgane auf Bundes- und Landes- sowie auch auf kommunaler Ebene. Damit verbunden, wenn auch nur mittelbar über die Stimmverhältnisse im Bundestag bzw. Landtag, ist der Einfluss auf die Bildung der Regierung als Exekutive. Die Regierungsmehrheit beruht auf der Anzahl der Abgeordneten der eigenen Fraktion im Parlament und damit auf dem Abstimmungsverhalten des Volkes bei den Wahlen zur Legislative. Die dritte Staatsgewalt, die Rechtsprechung, verkündet ihre Urteile schließlich im Namen des Volkes.
Mehrheitsprinzip und Minderheiten
Wer Strukturen und Regelungen ändern will, muss überzeugen und braucht demokratische Mehrheiten. Ein Diktat eines Einzelnen oder einer Minderheit ist nicht gewünscht und ausgeschlossen. Umgekehrt benötigt die Minderheit Schutz vor der Mehrheit, denn auch die Minderheit soll gehört werden und muss die Möglichkeit haben, sich zu entfalten. Denn nur so hat wirklich das gesamte Volk ein Mitspracherecht, das notwendig ist, damit Demokratie lebendig bleibt (Bethge/von Coelln 2011; Badura 2015; zum Begriff: Schmidt 2015a).
2.3 Sozialstaat (Art. 20 Abs. 1, 28 Abs. 1 GG)
Deutschland ist ein Sozialstaat. Das Grundgesetz legt dies als Staatszielbestimmung fest (Bethge/von Coelln 2011).
Zielsetzung
Der Sozialstaat ist darauf gerichtet, soziale Sicherheit und Gerechtigkeit herzustellen und zu erhalten. Der Staat ist mitverantwortlich für den Ausgleich sozialer Unterschiede zwischen den Bürgern und verpflichtet, in sozialen Notlagen Hilfe zu leisten (Katz 2010). Gemeint ist damit allerdings keine entwürdigende Totalversorgung, sondern Hilfe zur Selbsthilfe (Katz 2010; Badura 2015).
Soziale Sicherheit und soziale Gerechtigkeit (hierzu ausführlicher: Degenhart 2014) sind also nicht nur politische Schlagworte. Sie sind zentrale Vorgaben des Grundgesetzes. Was dies im Einzelnen bedeutet, ergibt sich aus der Auslegung des Grundgesetzes. Zuständig dafür ist das Bundesverfassungsgericht (Ipsen 2014a). Will man also den Inhalt des verfassungsrechtlichen Sozialstaatsprinzips näher erfassen, ist es notwendig, die einschlägige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hinzuzuziehen.
2.3.1 Grundprinzipien der sozialen Sicherung nach dem Bundesverfassungsgericht
Das Bundesverfassungsgericht hat bestimmte Prinzipien des Sozialstaats herausgearbeitet, die die Vorgaben des Grundgesetzes näher ausgestalten (Ipsen 2014a; Wabnitz 2014).
Ziele des Sozialstaates


Entscheidung „Ausgleich der Sozialen Gegensätze“ (BVerfGE 22, 180, Urteil vom 18.07.1967):
„Wenn Art. 20 Abs. 1 GG ausspricht, daß die Bundesrepublik ein sozialer Bundesstaat ist, so folgt daraus nur, daß der Staat die Pflicht hat, für einen Ausgleich der sozialen Gegensätze und damit für eine gerechte Sozialordnung zu sorgen; dieses Ziel wird er in erster Linie im Wege der Gesetzgebung zu erreichen suchen.“
Entscheidung „Verbot der KPD“ (BVerfGE 5, 85, Urteil vom 17.08.1956):
„Eine Partei ist nicht schon dann verfassungswidrig, wenn sie die obersten Prinzipien einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung (vgl. BVerfGE 2, 1 [12 f.]) nicht anerkennt; es muß vielmehr eine aktiv kämpferische, aggressive Haltung gegenüber der bestehenden Ordnung hinzukommen. Eine Partei ist schon dann verfassungswidrig, wenn sie eine andere soziale und politische Ausprägung der freiheitlichen Demokratie als die heutige in der Bundesrepublik deshalb erstrebt, um sie als Durchgangsstadium zur leichteren Beseitigung jeder freiheitlichen demokratischen Grundordnung überhaupt zu benutzen, mag diese Beseitigung auch erst im Zusammenhang mit oder nach der Wiedervereinigung stattfinden sollen.“
Entscheidung „Numerus Clausus Entscheidung“ (BVerfGE 33, 303, Urteil vom 03.05.1972):
Anm. d. Autorin: Das BVerfG stellte zunächst fest, dass aus dem Sozialstaatsprinzip kein Anspruch auf eine Ausbildungsstätte erwächst. Wenn der Staat aber Ausbildungseinrichtungen schafft, dann hat jeder einen Anspruch auf chancengleiche Zulassung. Dies folge aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 3 GG) i. V. m. dem Grundrecht der Berufsfreiheit (Art. 12 GG) und dem Sozialstaatsprinzip.
Aus den Gründen: „Aus dem in Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG gewährleisteten Recht auf freie Wahl des Berufes und der Ausbildungsstätte in Verbindung mit dem allgemeinen Gleichheitssatz und dem Sozialstaatsprinzip folgt ein Recht auf Zulassung zum Hochschulstudium. Dieses Recht ist durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes einschränkbar. Absolute Zulassungsbeschränkungen für Studienanfänger einer bestimmten Fachrichtung sind nur verfassungsmäßig, a) wenn sie in den Grenzen des unbedingt Erforderlichen unter erschöpfender Nutzung der vorhandenen Ausbildungskapazitäten angeordnet werden und b) wenn die Auswahl und Verteilung der Bewerber nach sachgerechten Kriterien mit einer Chance für jeden an sich hochschulreifen Bewerber und unter möglichster Berücksichtigung der individuellen Wahl des Ausbildungsortes erfolgen.“


Entscheidung „Entschädigung von Kriegsfolgeschäden“ (BVerfGE 27, 253, Beschluss vom 03.12.1969):
„Ergibt sich aus der dargestellten katastrophalen Situation nach dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches schon allgemein, daß dem Gesetzgeber für die Regelung der Kriegs- und Kriegsfolgelasten ein sehr weites Gestaltungsermessen zugestanden werden muß (vgl. BVerfGE 15, 167 [201]; 23, 153 [168]), so gilt dies auch für die Ausgestaltung der in den Teilregelungen gewährten Ausgleichsoder Entschädigungsansprüche nach ihrer Art und Höhe. Der Krieg und seine Folgen haben in Millionen verschiedenartiger Fälle zu materiellen und immateriellen Schäden geführt. Es ist nicht möglich, für diesen Gesamtbereich gesetzliche Regelungen zu finden, die im Ergebnis jeden Bürger gleichstellen und Schicksalsschläge in jedem Einzelfall gerecht ausgleichen. Vielmehr muß es genügen, wenn die gesetzliche Regelung in großen Zügen dem Gerechtigkeitsgebot entspricht. Namentlich durfte sich der Gesetzgeber angesichts des Ausmaßes des ,Staatsbankrotts‘ (Herv. i. Orig.) beim Ausgleich von Schäden an Eigentum oder Vermögen darauf beschränken, gewisse äußerste Folgen auszugleichen, um die unbedingt erforderliche Grundlage für die wirtschaftliche Existenz der Betroffenen zu gewährleisten oder wiederherzustellen, er durfte also sozialen Erwägungen den Vorrang geben.“


Entscheidung „Einkommensbesteuerung“ (BVerfGE 82, 60, Beschluss vom 29.05.1990):
„Bei der Einkommensbesteuerung muß ein Betrag in Höhe des Existenzminimums der Familie steuerfrei bleiben; nur das darüber hinausgehende Einkommen darf der Besteuerung unterworfen werden.“


Entscheidung „Der Soldatenmord von Lebach – Resozialisierungsentscheidung“ (BVerfGE 35, 202, Urteil vom 06.06.1973):
Anm. d. Autorin: Ein wegen Mordes verurteilter Straftäter, dessen Tat in der Öffentlichkeit erhebliches Aufsehen erregt hatte, klagte kurz vor seiner Entlassung gegen eine Fernsehanstalt, die einen Spielfilm über seine Verbrechen ausstrahlen wollte. Das BVerfG untersagte die Ausstrahlung, weil dadurch der Resozialisierungsanspruch des Strafgefangenen verletzt werde. Der Resozialisierungsanspruch folge aus dem Grundsatz der Menschenwürde und dem Sozialstaatsprinzip. Aus dem Sozialstaatsprinzip folge die Pflicht zur Vor- und Fürsorge für Personen, die in ihrer sozialen Entfaltung behindert seien, auch wenn dies auf persönlicher Schuld beruhe. Zu diesen Personen gehörten auch Strafgefangene und -entlassene.
Leitsätze u. a.: „Für die aktuelle Berichterstattung über schwere Straftaten verdient das Informationsinteresse der Öffentlichkeit im allgemeinen den Vorrang vor dem Persönlichkeitsschutz des Straftäters. Jedoch ist neben der Rücksicht auf den unantastbaren innersten Lebensbereich der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten; danach ist eine Namensnennung, Abbildung oder sonstige Identifikation des Täters nicht immer zulässig. Der verfassungsrechtliche Schutz der Persönlichkeit läßt es jedoch nicht zu, daß das Fernsehen sich über die aktuelle Berichterstattung hinaus etwa in Form eines Dokumentarspiels zeitlich unbeschränkt mit der Person eines Straftäters und seiner Privatsphäre befaßt. Eine spätere Berichterstattung ist jedenfalls unzulässig, wenn sie geeignet ist, gegenüber der aktuellen Information eine erheblich neue oder zusätzliche Beeinträchtigung des Täters zu bewirken, insbesondere seine Wiedereingliederung in die Gesellschaft (Resozialisierung) zu gefährden. Eine Gefährdung der Resozialisierung ist regelmäßig anzunehmen, wenn eine den Täter identifizierende Sendung über eine schwere Straftat nach seiner Entlassung oder in zeitlicher Nähe zu der bevorstehenden Entlassung ausgestrahlt wird.“
Entscheidung „Pflichtarbeit beim Strafvollzug“ (BVerfG, Urteil vom 01.07.1998, 2 BvR 441/90):
Leitsätze u. a.: „Das Grundgesetz verpflichtet den Gesetzgeber, ein wirksames Konzept der Resozialisierung zu entwickeln und den Strafvollzug darauf aufzubauen. Dabei ist ihm ein weiter Gestaltungsraum eröffnet. Arbeit im Strafvollzug, die dem Gefangenen als Pflichtarbeit zugewiesen wird, ist nur dann ein wirksames Resozialisierungsmittel, wenn die geleistete Arbeit angemessene Anerkennung findet. Diese Anerkennung muß nicht notwendig finanzieller Art sein. Sie muß aber geeignet sein, dem Gefangenen den Wert regelmäßiger Arbeit für ein künftiges eigenverantwortetes und straffreies Leben in Gestalt eines für ihn greifbaren Vorteils vor Augen zu führen. Ein gesetzliches Konzept der Resozialisierung durch Pflichtarbeit, die nur oder hauptsächlich finanziell entgolten wird, kann zur verfassungsrechtlich gebotenen Resozialisierung nur beitragen, wenn dem Gefangenen durch die Höhe des ihm zukommenden Entgelts in einem Mindestmaß bewußt gemacht werden kann, daß Erwerbsarbeit zur Herstellung der Lebensgrundlage sinnvoll ist. Art. 12 Abs. 3 GG beschränkt die zulässige Zwangsarbeit auf Einrichtungen oder Verrichtungen, bei denen die Vollzugsbehörden die öffentlich-rechtliche Verantwortung für die ihnen anvertrauten Gefangenen behalten.“
2.3.2 Kernprinzipien der Umsetzung der sozialen Sicherung
Umsetzung durch den Staat durch Prinzipien
Somit verpflichtet das Grundgesetz den Staat zur Herstellung und zum Erhalt sozialer Sicherheit (soziale Sicherung). Die Umsetzung der sozialen Sicherung durch den Staat folgt wiederum bestimmten Prinzipien:
Vorsorge/Versicherungsprinzip: Die Verwirklichung eines Risikos wird durch die Verteilung der Folgen auf die Gesellschaft für den Einzelnen beherrschbar, z. B. gesetzliche Krankenversicherung (SGB V), gesetzliche Rentenversicherung (SGB VI), soziale Pflegeversicherung (SGB XI) oder Arbeitsförderung (SGB III).
Versorgungsprinzip/Entschädigung: Für Sonderopfer erfolgt ein voller Ausgleich (kein bloßer Gegenwert von Beitragszahlungen), wenn besondere Leistungen, insbesondere für den Staat erbracht wurden, z. B. Beamte (Treupflicht), Opferentschädigungsgesetz, Kriegsopferentschädigungsgesetz.
Förderungsprinzip: Soziale Ungleichheiten und Gegensätze werden ausgeglichen. Dies ist eine Folge des Gebots der sozialen Gerechtigkeit und Chancengleichheit, z. B. Wohngeld, Ausbildungsförderung, Kindergeld.
Hilfsprinzip: Bei Bedürftigkeit werden öffentliche Sach- oder/und Geldleistungen unabhängig davon gewährt, ob Beiträge gezahlt wurden oder nicht, z. B. Recht der Jugendhilfe, Sozialhilfe.
2.4 Rechtsstaat (Art. 20 Abs. 3 GG)
Deutschland ist ein Rechtsstaat (Maurer 2014). Art. 20 Abs. 3 GG beschreibt das Rechtsstaatsprinzip:

Art. 20 Abs. 3 GG
„Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.“
Alles staatliche Handeln ist danach an Gesetz und Recht gebunden. Struktur und Zuständigkeit folgen diesem Grundsatz (Katz 2010).
2.4.1 Materieller und formeller Rechtsstaat
Rechtsstaatsbegriffe
Man unterscheidet zwischen materiellem und formellem Rechtsstaatsbegriff. Der materielle Rechtsstaatsbegriff beschreibt einen Staat, dessen Ziel die Freiheit und Gerechtigkeit im staatlichen bzw. staatlich beeinflussbaren Bereich ist. Demgegenüber meint der formelle Rechtsstaatsbegriff, dass die Machtausübung des Staates durch Gesetz und Recht geregelt und begrenzt ist (Maurer 2014).
2.4.2 Wichtige Einzelausprägungen des Rechtsstaatsprinzips
Der Rechtsstaat basiert auf verschiedenen Grundsätzen, deren wichtigste nachfolgend genannt seien:
Verteilung der Macht im Staat: Der Grundsatz der Gewaltenteilung regelt die Verteilung der Macht im Staat (Degenhart 2014) und bildet damit das tragende Organisationsprinzip des Rechtsstaates der Neuzeit für die Ausübung der Macht im Inneren (Bethge/von Coelln 2011; Badura 2015).
Art. 20 Abs. 2 GG beinhaltet die Prinzipien der Volkssouveränität und der Gewaltenteilung:

Art. 20 Abs. 2 GG
„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.“
einzelne Gewalten
Danach sind drei Gewalten zu unterscheiden, die untereinander weisungsunabhängig sind (Maurer 2014; Schmidt 2015a):



Gerichtsinstanzen





Bindung an Recht und Gesetz: Alle staatlichen Maßnahmen müssen mit dem höherrangigen Gesetz vereinbar sein. Die öffentliche Verwaltung darf bei ihrem Handeln nicht gegen geltendes Recht, insbesondere gegen die Verfassung und die Gesetze verstoßen (Ipsen 2014a). Funktion und Rolle des Gesetzes kommen in zwei wichtigen Grundsätzen zum Ausdruck, die für den Rechtsstaat prägend sind (Badura 2015):
Vorrang/Vorbehalt des Gesetzes


Berechenbarkeit staatlichen Handelns: Der Rechtsstaat fordert Rechtssicherheit und Vertrauensschutz für die BürgerInnen (Maurer 2014). Er muss berechenbar sein und darf nicht willkürlich handeln. Die Adressaten von Normen oder staatlichen Vorgaben müssen die Rechtslage erkennen und sich auf sie verlassen können. Um dies zu erreichen, haben sich Prinzipien herausgebildet, die bei der Anwendung des Rechts zu beachten sind:
Maßstäbe staatlichen Handelns






Bedeutung
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz: Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz stellt eine der wichtigsten Handlungsmaximen für die Verwaltung dar (Maurer 2014). Maßnahmen dürfen nur getroffen, Handlungen nur gefordert werden etc., wenn dies verhältnismäßig ist (Degenhart 2014). Jedes staatliche Handeln muss danach im Hinblick auf den bei der Anordnung verfolgten gesetzlichen Zweck (legitimer Zweck) erfolgsversprechend sein (Eignung). Ferner muss gerade diese Zwangsmaßnahme zur Erreichung des verfolgten Zwecks erforderlich sein; das ist nicht der Fall, wenn andere, weniger einschneidende Mittel zur Verfügung stehen (Erforderlichkeit). Schließlich muss der jeweilige Eingriff in angemessenem Verhältnis zum verfolgten Zweck stehen (Manssen 2015; Badura 2015; Reinhardt 2014; vgl. zum Strafrecht BVerfGE 96, 44, 51).