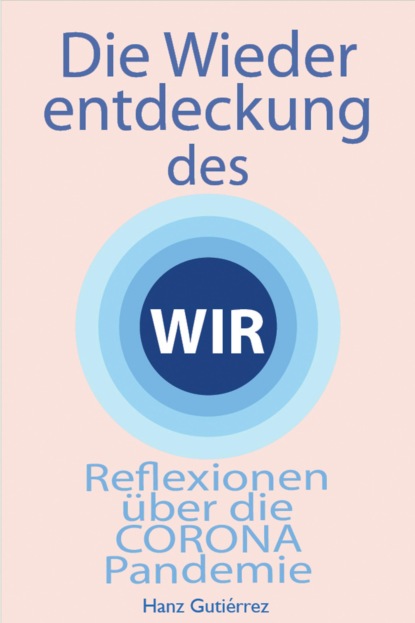- -
- 100%
- +

Hanz Gutiérrez
Die Wiederentdeckung des WIR
Reflexionen über die Coronapandemie
Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis
Titel
VORWORT
1: Liebe in der Zeit der Coronapandemie (Reflexionen basierend auf Liebe in der Zeit der Cholera von G. Garcia Màrquez)
2: Die Vorstellungskraft in der Zeit der Coronapandemie (Reflexionen basierend auf Das Dekameron von Giovanni Boccaccio
3: Fürsorge und Politik in der Zeit der Coronapandemie (Reflexionen basierend auf Antigone von Sophokles)
4: Rassismus, Politik und moralische Konflikte in der Zeit der Coronapandemie (Reflexionen basierend auf Nemesis von Philip Roth)
5: Schicksal, Angst und Vertrauen in der Zeit der Coronapandemie (Reflexionen basierend auf Die Pest von Albert Camus)
6: Vorhersehbarkeit und Kontingenz in der Zeit der Coronapandemie (Reflexion basierend auf Der Peloponnesische Krieg von Thukydides)
7: Chaos, Natur und Gott in der Zeit der Coronapandemie (Reflexion über De rerum natura von Lukrez)
8: Gott, unsere Zuflucht in der Zeit der Coronapandemie (Reflexionen über Psalm 61 von König David)
Impressum neobooks
Dieses Buch ist auch auf Englisch, Italienisch, Französisch und Spanisch erschienen.
© 2021 Hanz Gutiérrez, alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Werner E. Lange
Korrektorat: Erika Schultz
Über den Autor:
Hanz Gutiérrez, geb. 1960 in Peru, Doktor der Theologie (Universität Straßburg 1987), erster Doktorgrad (D.E.A.) der Philosophie (Universität Straßburg 1987), Doktor der Medizin (Universität Florenz 1999), Studienaufenthalte in Tübingen und Loma Linda (Kalifornien).
Er ist Kulturanalytiker und zur Zeit Dozent für Theologie, Ethik und Anthropologie an der Hochschule „Villa Aurora“ in Florenz. Er hat etwa 150 Zeitschriftenartikel verfasst und ist Co-Autor von sechs Büchern auf Italienisch über theologische und kirchliche Themen.
Gewidmet
Michael Kätzner in dankbarer Erinnerung
an eine alte kulturelle und musikalische Freundschaft,
Gunther Franke in der gemeinsamen und ständigen Suche,
uns und unsere Zeit besser zu verstehen,
und der italienischen Adventgemeinde in Bad Cannstatt
für ihre zeitlose Großzügigkeit
Dieses Buch basiert auf einer Artikelserie über die Coronapandemie, die zwischen März und Oktober 2020 in der Online-Ausgabe der Zeitschrift Spectrum erschienen ist, einer Veröffentlichung des US-amerikanischen „Adventist Forum“. Die Artikel enthalten kulturelle, soziale und politische Überlegungen zur Pandemie, die uns alle dazu veranlasst hat, einige unserer Aktivitäten, die bis vor Kurzem nicht aus unserem beruflichen und persönlichen Lebensstil wegzudenken waren, zu ändern oder sogar aufzugeben. Als Kulturanalytiker und Dozent für Theologie am Seminar „Villa Aurora“ in Florenz fühlte ich mich durch die Umstände fast gezwungen herauszufinden, was in den verschiedenen Phasen dieser Krise geschah. Daher auch die ursprünglich chronologische Form meiner Darstellung der Entwicklung der Pandemie (in dieser Ausgabe weitgehend weggelassen) und meiner sich daraus ergebenden Reflexionen auf der Grundlage von Werken der Weltliteratur.
Diese Reflexionen verkörpern auch eine spirituelle Sehnsucht – nicht nur, weil ich als Verfasser ein gläubiger Mensch bin, sondern auch, weil meine Überlegungen von der Wiederentdeckung einiger weitgehend verschwundener Begriffe berichten, die es pandemiebedingt wiederzufinden gilt.
Alle diese abhandengekommenen Begriffe – vor allem aber die Wirklichkeit, die sie bezeichnen – können mit der „Wiederentdeckung des Wir“ zusammengefasst werden. Daher auch der Titel dieses Buches. Aber dieses überraschend und fast widerstrebend gefundene „Wir“ ist nicht nur das moderne und synchrone (gleichzeitige) Wir einer Solidarität zwischen Völkern, die entdecken, dass sie auf demselben Planeten von demselben Feind bedroht werden – dem Covid-19-Virus und seinen Mutanten; dieses Wir ist auch das diachronische (d.h. historisch-vergleichende) Wir von Völkern, die vor uns gelebt haben und die wie wir am eigenen Leib erfahren haben, was es bedeutet, von einer Epidemie heimgesucht zu werden. Daher die Verknüpfung mit literarischen Werken der Vergangenheit, die auf unterschiedliche Weise und unter anderen Umständen das Gefühl von Verletzlichkeit und Angst vermitteln, von einer Gefahr überwältigt zu werden, die unsere Gewissheiten und unsere Bezugspunkte über den Haufen wirft. Die abschließenden Überlegungen gehen von Psalm 61 der Bibel aus und bieten eine pastorale Sichtweise, die uns Zuversicht in Zeiten von Bedrohungen gibt.
Hanz Gutiérrez
1: Liebe in der Zeit der Coronapandemie (Reflexionen basierend auf Liebe in der Zeit der Cholera von G. Garcia Màrquez)
Fermina und Florentino, die Hauptfiguren im Roman Die Liebe in den Zeiten der Cholera des kolumbianischen Nobelpreisträgers Gabriel García Márquez (1927–2014), verkörpern die belastbare und stabile Kraft der menschlichen Liebe. Sie hatten sich bereits als Jugendliche in den 1870er-Jahren in der kolumbianischen Hafenstadt Cartagena ineinander verliebt; doch diese platonische Beziehung wurde von Ferminas Vater beendet, weil er einen angesehenen Schwiegersohn haben wollte. Fermina heiratete schließlich einen Arzt. Nachdem der etwa 50 Jahre später nach einem Unfall verstorben ist, schreibt Florentino, der Fermina ewige Liebe geschworen hatte, Hunderte Briefe. Nach einer Dampferfahrt auf einem Fluss gibt sie seinem Werben nach.
Diese späte, unerwartete Liebe zwischen diesen 70-Jährigen blüht in einem Gebiet auf, das von der gefürchteten Choleraepidemie und verschiedenen Katastrophen heimgesucht wurde, die Kolumbien in den vergangenen 50 Jahren verwüstet haben. Eine institutionelle Krise, die Lockerung der sozialen Beziehungen, die zunehmende Armut, Korruption und politische Willkür haben die Stabilität eines Landes gefährdet, das in der Lage zu sein schien, seinen Bürgern eine beruhigende Kontinuität zu garantieren.
Parallel dazu sind die Flussufer, die einst bewaldet und mit einem herrlichen grünen Mantel bedeckt waren, durch schlechtes Wetter und Dürre einem langsamen, aber unaufhaltsamen Verfall erlegen – fast als wollten sie widerspiegeln, was unter den Menschen geschehen ist. Das Wasser hat sich zurückgezogen, und die Tierwelt, die sich sorglos am Flussufer ausgebreitet hatte, wurde vermindert und war gezwungen, in weniger lebensfeindliche Gebiete auszuwandern.
Doch inmitten der Überbleibsel der Natur und der Zivilisation finden Fermina und Florentino ihr spätes Glück und schaffen es, den Wunsch und das Streben nach Leben und Liebe lebendig zu erhalten. Die Liebe ist stärker als der Tod und hartnäckiger als die Zerstörung. Diejenigen, die diese Einstellung übernehmen und sich zu eigen machen, reagieren nicht nur angemessen und rechtzeitig auf die Bitten anderer, sondern schaffen es auch, sich den Antrieb und die Leidenschaft zu bewahren, die für das Überleben und ein besseres Leben notwendig sind. Die Zeit hat sich für beide als Feind und Freund zugleich erwiesen. Sie hat in den aufreibenden Ereignissen ihres Leben den Strom der Leidenschaft, den die Liebe anfangs bei den Verliebten ungestüm hervorruft, zwar verdünnt, ihn aber gleichzeitig auf die Probe gestellt, gestärkt und ihn in Richtung Kreativität und Treue gelenkt. Trotz widriger Umstände und der Brutalität der Geschichte, die manchmal ihren unbeugsamen und unerbittlichen Blick zeigt, konnte ihre Liebe schließlich aufblühen.
Dieser Roman handelt von Menschen, die sich für Hoffnung statt Verzweiflung entscheiden, für Selbsterkenntnis statt Selbstmitleid und Trauer, für Verbindungen statt Isolation, für kulturelle und religiöse Vermischung anstelle ideologischer und übertriebener moralischer Reinheit. Sie glauben, dass Liebe das Alter und die Zeit, uns selbst und andere, das Verhalten und die Institutionen verändern kann. Der Roman zeigt, dass Liebe keine Illusion und keine bloße Sublimierung von Triebenergien ist. Liebe, die standhält, trägt die Samen der Hoffnung in sich, die gerade in Zeiten der Krise und Verzweiflung wachsen und sich verbreiten müssen. Genau dort, wo wir vor den größten Herausforderungen stehen und alle unsere politischen, wirtschaftlichen oder religiösen Gewissheiten versagen, kann die Liebe zum Leben erwachen.
Geschichten wie die von Fermina und Florentino sind nicht nur eine Aufzeichnung dessen, was in der Vergangenheit passiert ist, sondern auch ein Zeugnis dessen, was in der Gegenwart geschieht und in Zukunft wieder geschehen kann. Gegenüber religiösen apokalyptischen Prophezeiungen schrecklicher Dinge sind weltliche Geschichten wie diese implizite messianische Prophezeiungen auf ein resilientes, emphatisches und gemeinschaftliches Leben, das Gott nicht nur den Gläubigen, sondern jedem Menschen frei ins Herz gelegt hat.
Ein Szenario der Verwüstung, wie es García Márquez erzählt hat, hat sich heutzutage leider auf der ganzen Welt ausgebreitet. Erst weit entfernt in China ist das Virus uns in Europa nahe gekommen und bedrohlich geworden. Die Ankündigung eines flächendeckenden Lockdowns in Norditalien, der Anfang März 2020 beschlossen wurde, um die Verbreitung des Virus zu stoppen, hat in ganz Europa die Befürchtungen geschürt, dass ebenso drakonische Maßnahmen von London bis Berlin getroffen werden – und das ist bald eingetroffen. Die Behörden arbeiten daran, die rasche Ausbreitung der Infektionen mit allen erforderlichen Maßnahmen in einigen der offensten und demokratischsten Gesellschaften der Welt zu verlangsamen, die solche Maßnahmen nicht gewohnt sind, und auf die viele Menschen allergisch reagieren. All die Ungewissheit –gekoppelt mit der Uneinigkeit zwischen Russland und Saudi-Arabien bezüglich der Erdölförderung – hat Anfang März 2020 zu einem „Black Monday“-Effekt geführt, der an den wichtigsten Finanzmärkten der Welt Panik ausgelöst hat. Der Dow Jones-Börsenindex in New York hat Verluste von mehr als sieben Prozent verzeichnet, und der Londoner Index hat mit einem Minus von rund acht Prozent abgeschlossen. Die anderen europäischen und weltweiten Finanzmärkte haben noch größere Verluste verzeichnet.
Aufgrund der raschen Verschlechterung der Lage hat sich der italienische Premierminister Giuseppe Conte am 6. März 2020 mit einer Botschaft an die Nation gewendet und erklärt, dass über ganz Italien bis zum 3. April eine Ausgangssperre verhängt wird, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Die von der italienischen Regierung auferlegten Einschränkungen sind die drakonischsten, die es jemals in einem demokratischen Staat gegeben hat.
Auf der anderen Seite des Ozeans hat Präsident Donald Trump in einer Rede an die Nation ein 30-tägiges Verbot für Flüge aus ganz Europa in die Vereinigten Staaten angekündigt, um zu verhindern, dass die Covid-19-Infektionen von Europa übergreifen. Da sich zu dem Zeitpunkt in den USA über 1000 Menschen infiziert hatten und bereits 36 an der Viruserkrankung gestorben waren, hat die NBA, die bekannteste und meistgesehene Basketballliga der Welt, die US-Meisterschaft sofort auf unbestimmte Zeit auszugesetzt, nachdem auch ein Spieler der Mannschaft Utah Jazz positiv auf das Coronavirus getestet wurde.
Der mit einem Oscar ausgezeichnete Schauspieler Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson haben zur selben Zeit in den sozialen Medien bekanntgegeben, dass sie positiv auf das Virus getestet wurden. Aber auch von institutioneller Seite wurde gewarnt: Der Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID), Dr. Anthony Fauci, der während einer Anhörung im Aufsichtsausschuss des Kongresses über die Herangehensweise an die Coronaepidemie sprach, sagte, man müsse rasch und entschlossen handeln, denn es werde noch viel schlimmer werden. Er hat leider Recht behalten. Mit dem gleichen Tenor, aber mit einer dramatischeren Auswirkung, sagte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ebenfalls am 6. März auf einer Pressekonferenz in Genf: „Wir haben die Situation untersucht und können Covid-19 als eine Pandemie bezeichnen.“
Es war bereits damals zu erkennen, dass diese Pandemie nicht nur enorme gesundheitliche und medizinische Folgen mit ebenso schwerwiegenden sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen haben wird, die verheerend und nicht immer sichtbar und messbar sind, sondern es wird auch für uns alle ein Leben vor der Pandemie und ein Leben nach der Pandemie geben. Unser Leben wird nicht dasselbe sein – es kann nie wieder dasselbe werden. Die existenziellen, psychologischen und anthropologischen Auswirkungen zeichnen eine neue Art und Weise ab, in dieser Welt zu leben.
Werden wir in der Lage sein, die Botschaft, die sich dahinter verbirgt, zu erkennen? Oder werden – wie so oft in der Vergangenheit – Gedankenlosigkeit, Gleichgültigkeit, Oberflächlichkeit und Automatismen sozialer oder religiöser Art schließlich die Oberhand gewinnen? Die Botschaft, die sich hinter diesen Geschehnissen verbirgt, ist eigentlich sehr deutlich und hat im Wesentlichen mit einigen verlorengegangenen Begriffen – und vor allem der Wirklichkeit, die sie bezeichnen – zu tun: Demut, Langsamkeit, Solidarität und Verletzlichkeit.
Diese Begriffe bezeichnen in Wirklichkeit die Essenz der Liebe. Haben wir vergessen, was Fermina und Florentino im Geist und in der Seele lebendig gehalten hat? Die Liebe als Motor und Elixier eines jeden Lebens! Ohne Liebe gibt es kein Leben – nur Trostlosigkeit. Sind wir vielleicht – ohne es zu merken – zu überheblich, anmaßend, hastig, selbstbezogen und abgebrüht geworden? Und haben die christlichen Kirchen, die diesem Trend (der eine kulturelle Rückbildung signalisiert) entgegenwirken und ihn aufhalten sollten, ihn nicht leider indirekt und schweigend legitimiert und verstärkt?
Aber das Leben hat seine Wege und Zeiten, um die Dinge wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Alles kann plötzlich auf den Kopf gestellt werden. Diese Zeit voller Anomalien und unerwarteter Paradoxien regt uns zum Nachdenken an; sie drängt uns, sich zu besinnen. In einer Zeit, in der der Klimawandel ein besorgniserregendes Ausmaß erreicht hat, waren erst China und dann zahlreiche europäische Länder gezwungen, die scheinbar unaufhaltbare Industrieproduktion und vor allem den Handel in Geschäften einzuschränken. Diese unerwartete Verlangsamung droht Teile der Wirtschaft zu ruinieren, aber die Umweltverschmutzung geht dabei erheblich zurück. In chinesischen Großstädten war der Anteil von Stickstoffdioxid in der Luft bereits im Februar 2020 um bis zu 30 Prozent gesunken. Die Luft wird besser. Wir verwenden Masken, um uns vor dem Covid-19-Virus zu schützen, aber in Städten atmen wir bessere Luft ein. Das sind Paradoxe, die uns zum Nachdenken anregen.
Lassen Sie uns kurz auf die Vorteile eingehen, die die erwähnten vernachlässigten Verhaltensweisen mit sich bringen können.
1. Demut
Es ist für niemanden leicht, sich in Demut zu üben – insbesondere, weil unsere Entscheidungen, die Wirtschaftsweise und die internationalen Organisationen zu einem unstrittigen Ergebnis geführt haben: einem breiten Wohlstand für viele Menschen wie nie zuvor in der Geschichte. Darauf ist Europa sicherlich stolz jenseits aller Kritik, die geübt werden kann, um diese Euphorie zu dämpfen. Die Geschichte Europas in der Neuzeit ist eine Erfolgsgeschichte. Dieser Kontinent ist zu Recht stolz auf seine kulturellen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Errungenschaften. Und vor allem auf sein großzügiges Sozialsystem, das hier im vergangenen Jahrhundert mit Weitblick und Überzeugung entwickelt wurde. Es gibt gute historische Gründe, mit Stolz sagen zu können, dass Europa die Welt verändert hat.
Aber in letzter Zeit macht sich auf in Europa ein weit verbreitetes Gefühl der Verhärtung nationaler Identitäten breit. Es ist paradox, dass in der Zeit, in der ein lange schlummernder Nationalstolz wiedererwacht und ein mit diskriminierenden Ideologien und Praktiken verknüpfter Narzissmus in Erscheinung tritt, ein alles veränderndes Virus auftaucht. Ein unbekanntes Virus, das Vorurteile und Verhaltensweisen in Frage stellt. Es kehrt sie ins Gegenteil und lässt uns plötzlich das Gefühl der Unzulänglichkeit und Ausgrenzung erleben, von dem wir dachten, dass es nur Migranten und Migrantinnen vorbehalten ist. Das Virus bringt uns unversehens in die Außenseiterrolle. Im Handumdrehen sind wir zu Diskriminierten, Ausgegrenzten, an der Grenze Aufgehaltenen geworden – zu Parias, die eine gefürchtete Krankheit in sich tragen. Alle Ehre und geschichtlicher Ruhm, alle Anhäufung von Genialität und Errungenschaften schmelzen in einem Augenblick dahin wie Wachs in der Sonne. Ganz gleich, wie weiß und intelligent, reich und kultiviert wir sind – plötzlich werden wir zu Verdächtigen. Es ist ein schreckliches Gefühl der Unzulänglichkeit und Hilflosigkeit, das durch das wachsende Misstrauen im stigmatisierenden Blick der Menschen um uns herum hervorgerufen wird.
Nur wer Demut gelernt hat, kann die eigene Situation und die der anderen mit Einfühlungsvermögen verstehen. Wie der französische Ökonom Serge Latouche (geb. 1940) schon seit einiger Zeit sagt, sind die westlichen Gesellschaften zu selbstbezogen geworden und beachten keine Grenzen mehr, die jedoch jede Gesellschaft im Auge behalten sollte. Daher ist es für uns in Europa (nicht nur wegen des Coronavirus) dringlich, das Bewusstsein unserer Begrenzungen wiederzuerlangen, und zwar durch den noblen Prozess der Wiederaneignung einer Tugend – einer Tugend, die heute zu einer seltenen Haltung geworden ist: die kulturelle Demut.
2. Langsamkeit
Viele Menschen leben in hektischen Städten in unpersönlichen Konglomeraten. Der zweifelslose Nutzen und der materielle Wohlstand, den uns diese Art der Organisation des Lebens gebracht hat, kompensieren die erlittenen Verluste jedoch nicht. Wenn wir die Ergebnisse abwägen, zählen wir zynischerweise dazu bereits auch Vorteile, die es nicht mehr gibt. Und die unerwünschten Folgen sind nicht nur Einsamkeit und Verlassenheit. Unser veränderter Blick ist nicht mehr in der Lage, selbst die zugrundeliegenden Anomalien klar wahrzunehmen. Und vielleicht ist die grundlegendste Anomalie, die sogar als Tugend vermarktet wird, die Beschleunigung aller Vorgänge. Wir hören nicht auf zu eilen. Wir laufen ständig – wo auch immer und unabhängig vom Anlass. Die Eile in all ihren Formen und ihrer Steigerung deformiert die Menschen auch, weil körperliche Bewegung für uns trügerischerweise zu einer moralischen Pflicht geworden ist. Wie der deutsch-koreanische Philosoph Byung-Chul Han (geb. 1959) sagt, haben die auf Produktivität und Konsum basierenden, übermäßig beschleunigten sozialen Systeme, in denen wir leben, unser Lebenselixier erschöpft und neutralisiert. Wir sind Gesellschaften ohne Lust am Leben geworden. Die Leidenschaft hat unsere Straßen und unsere Seelen verlassen. Wer hetzt und eilt, tötet die Neugier und die Leidenschaft.
Aber am Ende werden wir trotz unserer Erfolge langsamer. Es ist aber eine Verlangsamung, die uns von einem Virus aufgezwungen wird. Wir sind eine müde und erschöpfte Gesellschaft (eine Burnout-Society), die die Arbeit und sogar das Vergnügen als Drogen und Suchtmechanismen nutzt, um diese strukturelle Apathie abzuwehren.
Wir schaffen es nicht mehr zu leben, ohne etwas zu tun. Wir haben verlernt, uns auszuruhen. Wir haben den Wert der Langsamkeit vergessen. Und selbst wenn wir zu Hause bleiben (müssen), lässt uns die Arbeitsmentalität nicht los, die wie eine zweite Haut an uns haften bleibt. Zusammen mit der eigenen Familie friedlich zu Hause zu bleiben, ohne irgendetwas zu tun, und Zeit miteinander zu verbringen, die nicht produktiv ist, sondern das Vertrauen untereinander stärkt und uns gegenseitig bereichert, erscheint uns als ein Luxus, den wir nicht verdienen und den wir uns nicht leisten können. Aber wegen einer unvorhergesehenen Viruspandemie ändert sich plötzlich alles. Die Automatismen, die unsere Existenz regeln und sie vorprogrammieren und mechanisch machen, werden unterbrochen. Es kommt Panik auf – ein Gefühl der Leere.
Die Vergötterung einer konstanten und ständig wachsenden menschlichen Leistungserbringung wird entlarvt. Alles kann gestoppt werden, ohne dass etwas passiert – nichts von dem, was wir erwartet haben. Nun ist der Stopp gekommen; der Lockdown ist da. Die Liturgie unserer zwanghaften Handlungen kann tatsächlich jederzeit unterbrochen werden. Das Virus hat die Initiative übernommen. Es ist klüger geworden als wir. Es hat uns überrascht und nun wochenlang zu Hause eingesperrt. Alle Italiener müssen nun von Gesetzes wegen bis zum 3. April zu Hause bleiben. Wie werden wir mit einer Zeit umgehen, die für uns nur noch in Geldverdienen und Produktivität, in Bewegung und Reisen messbar ist? Werden wir die Zeit erkennen, die sich uns nun bietet, und sie auch anders erleben? Zum Beispiel weniger aggressiv?
3. Solidarität
In der heutigen Gesellschaft, in der wir leben, haben wir neben den unbestrittenen Vorteilen leider auch eine Verengung des Blicks geschaffen. Wir kümmern uns um das, was uns am nächsten ist, um unseren kleinen „Garten“, ohne uns um alles andere und um unseren Nächsten zu sorgen. Wir haben verlernt – wie der Soziologe Robert Bellah (1927–2013) es ausdrückte –, uns um das Gemeinwohl zu kümmern. Unsere Gesellschaft hat aufgehört, eine gute Gesellschaft zu sein. Eine gute Gesellschaft kann nur eine sein, die – ohne die Rechte und Privilegien des Einzelnen zu vernachlässigen – den Mut hat, soziale Bindungen und gemeinsame Initiativen und Träume aufzubauen.
Die Coronapandemie hat uns ganz plötzlich und auf unschöne Weise in einer anderen Realität erwachen lassen. Das Modell des mündigen und selbstständigen Bürgers ist ein Trugbild – eine kulturelle Lüge. Eine andere Botschaft klopft heute an unsere Tür: Niemand kann in Isolation überleben. Der einzige Ausweg führt über Gegenseitigkeit, Gemeinschaftsgefühl und das Bewusstsein, Teil von etwas Größerem zu sein.
Die vom Philosophen Charles Taylor (geb. 1931) kritisierte „Ethik der Authentizität“, die Selbsterfüllung, Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung zum Ziel hat und uns nur zur Kohärenz, Ehrlichkeit und Loyalität lediglich uns selbst gegenüber drängt (ein heute weit verbreitetes Streben und eine Art neuer Religion unserer Zeit), ist ein gigantischer Fehler. Um gut leben und um überleben zu können, brauchen wir etwas Größeres, um das wir uns kümmern. Und gleichzeitig müssen wir etwas Größerem angehören, das sich um uns kümmern kann. Wir brauchen eine geteilte Verantwortlichkeit – das Bewusstsein, dass unser Schicksal nicht nur von uns selbst, sondern auch von allen Menschen um uns herum abhängt und wir von ihnen abhängen. Sie ist eine Voraussetzung für das Leben. Sie ist das Leben. Wie der Philosoph und britische Großrabbiner Jonathan Sacks (1948–2013) treffend schrieb, müssen wir „in Zeiten tiefer Spaltungen das Gemeinwohl wiederherstellen“ und lernen, von einer Ethik des Ichs (I-Society) mutig zu einer Ethik des Wir (We-Society) überzugehen.
Wenn wir mit der Hexenjagd aufhören zu fragen, wer das Virus in die Welt gesetzt hat, wer daran schuld ist oder warum es alles passiert ist, und uns stattdessen fragen, was wir daraus lernen können, dann werden wir feststellen, dass es für jeden von uns eine Möglichkeit gibt, sich zu engagieren und unseren Beitrag in dieser Krisenzeit zu leisten. Wir werden entdecken, dass die dringend zu lernende Lektion darin besteht, dem Leben und anderen Menschen zutiefst verpflichtet zu sein. Niemand ist eine Insel. Der Wohlstand, den wir mehr oder weniger genießen, hängt nicht nur von unseren eigenen Bemühungen ab, sondern auch von den unentgeltlichen Beiträgen anderer, die uns meist implizit und indirekt erreichen. Die Coronapandemie macht uns das klar, wenn auch zu einem sehr hohen Preis.